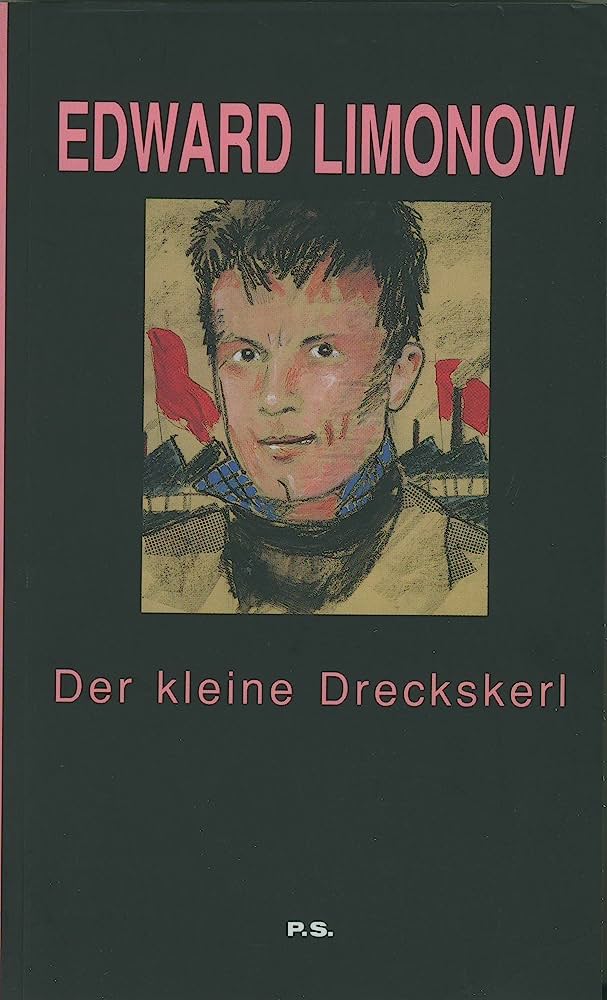1
»Piep-piep-piep.« Der Vogel pfeift dreimal. Der junge Limonow seufzt und öffnet widerwillig die Augen. Durch das große Fenster zum Tewelew-Platz ergießt sich eine gelbe Sonne wie zerlaufende Margarine in das schmale Zimmer. Die von seinen Künstler-Freunden ausgemalten Wände erfreuen den aufwachenden jungen Mann. Beruhigt schließt der junge Mann wieder die Augen.
»Piep-piep-piep« meldet sich der Vogel von neuem und fügt mit wütendem Flüstern: »Ed!« hinzu. Der junge Mann wirft die Decke zurück, steht auf, öffnet das Fenster und schaut nach unten. Unter dem Fenster, neben dem niedrigen Gitter der Gartenanlage, steht sein Freund Genka, der Prächtige, in einem leuchtend blauen Anzug, wirft den Kopf in den Nacken und lächelt ihm zu. »Du schläfst, du Hurensohn? Komm runter!« Hinter dem prächtigen Genka hat sich eine Zigeunerschar auf dem smaragdgrünen Rasen niedergelassen, sie nehmen ein Frühstück aus Melonen und Brot zu sich, das sie auf ihren glänzenden Kopftüchern ausgebreitet haben, die ihnen als Tischtuch dienen.
»Komm runter, komm runter, es ist schön heute!« schließt sich eine junge Zigeunerin Genka an und winkt dem jungen Mann im Fenster sogar zu.
Der junge Mann legt einen Finger an die Lippen, zeigt auf die benachbarten Fenster, nickt mit dem Kopf und flüstert: »Gleich!« Er schließt das Fenster, geht vorsichtig zur Tür, die ins Nebenzimmer führt und horcht. Ein Rascheln und einige Seufzer dringen zu ihm. Der Geruch von Tabak schiebt sich unter der Tür durch. Die Schwiegermutter sitzt zweifellos in ihrer klassischen Morgenpose — mit aufgelösten, bis auf die Schulter fallenden grauen Haaren — vor dem Spiegel und raucht eine Zigarette. Zilja Jakowlewna hat die schnelle Verhandlung zwischen ihrem Schwiegersohn und Gennadij, dem Prächtigen, ihrem schlimmsten Feind, anscheinend gar nicht mitbekommen. Der junge Mann weiß, daß es jetzt schnell und entschlossen zu handeln gilt. Aus dem Bücherschrank, in dessen unterem Teil er seine Wäsche aufbewahrt, nimmt er einen mit goldenen Funken gesprenkelten kakaofarbenen Anzug — seinen ganzen Stolz —, und zieht schnell die Hose, ein rosa Hemd und das Jackett an. Am Kopfende des Bettes steht ein Spieltisch, auf dem Bleistifte, Kugelschreiber, Papier, eine fast leere Weinflasche und ein aufgeschlagenes Heft herumliegen. Der junge Mann wirft einen bedauernden Blick auf sein noch nicht vollendetes Gedicht, schließt das selbstgebastelte Heft, hebt die Tischplatte hoch und entnimmt dem Fach einige Fünfrubelscheine. Er legt das Heft ins Fach und läßt die Platte wieder einrasten. Die Gedichte können bis heute abend warten. Er nimmt seine Schuhe in die Hand und öffnet vorsichtig die Tür zum dunklen Flur. Ohne Licht zu machen, schleicht er tastend an Annissimowas Tür vorbei und führt vorsichtig den Schlüssel in das Schloß der Tür, die aus der Wohnung in die Freiheit führt.
»Eduard, wohin gehen Sie?« Zilja Jakowlewna hat das metallische Klirren des Schlüssels im Schloß doch gehört, oder aber sie hat intuitiv erfaßt, daß ihr Schwiegersohn gerade dabei ist, sich aus dem Staub zu machen. Sie ist aus ihrem Zimmer gekommen, hat das Licht im Flur angemacht und steht nun da in ihrer klassischen Pose Nummer Zwei. Eine Hand ruht auf der Hüfte, die andere führt die qualmende Zigarette an den Mund, die grauen, vollen, aufgelösten Haare reichen bis zur Taille; wütend hat sie das markante Gesicht dem Nichtsnutz von Schwiegersohn zugewendet. Dem russischen Schwiegersohn, Freund ihrer jüngsten Tochter. »Sie wollen sich wieder mit Genka treffen, Eduard? Leugnen Sie nicht, ich weiß es! Vergessen Sie nicht, daß Sie versprochen haben, heute die Hose für Zinzypera fertigzumachen… Und wenn Sie sich mit Genka treffen, dann fangen Sie wieder an zu zechen…«
Zilja Jakowlewna Rubinstein ist eine wohlerzogene Frau. Es ist ihr peinlich, dem jungen russischen Mann, mit dem ihre Tochter zusammenlebt, zu sagen, daß er, wenn er Genka trifft, sich wieder wie ein Schwein voll laufen läßt und seine Freunde ihn vielleicht, wie letztes Mal, nach Hause tragen müssen.
»Wo denken Sie hin, Zilja Jakowlewna… Ich gehe nur runter etwas Nähgarn kaufen… und dann komm ich zurück…« lügt der kurzgeschorene, leicht aufgedunsene Dichter und stellt etwas verlegen seine Schuhe auf den Fußboden. Er schiebt die Füße in die Schuhe und entschlüpft in den langen, auf beiden Seiten mit Küchentischen, Herdplatten und Gasbrennern vollgestellten Flur. Den Vorzug eines abgegrenzten Teils mit Küche und Toilette genießen nur drei Familien, den übrigen Bewohnern des alten Hauses am Tewelew-Platz Nummer 19 dient der Flur als Küche, und die Toilette wird gemeinschaftlich benutzt. Der Dichter läuft an den Tischen vorbei, atmet nacheinander die Gerüche von einem Dutzend zukünftiger Mahlzeiten ein, erreicht das andere Ende des Flurs und stürzt, indem er immer drei Stufen auf einmal nimmt, die Treppe hinunter. »Vergessen Sie nicht Zinzypera!« Der ohnmächtige Appell Zilja Jakowlewnas erreicht noch seine Ohren. Der Dichter grinst. Was für ein Name! Zin-zy-pera! Weiß der Teufel, was das heißt, aber bestimmt ist das kein Name.
Genka erwartet den Dichter neben dem Tor zum Bursatzkij-Abhang. Er hat einen Koffer in der Hand. »Wieviel Geld hast du?« fragt der Prächtige anstelle einer Begrüßung. »Fünfzehn.« — »Beeil dich, sonst verliere ich meinen Platz in der Schlange.« Gennadij und der Dichter laufen schnell den Bursatzkij-Abhang hinunter und biegen an der ersten Ecke links ab. Zum Pfandleiher.
Schwere, fast dunkelblaue Schatten liegen über der Straße. Die Sonne ist von dem Gelb einer dicken Ölfarbe, die gerade gerinnt. Man braucht kaum die Augen vom Gehsteig zu heben, um zu verstehen, daß es August ist in Charkow.
Schon fünfzig Meter vor dem massiven alten Ziegelgebäude, das einer Festung gleicht, umfängt die Freunde ein starker Naphtalingeruch. Seit hundert Jahren durchtränkt diese Institution das ganze Viertel mit Naphtalin, und an diesem Straßenende scheinen selbst die alten Akazien nach Mottenpulver zu riechen. Die beiden Freunde laufen die alten ausgetretenen Stufen hoch und betreten die Halle. Drinnen ist es kalt, die Halle ist hoch und weiträumig wie eine Kathedrale. Sie drängeln sich zwischen den Greisen und den alten Frauen durch und fassen eine Schlange ins Auge, die zu einem kleinen vergitterten Fenster führt. Die Alten schauen die jungen Leute verwundert an. Zweifellos kommt es nicht gerade häufig vor, daß es junge Leute in Charkow zum Pfandleiher verschlägt. Dabei ist der Dichter bestimmt schon ein dutzendmal dort gewesen. Mit Genka.
»Was hast du mitgebracht?« fragt der Dichter seinen Freund.
»Die Regenmäntel von meinem Vater und meiner Mutter, einen Anzug von meinem Vater, zwei Golduhren…«, zählt Genka grinsend auf. Er hat ein ganz besonderes Grinsen: böse und trocken.
»Das wird dich zugrunde richten, Gennadij Sergejewitsch!«
»Das ist nicht Ihr Problem, Eduard Wenjaminowitsch!« entgegnet ihm Genka. Er beschließt aber, daß sein Freund eine Erklärung verlangen kann, und fügt hinzu: »Sie sind im Urlaub. Für einen Monat. Und haben mir nur zweihundert Rubel dagelassen. Ich hatte sie gewarnt, daß mir das nicht ausreichen würde. Wenn sie wiederkommen, werden sie für das Unrecht büßen müssen, das sie ihrem einzigen Sohn angetan haben…«
Genka bringt häufig seine Sachen und die seiner Eltern zum Pfandleiher. Er hat diese Methode des Gelderwerbs schon erfunden, bevor er den Dichter Eduard kennenlernte. Genkas Vater löst die Sachen jedes Mal wieder ein. Papa Sergej Sergejewitsch liebt seinen hübschen, stattlichen und blauäugigen Sohn. Obschon der Papa sich aufregt über die vollkommene Gleichgültigkeit seines Sohnes gegenüber jeder Art menschlicher Tätigkeit — wenn man einmal von Gennadijs Abenteuerjagd und den Restaurantbesuchen absieht, dabei ist Genka bereits 22 Jahre alt —, verzeiht er ihm sowohl den Pfandleiher als auch noch schlimmere Sachen. Die fehlgeschlagene Ehe beispielsweise. Der Papa — und nicht Genka — zahlt Gennadijs Ex-Ehefrau und ihrem Sohn, seinem Enkel, Alimente. Papa Sergej Sergejewitsch ist Direktor des größten Restaurants in Charkow, des Restaurants »Der Kristall«, und einer Restaurantkette gleichen Namens.
Genka gibt sich keine Mühe, die Sachen aus dem Koffer heraus zu nehmen, er schiebt den Koffer unter dem Gitter durch, das sich entgegenkommend geöffnet hat und tritt ungeduldig mit dem Absatz auf den gekachelten Boden. Beim Pfandleiher kennt man den jungen Gontscharenko gut, und die Transaktion nimmt daher nicht viel Zeit in Anspruch. Zehn Minuten später gehen sie ruhig die Straße hinab, die nach Naphtalin und Akazien riecht. Genka steckt mit Befriedigung die sechzig Rubel in seine Brieftasche aus schwarzem Leder. Angeekelt faltet er die Quittung und steckt sie in ein anderes Fach seiner Brieftasche. »Und nun, wohin gehen wir?«
2
Sie klettern über die Steinmauer, die den Taras-Grigorewitsch-Schewtschenko-Park vom Charkower Zoo trennt. Sie könnten sich durchaus auch Eintrittskarten leisten, pro Nase ein Rubel zwanzig, betrachten es aber als ehrenrührig, für den Zutritt zu »ihrem« Territorium zu zahlen. Der Zoo ist traditionell der Ort, wo Ed, Genka und die anderen Mitglieder der »SS« — eine Bande von Gleichaltrigen, die sich um Genka den Prächtigen geschart hat — ihre Zeit verbringen. Der Maler Wagritsch Bachtschanjan, Paul Schemmetow, »der Franzose«, Viktor, »der Fritz«, und Fima mit dem Spitznamen »Hund« gehören auch noch zu der Bande. Jedes »SS«-Mitglied zeichnet sich durch irgend etwas Ungewöhnliches aus. Die »SS« ist keine gewöhnliche Gruppe junger Leute.
Die Augustsonne ist gnadenlos in Charkow. Und trotzdem tragen die jungen Leute Anzüge: Gennadij hat den Dandy-Stil eingeführt, und der ehemalige Gießereiarbeiter und heutige Dichter Ed hat das bereitwillig übernommen und sogar bereichert. Sie springen über den Zaun, landen im Dschungel des zoologischen Gartens und schlängeln sich zwischen den riesigen Dornbüschen, Haselnußsträuchern und anderen sommerlichen Wucherungen über einen nur ihnen bekannten Pfad in die Schlucht hinab. Bei einer alten Eiche, die auf dem Grunde wächst, steigen sie in der Nähe der Garküche wieder aus der Schlucht heraus. Die alten, früher einmal roten und nun gelblich-rot verwaschenen Mauern heißen sie willkommen. Die Schuhe der jungen Leute sind voller Blütenstaub, der nun das üppig wuchernde Gras vom anderen Geschlecht befruchtet. Gennadij trägt ein Paket mit Wodkaflaschen. Offiziell werden in der Garküche keine alkoholischen Getränke verkauft. Hintereinander gehen sie den Pfad entlang. Ed wischt sich das Gesicht mit einem Taschentuch ab. Von Zeit zu Zeit holt eine dicke Wolke Schnaken sie ein und versucht, so viel Blut wie möglich aus der sich ständig vorwärtsbewegenden Quelle zu saugen. Genka und Ed wedeln mit den Händen und den Zigaretten, die sie rauchen, und schlagen den Angriff zurück. Schweißgebadet, aber unerschüttert kommen sie oben an und gehen auf dem schmalen Pfad zwischen den sorgfältig gepflanzten Blumen auf den Eingang der Garküche zu. Wie zu ihrer Begrüßung ertönt aus den Tiefen des zoologischen Gartens das Brüllen eines Tigers.
»Dschulbars«, behauptet der Dichter.
»Sultan«, entgegnet Genka.
Allein auf der offenen Veranda, rückt die Kellnerin, »Tante« Dusja, die Stühle zurecht. Sie ist eine kräftige Frau mit einem einfachen und schönen Gesicht; sie ist etwas über dreißig Jahre alt und trotzdem eine »Tante«. »Oh, wer kommt denn da! Genka!« ruft sie freudig aus. Wie soll sie sich auch nicht freuen? Der Dandy Gennadij gibt ihr immer dicke Trinkgelder, Ed ist davon überzeugt, daß sie in einer ganzen Woche im Dienst der Zoobesucher für das Auftragen von Eierspeisen, Erbswürstchen, Hühnchen à la Kiew und Hühnchen Tabaka nicht so viel bekommt.
»Dusja, stellen Sie den Wodka in den Kühlschrank, wenn ich Sie darum bitten darf.« Genka, der seinen Vater, den Ex-KGB-Oberst und jetzigen Generaldirektor nachahmt, wendet sich immer in diesem höflichen Tonfall an die Leute. Das ist sein besonderer Schick. Außerdem flucht Genka nicht, was ihn vorteilhaft von vielen anderen Freunden Eds unterscheidet, die mit unflätigen Reden nur so um sich werfen.
»Zweifellos kennen Sie Eduard Limonow, Dusja?« Genka schaut Ed ironisch an.
»Dein Freund ist doch schon oft mit dir hier gewesen, Genka.«
»Zweifellos, Dusja… Aber seither hat er seinen Namen gewechselt. Vergessen Sie ihn nicht, Eduard Limonow…«
Eduard Sawenko hatte seinen Namen nicht geändert. Bloß hatte (im Zimmer von Anna und Ed) die »SS«, zusammen mit anderen — Lonka Iwanow, dem Dichter Motritsch und Tolja Melechow —, aus Langeweile ein literarisches Spiel daraus gemacht, sich als Dichter und symbolistische Maler auszugeben, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Charkow gelebt hatten. Wagritsch Bachtschanjan hatte vorgeschlagen, daß alle sich einen Namen ausdenken sollten, der ihnen entsprach. Lonka Iwanow hatte sich Odejalow genannt, Melechow war Buchankin geworden. Und was Ed betraf, hatte Bachtschanjan vorgeschlagen, ihn Limonow zu nennen. Als das Spiel zu Ende war, waren sie alle nach Hause gegangen, aber am nächsten Tag hatte Bachtschanjan im »Automaten« seinem Künstler-Freund von der Zeitung »Lenins Nachfolge« Ed als Limonow vorgestellt. Und seither nennt er ihn hartnäckig nur noch so. Genka gefiel der Spitzname »Limonow«. Alle jungen »Dekadenzler«, die sich im »Automaten« herumtreiben, nennen Ed jetzt Limonow. Der Spitzname klebte fest, und Eduard Sawenko wurde immer seltener Ed genannt. Er blieb Limonow. Odejalow war längst wieder von Lonka Iwanow fallengelassen worden, niemand nannte mehr Melechow Buchankin, aber ihn, ihn nannte man jetzt immer Limonow. Übrigens gefiel ihm sein neuer Name, er wußte aber nicht, wieso. Sein richtiger Name, der sehr gewöhnliche ukrainische Name Sawenko, hatte ihn immer bedrückt.
Die jungen Leute setzen sich auf der Veranda so an den Tisch, daß sie den Blick auf den Teich mit seinen Schwänen und Enten genießen können. Die »Garküche« ist zweifellos das malerischste Restaurant in ganz Charkow, deshalb hat Genka es auch als Stabsquartier ausgesucht. Vom Teich weht ein modriger Geruch herüber. Zwei Arbeiter ziehen träge einen Schlauch hinter sich her und machen sich genau so träge daran, die üppigen Blumen zu sprengen.
»Und nun, Genosse Limonow, was werden wir mit dem Wodka zu uns nehmen?« Genka zieht seine Jacke aus und hängt sie über die Stuhllehne. Er krempelt sich die Ärmel seines makellos weißen Hemdes hoch und lockert den Knoten seiner Krawatte. »Etwas Huhn?« Der Dichter zögert. Er ist gewohnt, sich in solchen Fragen auf den sehr viel weltläufigeren, sichereren und erfahreneren Gennadij zu verlassen.
»Dusja, was haben Sie heute Schönes?« wendet Genka sich an die wieder auf der Veranda erschienene »Tante« Dusja.
»Oh Genka… Es ist viel zu früh.« Dusja runzelt bedauernd die Stirn. »Der Koch ist noch nicht da, wir machen erst mittags auf. In der Zwischenzeit kann ich euch eine Kleinigkeit machen, wenn ihr wollt, ein Omelett mit Würstchen. Wenn der Koch kommt, wird er euch Kotelettes à la Kiew zubereiten.« Ein Pfau stößt plötzlich einen verzweifelten Schrei aus, und wie auf ein Zeichen hin schreit, brüllt und lärmt der ganze Zoo.
»Also Ed, nehmen wir Omeletts mit Würstchen?«
»Einverstanden.«
»Dusja, machen Sie uns Omeletts mit Würstchen. Sechs Eier für jeden. Mit Speck, wie ich sie mag. Und bitte etwas Salat. Tomaten, Gurken…«
»Wollt ihr auch Salzgurken, Kinder?«
»Selbstverständlich, Dusja, auch Salzgurken. Und noch zwei Flaschen kalte Limonade.«
»Soll ich den Wodka in eine Karaffe füllen, ja?«
Dusja wirft einen prüfenden Blick auf Genkas Gesicht.
»Nein, das ist nicht nötig, dann wird er warm. Bringen Sie uns jedem ein Gläschen und legen Sie die Flasche bitte auf Eis, Dusja.«
»Traumhaft, Ed, nicht?« Genka betrachtet mit verzücktem Blick den Teich. Gleich hinter dem Teich ist ein Freigehege mit Pfauen. In der Ferne sieht man die dunklen Umrisse der Elephanten. Ein Windstoß trägt einen atemberaubenden Dunggeruch herüber. »Herrlich!« Genkas hübsches Gesicht strahlt eine ruhige Verzückung aus.
Genau das sucht er im Leben, eine schöne Landschaft, eisgekühlten Wodka, ein Gespräch mit einem Freund. Sogar die Frauen sind für Gennadij zweitrangig. Schon seit einem Jahr gibt es in seinem Leben die hübsche Nonna, die Genka ganz offensichtlich liebt, aber auch Nonna konnte ihn nicht von den Streifzügen mit den »SSlern« ablenken, von den Fahrten zum Ausflugsrestaurant »Monte Carlo«, von den Spaziergängen mit Ed auf der Sumskaja-Straße, von dem Vergnügen des Nichtstuns.
Angenehm berührt schaut Ed seinen eigenartigen Freund an. Genka verspürt offenbar gar keinen Ehrgeiz. Mehrfach hat er schon zugegeben, weder ein Dichter, wie Motritsch und Ed, noch ein Maler wie Bachtschanjan sein zu wollen. »Malt ihr nur Bilder, schreibt ihr nur Gedichte, ich werde mich über euern Erfolg freuen!« sagte er lachend.
Zilja Jakowlewna ist der Ansicht, daß Gennadij Gontscharenko der böse Geist von Ed ist, daß er ihn zum Trinken anhält und daß er ihn von Anna entfernt, von ihrer Seite ist das jedoch reine Eifersucht. Es stimmt natürlich, daß Ed schon mehrfach in seiner Gesellschaft das Geld vertrunken hat, das er beim Hosenschneidern verdient hat. Aber er kann einfach nicht ständig bloß auf Genkas Kosten trinken. Jedenfalls sind die elenden zehn oder zwanzig Rubel, die er manchmal ausgibt, gar nichts im Vergleich zu den Summen, die Genka verpraßt. Und auch paßt das Wort »vertrinken« nicht zu dem Stil von Gennadij Sergejewitsch. Als sie das letzte Mal im »Monte Carlo« ein Fest feierten, einem kleinen Restaurant auf dem Lande bei Pesotschin, wo die Nomenklatura und die KGB-Leute von Charkow essen gehen, war Genka in einem Taxi vorgefahren, Ed saß in einem zweiten, und ihnen beiden folgte noch ein drittes leeres, das Genka angemietet hatte, um Eindruck zu schinden, um einen Konvoi zu bilden. Im »Monte Carlo«, das Sergej Sergejewitsch häufig besucht hatte, bis ihn sein Magengeschwür davon abhielt, hatte Genka den Platz seines Vaters geerbt, das Personal kannte ihn gut und reservierte ihm immer ein besonderes Zimmerchen. Bis er Genka kennenlernte, hatte Ed von Séparées nur aus Büchern gehört. Im »Monte Carlo« laufen die Hühnchen vor dem Fenster eines Séparées hin und her, man zeigt auf das, welches einem gefällt, und es wird sofort à la Tabak zubereitet. Es gehört zu den Widersprüchen des »Monte Carlo«, daß im großen Saal die Fernfahrer essen. Eine Autobahn führt daran vorbei. Und gleichzeitig fließt in den Privatsalons ein süßes Leben dahin…
Tante Dusja bringt den Imbiß, die Limonade und jedem ein gebrutzeltes Omelett in einer heißen Pfanne. Genka schaut zufrieden auf den gedeckten Tisch. In der einen Hand hält er das Wodkaglas, in der anderen die Limonade. »Trinken wir auf diesen wunderbaren Augusttag, Ed, und auf die Tiere unseres geliebten Zoos!«
»Trinken wir!« pflichtet Ed ihm bei, und sie schütten die brennende Flüssigkeit in sich hinein. Gleich danach trinken sie die Limonade. Jeder nimmt sich eine Gurke, und sie verbrennen sich den Mund am heißen Omelett.
*
»Hast du dich gestern wieder von Zilja Jakowlewna anschreien lassen, Ed?« — Genka hat sein Omelett verzehrt und eine Zigarette angezündet.
»Oh Gott, ich kann mich nicht erinnern! Ich erinnere mich noch, daß du mich vor der Haustür aus dem Taxi geworfen hast, daß ich den Türgriff noch erwischt habe und… dann hat sich alles gedreht. Wie spät war es? Zwei Uhr?«
»Was heißt hier zwei? Noch nicht mal eins war es. Höchstens Zeit für die Kleinen… Du hast gestern ziemlich früh aufgegeben. Ich bin mit Fima noch zum Flughafen gefahren, um ein bißchen aufzutanken…«
»Ich habe überhaupt nicht aufgegeben«, entgegnet der Dichter beleidigt. »Die vorletzte Nacht habe ich überhaupt nicht geschlafen, bis zum Morgengrauen habe ich geschrieben. Ist doch klar, daß man nach einer schlaflosen Nacht müde ist. Du selbst hast gestern sogar gekotzt.«
»Ich kotze häufig«, gibt Genka gelassen zu. »Die Römer haben das so gemacht. Bei ihren Orgien. Ein bißchen kotzen und dann weiteressen und trinken.«
»Heute hat mich Zilja Jakowlewna an der Tür abgefangen! ›Wohin gehen Sie, Eduard?‹ fragte sie.«
»Und was haben Sie geantwortet, Eduard Benjaminowitsch?«
»Daß ich Nähgarn kaufen gehe! Und hab die Schuhe in der Hand. Wollte lautlos verschwinden.« Genka fängt an zu lachen. »Nähgarn. Limonow ist Nähgarn kaufen gegangen…«
»Zilja Jakowlewna hat mir natürlich nicht geglaubt. Aber weil sie eine gebildete Frau ist, hat sie ihren russischen Schwiegersohn nicht gefragt: ›Und warum haben Sie Säufer Ihre Schuhe in der Hand, wenn Sie bloß Nähgarn kaufen gehen? Es ist doch nichts Kriminelles, wenn man Nähgarn kaufen geht!‹«
»Ihr ist es peinlich, dich beim Lügen zu erwischen. Da siehst du, was das heißt, Erziehung und Bildung. Eine russische Schwiegermutter hätte das ganze Haus zusammengeschrien, sie hätte dir bei dem Versuch, dich zurückzuhalten, den Ärmel abgerissen. Es ist schon ganz gut, Limonow, daß du in einer jüdischen Familie lebst… Und Anna?«
»Ich glaube, daß Anna gestern noch schlief. Ich erinnere mich, daß sie schnarchte. Sie hat nur kurz die Augen aufgemacht und gesagt: ›Du verfluchter Säufer, du hast dich wieder mit Genka betrunken!‹ Dann ist sie wieder eingeschlafen. Und heute, als sie wegging, habe ich noch geschlafen.«.
»Du mußt ihr ein Geschenk machen«, sagt Genka mit einem Grinsen. »Oder noch besser, Ed, wir gehen um sechs zum Kiosk, holen sie ab und dann gehen wir alle zusammen ins ›Lux‹, was hältst du davon?«
»Können wir machen«, stimmt Ed nicht gerade begeistert zu.
»Dusja, bring uns bitte noch eine Runde«, bestellt Genka. »Ed, die ersten Vertreter der Hammelherde, die schon ihre Runde durch den Zoo gemacht haben, nehmen Kurs auf uns.«
Eine Familie nähert sich der »Garküche«. Die beiden etwa zehnjährigen Jungs tragen trotz der großen Hitze dunkelblaue Wollhosen. Die Hosen sind viel zu lang und unten schon ganz grau vom Staub. Die Mutter ist erstaunlich alt im Verhältnis zu so jungen Kindern, sie hat ihren Körper in ein viel zu enges und zu kurzes Kleid gezwängt. Der Vater — eindeutig ein Arbeiter aus einer der unzähligen Charkower Fabriken — trägt ein gelbes kunstseidenes Hemd, eine schwarze Hose, Sandalen ohne Strümpfe und hat ein Einkaufsnetz in der Hand, in dem irgend etwas in Zeitungspapier Eingewickeltes drin ist. Die mürrischen Kinder kommen als erste die Stufen hoch. Erst als sie auf der Veranda sind, betritt der Vater die erste Stufe; Genka steht auf, rückt die Krawatte zurecht und macht ein ernstes Gesicht.
»Genossen, Genossen…! Der Zugang ist verboten. Das Restaurant ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Vereinigung der Dompteure von bengalischen Tigern versammelt sich hier heute zu ihrem Kongreß. Man kommt nur mit einer Einladung herein.«
Ohne ein Wort zu sagen, entfernt sich die Familie gehorsam. Ed empfindet sogar etwas Mitleid mit dieser kleinen Hammelherde.
»Warum hast du das gesagt, Genka?« wendet er sich an seinen Freund. »Sie hätten eine Limonade getrunken, ihre belegten Brote verzehrt und wären dann wieder abgezogen…«
»So eine Hammelherde ist verdammt laut, Ed. Hast du die Kinder gesehen? Das sind so kleine Alte. Kannst du dir vorstellen, wie die beim Fressen schmatzen?«
»Du kannst sie nicht alle fernhalten. Es werden noch andere kommen.«
»Dusja, seien Sie so nett und stellen Sie auf alle Tische auf unserer Seite der Veranda kleine ›Reserviert‹-Kärtchen!«
»Aber Genka, wir haben keine solchen Kärtchen!« bedauert Dusja. Eine dicke grüne Heuschrecke springt zwischen ihren Beinen hervor und landet auf dem Nebentisch. »Kärtchen! Dabei gibt es nicht einmal Toiletten, die Gäste müssen in die Schlucht gehen.«
»Dann schreiben Sie bitte auf Papierblätter ›Reserviert‹ und stellen Sie die auf die Tische. Ihre Arbeit wird selbstverständlich bezahlt werden.«
Dusja entfernt sich, um den Befehl auszuführen. Ihre Gehorsamkeit erklärt sich nicht allein dadurch, daß Genka ihr beim Weggehen Fünfer oder auch Zehner zusteckt, sondern auch dadurch, daß die »Garküche« im Zoo direkt zur Restaurantkette von Papa Sergej Sergejewitsch gehört, in der Papa Zar und Gott ist. Papa hat Gennadij zwar strengstens verboten, seine Stellung für persönliche Zwecke auszunutzen, aber der machthungrige Genka kann der Versuchung, sie »für persönliche Zwecke auszunutzen«, nun einmal nicht widerstehen. Genka liebt die Macht, begreift Ed plötzlich. Der Macht gilt Genkas ganzer Ehrgeiz. Genka hat das Gebaren eines Herzogs.
»Genka, warum trittst du nicht in die Partei ein und wirst ein großer Mann, sagen wir, Sekretär des Bezirkskomitees?«
»Du scherzt wohl, Ed? Die Karriere eines Kommunisten ist eine einzige Schweinerei. Es reicht, daß mein Vater sein halbes Leben damit verbracht hat, auf den Knien herumzurutschen.«
Der Umstand, daß Genka grobe Worte gebraucht, beweist seine Abneigung gegenüber der Karriere eines Kommunisten. Genka sind alle Ideologien gleichgültig, er hat keine politischen Ideen. Er will nur seinen Spaß im Leben haben — Vergnügen, Abenteuer, Romantik. Und welchen Spaß kann es schon machen, seinen Hosenboden auf den Stühlen der Partei abzuwetzen? Genkas Lieblingsfilm ist der Film »Die Abenteurer« mit Alain Delon und Lino Ventura in den Hauptrollen. Dieses Leben liebt Genka, die Schatzsuche, Schußwechsel, teure Restaurants, Whisky, Kerzenschein, Champagner… Genka, Nonna, die genau so schön ist wie er, und Ed hatten sich diesen Film zusammen angesehen. Ed erinnert sich an die leuchtenden Augen von Genka nach dem Film. Genka sieht nicht schlechter aus als Alain Delon, »Schönling« nennt Bachtschanjan ihn. Blond, ein Meter achtzig, hellblaue Augen, eine gerade Nase, eine vornehme Haltung… Als sie aus dem Kino kamen, hatten sie getrunken und einige Tage lang gefeiert und waren schließlich nachts auf der Landebahn des Charkower Flughafens festgenommen worden, als sie versuchten, ein Frachtflugzeug zu besteigen. Was hatten sie sich davon versprochen? Niemand weiß es. »Die Abenteurer« beginnen mit einer Szene, in der Alain Delon mit einem Flugzeug unter dem Arc de Triomphe durchfliegt.
»Und wir machen es, Ed?«
»Ja, wir machen es, Genka.« Ed wirft einen zärtlichen Blick auf ihn.
3
»Sie trinken, die Dreckskerle!«
Anna Moissejewna hat ihren Auftritt in dem Augenblick, wo Dusja zum x-ten Male die Gläser füllt. Sie steht neben der Veranda auf der Wiese, ihre Augen blitzen vor Wut. Ihr mächtiger Körper ist in ein Kleid aus Crêpe de Chine mit grünen, schwarzen und weißen Blumen gehüllt. Sie trägt eine Handtasche. Ihre grauen Haare türmen sich in einem hohen Knoten. Ihre leichte Stupsnase verleiht ihrem schönen Gesicht einen streitsüchtigen Ausdruck.
»Hannah Mussijewna!« — Die Feiernden erheben sich. »Setzen Sie sich zu uns, Hannah Mussijewna, und essen Sie mit uns ein Kotelett à la Kiew!«
»Dreckskerle! Schämt ihr euch nicht? Schon am frühen Morgen sauft ihr Wodka…« faucht Anna und geht um die Veranda herum zur Treppe. Einige Vertreter des Proletariats, die es trotzdem geschafft haben, einen Platz auf der Veranda zu ergattern, beobachten die Szene neugierig.
»Dieser Schuft, wieder hat er Zilja Jakowlewna, diese arme jüdische Frau, hintergangen! Er ist Nähgarn kaufen gegangen! Die naive Zilja Jakowlewna, Kind eines anderen Zeitalters, ein Engel, den mein Vater geheiratet hat. Zilja Jakowlewna weiß nicht, was das ist, die Lüge! Sie hat Vertrauen zu diesem Ungeheuer! Er ist Nähgarn kaufen gegangen!«
»Schlag mich, gib mir eine Ohrfeige, Anna!« Der Dichter wendet ihr theatralisch sein Profil zu und hält ihr seine Wange hin.
Gennadij Sergejewitsch wird außerordentlich liebenswürdig.
»Hannah Mussijewna, verzeihen Sie uns, um Gottes Willen, seien Sie so gut und nehmen Sie teil an unserem bescheidenen Mahl!»
Genka nimmt Anna Moissejewna bei der Hand und umarmt sie. Er schiebt einen Stuhl heran, und es fehlt nicht viel, daß er sie auf den Stuhl genötigt hätte. Immer noch wütend setzt sie sich.
»Dusja, wenn ich Sie bitten darf, noch ein Gedeck für Anna Moissejewna… Hannah Mussijewna, ich bin daran schuld, daß Ihr Mann hier ist. Heute morgen war ich allein, ich war verzweifelt, mit einer Lüge habe ich Ed seiner Familie entrissen; ich ließ mich nur von meinem persönlichen egoistischen Interesse leiten: um Frieden für meine Seele zu finden.«
»Die arme jüdische Frau…« Anna Moissejewna läßt sich nicht beirren und setzt ihren üblichen Monolog fort, ohne auf die Reden von Genka und dem Dichter zu achten. »Ich bin nach Hause gelaufen… Zu Hause gab es nichts zu essen… ›Eduard ist Nähgarn kaufen gegangene hat Mutter Zilja ganz aufgelöst erklärt… ›Um neun ist er weggegangen, Mama‹, habe ich gesagt. ›Es ist jetzt elf Uhr. Bestimmt betrinkt er sich, Mama!‹… ›Aber vielleicht kommt er noch wieder?‹ hat Zilja Jakowlewna schüchtern bemerkt, die Vertrauen zu dir hat…« Anna wirft einen wütenden Blick auf Ed. Dieser hat demütig den Kopf gesenkt, und Genka gibt ihm zu verstehen: Geduld, laß sie reden.
»Du hast ihr, dieser armen jüdischen Frau, nicht einen Rubel für das Essen dagelassen, du Dreckskerl!« fährt Anna fort. »Und das, obschon wir ihre ganze Pension verzehrt haben.«
»Ich habe im Augenblick kein Geld. Du weißt ganz genau, daß ich keinen Vorschuß bekommen habe…«
»Bei der Revision ist ein gigantischer Fehlbetrag festgestellt worden, Gennadij«, wendet Anna sich an Genka. Genka nickt mitfühlend.
»Wir hofften, daß dieser junge Dreckskerl die Hose von Zinzypera fertigstellen würde, um sich zehn Rubel zu verdienen, damit Zilja Jakowlewna zum Mariä-Verkündigungs-Markt gehen könnte, um etwas zu Essen zu kaufen… Aber dieser kleine Dreckskerl hat sich davongemacht.«
»Hannah Mussijewna«, versucht Genka einen Einwand, während Anna zur Fortsetzung ihres Monologs neue Kräfte schöpft. »Ich bitte Sie, nehmen Sie diese bescheidene Gabe an.« Er entnimmt seiner Brieftasche einen Zehnrubelschein und hält ihn Anna hin.
»Wir brauchen Ihr Geld nicht, Gennadij Sergejewitsch!« erklärt Anna stolz, richtet aber einen interessierten Blick auf den Geldschein.
»Nehmen Sie ihn nur, Hannah Mussijewna! Ich habe Ed verführt, seine Arbeit für Zinzypera im Stich zu lassen. Es gehört sich, daß ich meine Schuld begleiche.«
»Und nun?« Anna Moissejewna wirft einen prüfenden Blick auf den Dichter. »Na gut, nach all dem, ich nehme es… Wir haben nichts zu Hause, überhaupt nichts…«
»Laß das«, murmelt Ed. Er verflucht sich dafür, daß er vergessen hat, Zilja Jakowlewna wenigstens fünf von den fünfzehn Rubeln, die er noch hatte, dazulassen. Anna hat nun das Recht, ihm eine Moralpredigt zu halten und ihn als kleinen Dreckskerl zu beschimpfen. Denn sonst hat Anna Angst vor ihrem Dichter, obschon sie sieben Jahre älter ist. Und mindestens doppelt so schwer wie er.
»Ich nehme es! Sonst würdet ihr es sowieso vertrinken!« Mit einem schnellen Griff hat Anna den Schein in ihrer Handtasche verschwinden lassen.
»Hannah Mussijewna, nehmen Sie doch ein Gläschen Wodka!«
Genka schenkt Anna selbst ein, Dusja hat die Flasche auf dem Tisch gelassen. »Trinken Sie, vergessen Sie Ihre Sorgen.«
Anna lächelt endlich. »Ihr Dreckskerle! Seit drei Tagen trinkt ihr. Und nicht ein Mal habt ihr an diese arme jüdische Frau gedacht, die sich in ihrem Zeitungskiosk langweilt. Ihr hättet die jüdische Frau wenigstens ein Mal in ihrer Pause abholen und sie ins Restaurant einladen können.« Anna trinkt ihren Wodka vorsichtig, nicht so wie der Dichter und Genka, und sie verzieht das Gesicht.
»Aber wie haben Sie uns gefunden, Hannah Mussijewna?« Genka versteckt sein Vergnügen und Entzücken nicht. Ihm gefällt es, wenn irgendwas passiert. Zu zweit wurde das Gequatsche schon etwas langweilig, und plötzlich — siehe da — ist Anna Moissejewna aufgetaucht.
»Genka!« — Anna wirft einen verachtungsvollen Blick auf Genka. »Alle Welt kennt Sie, Sie und diesen jungen Dreckskerl, den einzigen in der ganzen Stadt, der einen mit goldenen Funken gesprenkelten, kakaofarbenen Anzug trägt. Ich bin zuerst zum Restaurant ›Theater‹ gegangen, wo man mir gesagt hat, daß man euch heute morgen die Sumskaja-Straße hochgehen gesehen habe. Dann bin ich ins ›Lux‹ gegangen und da wart ihr nicht. In den ›Drei Musketieren‹ auch nicht. Ich war überall, sogar im ›Automaten‹, und da hat Mark mir erzählt, daß der kleine Dreckskerl und Sie, Gennadij Sergejewitsch, in den Schewtschenko-Park gegangen seien… Und wo können solche Leute, wie ihr es seid, schon hingegangen sein, in dieser Jahreszeit, wenn alles bis zum geht nicht mehr blüht, wenn die Kastanien reifen, die Blumen duften und alle Welt zum x-ten Male Liebe macht? habe ich mich gefragt.« Anna Moissejewna seufzte. Geschraubte Ausdrücke sind ihre Schwäche. Sehr oft würzt sie ihre Rede auch noch mit Zeilen lebender oder verstorbener Dichter. »Leute wie Genka und der kleine Dreckskerl können nur in die ›Garküche‹ zu Dusja gegangen sein, habe ich mir gesagt und bin hierher gelaufen.« Anna Moissejewna hält inne, sehr zufrieden mit sich.— »Und so bin ich jetzt hier. Ich werde nicht mehr zur Arbeit zurückkehren!« fügt sie hinzu, nachdem sie einen Blick auf ihre Uhr geworfen hat. »Ich werde sagen, daß ich krank war.«
»Sie könnten beim KGB ein Sherlock Holmes werden, Hannah Mussijewna«, schmeichelt ihr Genka. »Sie haben alle Fähigkeiten dazu.«
»Lonka Iwanow behauptet, daß Sherlock Holmes kokainsüchtig war und zwischen zwei Ermittlungen immer sniffte…« bemerkt der Dichter und leert sein Wodka-Glas.
»Lonka Iwanow ist meschugge«, erklärt Anna streng. »Man hat ihn aus der Armee gefeuert, weil er meschugge ist.«
»Überhaupt nicht. Lonka wollte selbst sich rausschmeißen lassen. Als er seinen Urlaub hatte, war er schon Unteroffizier, und Viktor hat ihm erzählt, wie er es machen solle. Daß es am klügsten sei, den Wahnsinnigen zu spielen. Viktor hat ihm erzählt, wie er sich selbst vor der Musterungskommission verhalten hat. Als er aus seinem Urlaub zurückkehrte, hat Lonka das gleiche gemacht. Beim Mittagessen ist er in die Küche gestürzt, hat sich einen Topf mit Grütze auf den Kopf gestellt, ein paar Koteletts unter die Schulterklappen gesteckt und ist so in den Speisesaal gegangen… Ein anderes Mal ist er in den Club gestürzt, wo die Soldaten sich gerade einen Film ansahen, und hat die Leinwand von der Wand gerissen… Dabei wollte er bloß nach Hause, anders gesagt, Lonka ist weniger verrückt als wir alle«, beendet Ed seine Verteidigung Iwanows.
»Ed, ich glaube, Anna hat Recht, Lonka Iwanow ist wirklich schizophren«, widerspricht Genka dem Dichter. »Er ist nicht gewalttätig, aber er hat einen Dachschaden. Hast du nie seinen Blick bemerkt?«
»Oh! Und wer ist dann nicht verrückt? Und Hannah Mussijewna, ist sie nicht verrückt?« Der Dichter lacht abschätzig.
»Ich habe erst ein Mal versucht, mich umzubringen. Und du, Ed, schon mehrfach«, schreit Anna fast und springt vom Stuhl auf. »Ja, es stimmt, daß ich eine Invalidenrente der Klasse 1 bekomme, daß ich Schizo bin, aber ich war neunzehn, als dieser Hurensohn, mein erster Mann, mich verlassen hat. Wenn man neunzehn ist, dann glaubt man noch an die Leute.« Anna Moissejewna setzt sich wieder, nicht ohne einen aggressiven Blick auf die Hammelherde geworfen zu haben, die um sie herum die Ohren spitzt.
»Ach, zum Teufel mit Iwanow…«, beruhigt sie Genka. »Lassen Sie uns lieber auf Sie trinken, Hannah Mussijewna, und auf Sie, Eduard Wenjaminowitsch, auf Ihre gute Beziehung. Sie soll lang und dauerhaft sein.«
»Auf unser Konkubinat! Auf unsere illegale Ehe!« lacht Anna. »Auf uns! Weißt du, Genka, als dieser kleine Dreckskerl sich in meinem Zimmer eingenistet hat, haben wir so getan, als ob er nicht bei mir wohnen würde. In der Nacht habe ich die Tür immer fest zugeschlagen, um meine arme Mutter zu täuschen. Und dann hat plötzlich meine Tante Ginda vorgeschlagen, das kleine Zimmer zu vermieten, um unser Einkommen etwas aufzubessern. Die kluge Zilja Jakowlewna wollte der Schwester ihres verstorbenen geliebten Mannes nicht gestehen, daß ihre Tochter in ihrem Zimmer einen sieben Jahre jüngeren Burschen beherbergte und mit ihm ins Bett ging! ›Ah, Ginda!‹ sagte sie. ›Wir sind in einer schrecklichen Lage!‹ Mehr hat Mama nicht sagen können. Arme Mutter! Das Leben hat ihr nicht zugelächelt. Papa Moissej ist an einem Infarkt gestorben, und seine Tochter bekommt ihr Leben einfach nicht in den Griff…«
»Während ihre zweite Tochter einen Fabrikdirektor geheiratet hat und in Kiew in der Hauptstraße, der Kreschtschatik-Straße, in einer bürgerlichen Wohnung lebt. Von einem Schwiegersohn wie Theodor kann man nur träumen. Ein Fabrikdirektor…«
»Meine Schwester ist anständig, es bricht einem das Herz«, bemerkt Anna Moissejewna und ißt eine Salzgurke. »Aber meine Nichte, Stella, ist eine Hure. Und sie legt es darauf an, noch mehr zu verkommen. Sie läßt keinen Mann aus. Genka, dieser großen Störchin von Stella, der wachsen aus jedem Auge ein Paar Klöten. Schon mit vierzehn hat sie zum ersten Mal abgetrieben!… Ich habe meine Jungfräulichkeit erst mit achtzehn verloren…«
Genka lacht. »Andere Zeiten, andere Sitten, Hannah Mussijewna!«
»Oh Lautrec, kommst du denn nie an die Pedale!« fängt Anna plötzlich an zu singen. »Oh Lautrec, hast du heute schon alle Bars abgegrast? Hast du alle Frauen begrapscht?« Sie verstummt, wie üblich hat sie die folgenden Strophen vergessen.
»Von wem ist das?« fragt Genka beeindruckt; für ihn ist Anna eine Intellektuelle, eine Gelehrte.
»Von Miloslawskij. Eines seiner ersten Gedichte.« Ed verzieht das Gesicht. »Jurij ist ein Angeber, er französelt, er näselt. Er pflegt eine abgedroschene Romantik des Pariser Kaffeehaus- und Atelierlebens. Lautrec…«
»Und ich erinnere mich noch an diese Madeleines, die die Mäntel eines blatternarbigen Christus geflickt haben…« Anna rezitiert von neuem Miloslawskij und wirft einen unverschämten Blick auf ihren Gatten. Und natürlich kennt sie die folgenden Zeilen wieder nicht. »Drei Banditen und Aphrodite an einem Holzfeuer!« fügt sie hinzu.
Das Gedächtnis von Anna Moissejewna ist vollgestopft mit Fragmenten von Gedichten, Liedern, gelehrten Zitaten, die sie hier und da aufgeschnappt hat, Maximen von Philosophen oder Schriftstellern. Von Zeit zu Zeit wirft Anna einen Fetzen, eine Zeile, eine Strophe, einen Splitter in Gottes Angesicht, um ihre ständigen Monologe zu schmücken. Als sie sich kennenlernten, war die Gelehrsamkeit von Anna Moissejewna Ed, dem Jungen aus der Arbeitervorstadt von Charkow, der gerade in der Fabrik »Hammer und Sichel« gekündigt hatte, als der Gipfel der Intellektualität erschienen. Jetzt, wo er Limonow geworden ist, spottet er über die »Sturzbäche der Kenntnisse« Annas. Um die großsprecherische Romantik, mit der, wie er findet, Anna Gedichte vorträgt, nachzuahmen, hebt er mit getragener Stimme an:
Gebt mir eine Frau in blau blau
Ich werde eine Linie auf ihrem Rücken ausführen
Und auf dieser Linie werde ich ihr Gatte sein
Ah nie hätte ich sie heiraten sollen
Sondern mehr mit den Katzen auf den Dächern heulen…
»Hör auf, Sawenko!« schreit Anna. »Verhunze nicht die Verse meines Freundes Buritsch. Du bist nicht groß genug, um sie zu verstehen!«
»Er ist ein schlechter Dichter«, stellt Limonow ohne Mitleid fest. »Ich war lange der Ansicht, daß Buritsch, wenn schon kein guter, so doch wenigstens ein origineller Dichter sei, und plötzlich fällt mir ein Buch des polnischen Dichters Ruschewitsch in die Hände. Und was sehe ich da, Genka? Daß der Stil von Buritsch wie ein Ei dem anderen dem Stil von Ruschewitsch gleicht! Und! Wie nennt man das! Ein Plagiat! Um so mehr, wenn ich auch noch erfahre, daß Buritsch und seine Frau etwas Geld damit verdienen, polnische Dichter zu übersetzen!«
»Buritsch ist ein wunderbarer Dichter!« Annas Augen richten sich mit unglaublichem Haß auf ihren »Gatten«. »Und das ist der einzige Grund dafür, daß niemand ihn veröffentlichen will!«
»Buritsch«, kichert der »Gatte«, »er soll so kahl wie ein Knie sein, hat man mir erzählt. Wagritsch hat ihn in Moskau gesehen, deinen Buritsch, dick und vollgestopft. Ein doller Bourgeois der Literatur!«
»Das stimmt nicht! Buritsch ist sehr schön! Er hat die Lokken eines Apoll… Bach hat sich bestimmt getäuscht, es war nicht Buritsch…«
»Wie das, er hat sich getäuscht… Er war es sehr wohl, dein Apoll, der Freund deines Gatten, das Genie von Simferopol…«
»Sie waren alle sehr begabt, Genka. Höre nicht auf diesen kleinen Dreckskerl. Begabt und sehr gebildet. Sie kannten alles. Sie haben immer gelesen. Sie waren viel gebildeter als wir alle…«
»Begabung hat mit Bildung nichts zu tun.« Ed verzieht sein Gesicht.
Ed ist neidisch auf die Generation von Anna. Er ist neidisch auf ihren früheren Ehemann, den Regisseur beim Fernsehen, auf die Freunde ihres Ehemanns, die in Moskau leben, auf den Dichter Buritsch, auf den Filmkritiker Miron Tschernenko, auf den Maler Brussilowskij. Für die Charkower Jugend in Eds Alter, die ein paar Mal täglich in den »Automaten« kommt, um eine Tasse Kaffee zu trinken, ist Moskau, wie für Tschechows »Drei Schwestern«, ein verführerisches, blendendes Licht, das Symbol des Erfolges und des Sieges. Von Annas Altersgenossen ist der Künstler Brussilowskij besonders berühmt. Wagritsch Bachtschanjan äußert sich sehr ehrfürchtig über Brussilows Arbeiten. Seine Bilder sind sehr oft auch auf internationalen Ausstellungen zu sehen, und ab und zu erscheinen Reproduktionen in westlichen Zeitschriften. Am wenigsten von allen hat Annas Ex-Ehemann erreicht, er lebt auch nicht in Moskau, sondern in Simferopol. Eduard will unbedingt nach Moskau, deshalb vergleicht er sich mit der vorangegangenen Generation (sie sind zehn, fünfzehn Jahre älter als er). Er vergleicht, bekämpft und verlacht Annas Vergangenheit im Namen seiner Gegenwart, im Namen Eduard Limonows.
Die Sonne stürzt über das Dach der Garküche auf den Tisch, auf den abgeschabten, geputzten und wieder geputzten Holztisch voller Teller mit Sakuski, Wodkagläsern, Limonadenflaschen und setzt alles in Brand. Wie schön ist ihr Tisch, mein Leser! Ein Salat von ukrainischen blutroten Tomaten, das zarte Grün der Gurken, über denen das Sonnenblumenöl in tausend Tropfen Feuer fängt. Die Sonne bricht sich in den Wodka- und den hohen Weingläsern, alles ist voller Sonne, ein Haufen von Sonnen auf dem Tisch. Die sonnengebräunten Hände des Dichters, die Hände von Anna, die ihre Nägel mit einem ungewöhnlichen Lila lackiert hat… Die schöne Hand von Genka, die den Fuß eines Glases umfaßt. Der Stein des Manschettenknopfes von Genka fängt die Sonne auf und spinnt einen feinen roten Faden.
»Ist das ein echter Stein?« Anna greift nach Genkas Arm.
»Echt!« Genka lacht. »Falsch, aber das ist in Mode. Wenn es ein echter wäre, hätte ich ihn schon längst zum Pfandleiher getragen.«
»Oh Genka…, eines Tages wird Sergej Sergejewitsch deinetwegen einen Herzanfall bekommen.«
»Das sind Albernheiten, Anna. Vater hat sehr viel Geld. Und gewisse Dinge ist er mir schuldig in diesem Leben…«
4
Eduard Sawenko hatte Anna Rubinstein im Herbst 1964 kennengelernt. Boris Tschurilow hatte sie einander vorgestellt. Eduard war damals einundzwanzig und hatte gerade in der Fabrik »Hammer und Sichel« aufgehört, wo er anderthalb Jahre mit Tschurilow in der Gießerei gearbeitet hatte. Er hatte kurzgeschnittenes Haar, er war sonnengebräunt und verbarg eine starke Kurzsichtigkeit; der junge Arbeiter suchte eine neue Stelle und sein Schutzengel Boris hatte ihn zum »Poesie«-Laden gebracht, wo man einen Straßenbuchhändler suchte. Die schöne Anna Moissejewna, damals siebenundzwanzig Jahre alt und schon grauhaarig, ließ dort ihre metallischen Pfennigabsätze klappern und schminkte die Lider ihrer blauen Augen mit einem seltsamen Lila. Unglücklicherweise war die Stelle schon besetzt.
Um ihre Annäherung zu erklären, wäre es am einfachsten zu sagen, daß der junge Arbeiter eine Mutter brauchte. Dieser primitive Freudismus hält einer Kritik in diesem Falle jedoch nicht stand, wenn man bedenkt, daß es sich bei Eduard Sawenko um eine durchaus eigensinnige und vollkommen unabhängige Persönlichkeit handelte. Außerdem war Anna Moissejewna Rubinstein, verrückt, exzentrisch und vulkanisch wie sie war, unfähig, irgend jemandes Mutter zu sein. Daher drängt sich anstelle der freudianischen eher eine sozialpsychologische Erklärung auf. Eduard Sawenko brauchte ein Milieu. Und die Leute, mit denen Anna zusammen war, gefielen ihm. Mit einundzwanzig Jahren, nachdem er Dieb, Einbrecher, Bauarbeiter, Möbelpacker und Gießer gewesen war, nachdem er die Krim, den Kaukasus und die asiatischen Republiken bereist hatte, nachdem er damit begonnen hatte, Gedichte zu schreiben, und das bald wieder sein ließ, hatte er sich immer noch nicht gefunden. Er wußte nicht, wer er war.
In der Gießerei hatte er ein gutes Auskommen, und sein Photo hing sogar an der Ehrentafel. Er besaß sechs Anzüge, drei Mäntel und trank jeden Samstag in Gesellschaft von Freunden, jungen Arbeitern und ihren Mädchen, im Restaurant »Kristall« gewissenhaft seine achthundert Centiliter Kognak. Mit Genka, dem Sohn des »Kristall«-Direktors, war er damals natürlich noch nicht bekannt.
Die Mädchen aus der benachbarten Werkstatt, die die Formen für die Gießerei herstellten, nannten unseren Helden wegen seines unverständlichen Eifers und seiner Hingabe an diese schwere und schmutzige Arbeit im Schichtdienst »den Sklaven«. Sein Kumpel am Fließband, ein Prolo von fünfzig Jahren, Onkel Serjoscha, der an eine Krabbe erinnerte, hielt Eduard auch für verrückt, fand ihn jedoch arbeitsam und nannte ihn »Endik«. Eines schönen Tages reichte »Endik« zur großen Überraschung von Onkel Serjoscha und der ganzen Gießerbrigade (er arbeitete zu der Zeit am Ofen) seine Kündigung ein. Er langweilte sich. Er hatte genug. Der eigentliche Grund, der wie immer unbekannt blieb (denn jedes Ereignis hat neben einem auf der Hand liegenden auch einen verborgenen Grund), war, daß Eduard im Frühling 1964 die Bekanntschaft von Michail Kopissarow gemacht hatte, nach dem damals bereits alle Kriminalpolizeien des Sowjetlandes wegen umfänglicher Kreditbetrügereien fahndeten. Der kleine geniale Jude, der die Bergbauschule nicht beendet hatte, kam aus dem Donbass, wo er in einem Bergwerk als Vorarbeiter gearbeitet hatte, nach Charkow. Außerdem hatte er. eine Bande von Betrügern angeführt. In Charkow tauchte Mischa nur noch mit seinem Partner Viktor auf, den Rest der Bande hatte man bereits verhaftet. Michail hatte seine Familie in Charkow, seine Mutter, seinen Vater und seinen Bruder Jurij, anständige Arbeiter in der Fabrik, die wir bereits kennen, der Fabrik »Hammer und Sichel«. Nahe bei einem Zaun, wo es nach Pisse stank, hatte der ängstliche Jurij Ed seinem kriminellen Bruder vorgestellt. Mischa hatte Ed gefallen. Mischa war klein, lustig, trug einen Schnurrbart und hatte die Lebensart eines Millionärs. So nahm er etwa jede Woche einen Flug von Donetsk nach Moskau, um sich dort die Haare schneiden zu lassen.
Mischa hatte Geld. Er benötigte zwei Ausweise. Einen für sich und einen für seinen Kumpel Vitja. Und unser Held, der sich an seine Vergangenheit, an die guten alten Zeiten erinnerte, hatte Mischa geholfen, die Ausweise zu besorgen, indem er ihn seinen Freunden aus dem Wohnheim der »Hammer und Sichel«-Fabrik vorgestellt hatte. Die Freunde hatten ihm Ausweise für fünfunddreißig Rubel das Stück verschafft, die sie anderen Kumpels gestohlen hatten.
Mischa hatte sich in Charkow eingerichtet und seine Kreditoperationen wieder aufgenommen. Jeden Tag verließen Mischa und Vitja das Hotel »Roter Stern«, ein Hotel, das der Armee gehörte und in der Swerdlow-Straße lag, wo sie in enger Nachbarschaft mit Hauptleuten und Obersten zusammenlebten. Sie besuchten die Kaufhäuser von Charkow. Mit den gestohlenen Ausweisen und gefälschten Arbeitspapieren kauften sie »auf Kredit« einen Haufen Golduhren, Schmuck, Stoffballen für Anzüge und Mäntel und sogar Fernseher. All diese Schätze der Zivilisation bezahlten diese Betrüger nur zu einem Viertel ihres Preises, und über geheime Kanäle verkauften sie sie en gros weiter. Eines Tages stellte Ed, den Mischa schon oft ins Restaurant eingeladen hatte und dem er sich dankbar erweisen wollte, Mischa auf dem Pferdemarkt einigen Leuten aus Baku vor; sie wurden die Hauptabnehmer von Mischas Waren. Ein anderes Mal hing der neugierige Arbeiter Sawenko, der in dieser Woche in der dritten Schicht arbeitete, mehrere Tage lang mit den Betrügern in den Juwelierläden herum, um Mischas und Vitjas Arbeitsweise zu beobachten.
Sogar die Leute, die das Gesetz achten, sind manchmal sehr nervös. Und was kann man da von Kriminellen erwarten, die einer so delikaten Arbeit nachgehen? Mischa und Vitja gerieten bald in Streit und wurden handgreiflich. Sie trennten sich für immer. Die Schlägerei ereignete sich im Hotel »Roter Stern«: die beiden Geschäftspartner warfen sich Stoffballen und Schmuckstücke an den Kopf, was den ehrlichen Jurij in Schrecken versetzte und den vorsichtigen Arbeiter Eduard zumindest beunruhigte.
Einige Tage später lud Mischa Eduard wieder einmal ins Restaurant ein, und nach dem Essen, beim Kognak und einer Havanna, schlug er ihm ganz geschäftsmäßig, im Tonfall der Gangster in westlichen Kriminalfilmen, vor, mit ihm zusammenzuarbeiten. Mischa streifte seine Asche ab, zog beiläufig einen Packen zerknitterter Fünfundzwanzigrubelscheine aus der Tasche und zahlte, während er Eduard ein idyllisches Bild ihrer gemeinsamen »Arbeit« in Odessa, Kiew, Donetsk und Simferopol ausmalte.
»Und dann, Ed, gehen wir mit unserer ganzen Ware (wir beschränken uns sowieso nur auf den Schmuck) in den Kaukasus und verkaufen da alles selbst. Hier in Charkow müssen wir unsere Ware zum halben Preis an diese Schwarzärsche verkaufen, da unten erzielen wir richtige Preise. Einverstanden, Ed?«
Wenn man einundzwanzig Jahre alt ist, Leser, und Geld und Reisen in Aussicht gestellt bekommt, wie kann man da widerstehen? Eduard war seiner Arbeit in der Gießerei überdrüssig und nahm das Angebot an.
Mischa beschloß, zuerst nach Odessa zu gehen. Es war gefährlich, in Charkow zu bleiben, das Mischa und Vitja den ganzen Sommer über gründlich ausgeplündert hatten. Ein kleiner Zwischenfall, dem unser Held beigewohnt hatte, führte zu der Schlägerei zwischen Mischa und Vitja. Mischa (der später behauptete, daß man im Kreditbüro des großen Kaufhauses erkannt hätte, daß das Photo auf seinem Ausweis nachträglich eingeklebt worden war, vielleicht waren aber bloß seine Nerven überstrapaziert) hatte das Kaufhaus fluchtartig verlassen und dabei sogar Leute umgerannt. Vitja und Eduard waren ihm hinterher gerannt. Mischa aber hatte den im Wohnheim gestohlenen Ausweis mit seinem eigenen Photo darauf in den Händen des Feindes gelassen!
Mischa mußte sofort aus Charkow fliehen. Eduard war ganz beglückt über die Möglichkeit eines unmittelbaren Wechsels in seinem Leben und sagte, er sei noch am gleichen Tag reisefertig. »Nein!« beharrte der verstockte Mischa. »Gib erst deine Arbeit auf, wie es sich gehört. Halte die Kündigungsfrist ein und arbeite noch die zwölf Tage. Wenigstens bei einem von uns müssen die Papiere in Ordnung sein. Auf deinen Arbeitspapieren müssen alle Stempel stimmen!« — Eduard zog eine unzufriedene Schnute. »Hab doch Vertrauen zu einem älteren und erfahreneren Genossen. Tu nie etwas Illegales, solange du die Mittel hast, deine Ziele auf legalem Wege zu erreichen… Ich fahre nach Odessa, warte dort noch etwas und ruhe mich aus, ich werde nicht ›arbeiten‹. In zwölf Tagen kommst du nach. Wenn ich mich eingerichtet habe, schicke ich dir ein Telegramm mit meiner Adresse. Kennst du übrigens einen Typen, der bereit wäre, sofort mit mir abzureisen? Ich werde ihn selbstverständlich bezahlen. Mit unseren Angelegenheiten hat er überhaupt nichts zu tun. Ich brauche einen Leibwächter.«
Oh! Mischa Kopissarow hatte Format! Eduard fand einen Typen, Tolik Lyssenko, einen kräftigen Sportler, der noch am selben Abend mit Mischa nach Odessa abreiste. Eduard kündigte und das Warten begann…
Es vergingen zwölf Tage, der Leiter der Werkstatt versuchte zwei Stunden lang, »den Sklaven« zu überzeugen, seine Kündigung wieder zurückzunehmen, aber er sprach gegen eine Wand, dann beschimpfte er ihn und unterschrieb schließlich seine Abrechnung. Ed bekam sein Geld ausgezahlt, hatte aber noch immer kein Telegramm von Mischa erhalten.
Hat er mir etwa Geschichten erzählt? dachte Eduard traurig. Solche Scherze sollte man nicht machen. Der Sklave sehnte sich nach einem neuen außergewöhnlichen Leben: Es war schon sein Kindertraum, ein großer Verbrecher zu werden, und er schien jetzt so nahe, und nun…
Drei Wochen nach Mischas Abreise klopfte man an die Tür der Familie Sawenko. Da stand Tolik Lyssenko, zitternd und schuldbewußt, auf der Schwelle. »Gehen wir raus, ich muß dir was erzählen, Ed.« Sie gingen auf die Straße und verzogen sich auf ein Brachgelände. Tolik blickte sich ständig mißtrauisch um. Als sie auf einem Stapel angewärmter Ziegel Platz genommen hatten, erzählte er ihm die Geschichte aus Odessa.
Anfangs ging alles sehr gut. Sie hatten ein Bestechungsgeld gezahlt und sich an dem sichersten Ort, den man nur finden konnte, eingenistet, dem Sanatorium des KGB! Sie spielten Tennis, nahmen Sonnenbäder, gingen schwimmen… Eine alte Freundin, Schauspielerin in einer Operettentruppe, hatte Mischa verpfiffen. Zufällig hatte sie ihn in der Deribassowskaja-Straße gesehen, ihn erkannt, angesprochen und ein Rendezvous mit ihm verabredet. Bei der Gelegenheit hatte man ihn geschnappt. Die Schauspielerin wußte offenbar, daß die Kriminalpolizei ihn suchte; die Polizei war im Frühling zu ihr gekommen und hatte sie über Mischa ausgefragt… Oh, die Frauen… Mischa hatte sich bestimmt der Künstlerin gegenüber schuldig gemacht. Gewiß hatte er sie fallengelassen…
Getreu seinem Bild eines Hochstaplers von Format, hatte Mischa (den man nach Donetsk, an den Tatort seiner Verbrechen geschafft hatte, um dort die Angelegenheit aufzuklären und ihn abzuurteilen) für sich und die beiden Kriminalbeamten, die ihn begleiteten, ein Zugabteil gemietet und sich die ganze Fahrt in ihrer Begleitung betrunken. Die Beamten hatten nichts dagegen gehabt, denn das Geld gehörte dem Staat, das heißt also niemandem.
Einen Monat lang lebte Eduard in Angst. Obwohl er Tolik Lyssenko schon seit langem kannte und dessen Erklärungen durchaus glaubwürdig klangen, fragte er sich doch, wieso er nicht mit Mischa zusammen festgenommen worden war. Er konnte nicht ausschließen, daß Tolik Mischa verraten hatte. Jeder verrät jeden, und eine fremde Seele ist unergründlich. Vielleicht hatte Mischa auch zu reden begonnen und sie alle, ihn und Tolik in die Sache hineingezogen. Mischa aber redete nicht und gab nicht einmal Vitja preis. Er schaffte es sogar, seine Charkower Verbrechen vor der Polizei geheimzuhalten. Für seine »Arbeit« verurteilte man ihn zu neun Jahren Zwangsarbeit im Donetsk-Becken. Man findet den Namen von Michail Kopissarow möglicherweise in den kriminologischen Handbüchern der Sowjetunion, er war der erste, der den sowjetischen Staat durch Kreditbetrügereien bestohlen hatte. Und was unseren Helden betrifft, so hatte er sich, wie Sie sehen, ein zweites Mal auf wundersame Weise vor dem Gefängnis bewahrt (das erste Mal war 1962, als seine Mutter ihn gebeten hatte, zum Geburtstag von Tante Katja mitzukommen, und Kostja Bondarenko, Jurka Bembel und Slawka, »der Suworow-Schüler«, die ihn abholen wollten, ihn zu Hause aber nicht antrafen, den Coup deshalb allein unternahmen).
5
Boris Tschurilow hatte für seinen Schützling eine Stelle als Straßenbuchverkäufer in der Buchhandlung Nummer Einundvierzig, einer Filiale des »Poesie«-Ladens, gefunden. Die Direktorin Lilja, eine kleine boshafte Blonde, die von Anna die »Faschistin« genannt wurde, hatte »den Kleinen« mit Vergnügen eingestellt. In ihrem Laden arbeiteten nur »Mädchen«. Lilja, Flora und die »Verhärmte«. Jeden Morgen kam Ed mit der Straßenbahn aus Saltow. Jeden Morgen wurden die Bücher registriert, die er dann mitnahm und auf einem Klapptisch ausbreitete, um sie zu verkaufen. Danach packte er sie zusammen. Anfangs hatte man ihm, um ihn anzulernen, erlaubt, sich vor dem Eingang des Geschäftes Nr. 41 in der Sumskaja-Straße aufzustellen. Später richtete er sich im Eingang des Kinos »Komsomol« oder an anderen ebenso gut besuchten Orten ein. Der Beruf eines Straßenbuchverkäufers gleicht dem eines Bauchladenhändlers oder eines von Haus zu Haus ziehenden Kringelverkäufers. Der fliegende Verkäufer verdient nur ein mickriges Gehalt, aber er arbeitet mit Umsatzbeteiligung. Als Eduard Sawenko in diesen Beruf eintrat, war der frühere Eisenbahnarbeiter Igor Jossifowitsch Kowaltschuk der beste Verkäufer von Charkow; er hatte schon für alle Buchhandlungen in der Stadt gearbeitet. Nie konnte Eduard Sawenko, weder am Anfang noch am Ende seiner Karriere, mit den Umsätzen von Igor Jossifowitsch wetthalten, den man immer einstellte, um das Plansoll zu retten. Man lockte ihn, man bestach ihn. Igor Jossifowitsch konnte egal welches Buch verkaufen. Er schlug seine paar Tische zumeist auf der Mitte des Tewelew-Platzes auf, und wie in einem orientalischen Basar riß er ein Buch gegen den Himmel und lobte mit gebrochener Stimme sein Produkt. »Hier ist die Geschichte eines schrecklichen Verbrechens aus dem Altertum! Der Kampf der weißen Magie gegen die schwarze Magie!« Der Passant hatte Mühe, einem solchen Angebot zu widerstehen. Immer sammelten sich die Leute um die Auslagen von Igor Jossifowitsch. Das abscheuliche Verbrechen aus dem Altertum war natürlich bloß ein Ladenhüter, der langweiligste Band aus der Serie »Schätze der Weltliteratur« in der Ausgabe des Akademie-Verlages.
Ed, wie ihn Anna nannte, bis er den Namen Limonow annahm, schämte sich. Verlegen trat er hinter seinem Büchertisch von einem Fuß auf den anderen. Manchmal hatte er auch zwei Tische. Meistens schwieg er oder lächelte schüchtern. Trotz des gefährlichen Rasiermessers, das häufig in der Brusttasche des Straßenbuchverkäufers zu finden ist, war der Verkäufer der Buchhandlung Nummer Einundvierzig kein schlimmer Junge. Von Zeit zu Zeit schickte Lilja ihm zur Verstärkung die »Verhärmte«, ein mageres Wesen weiblichen Geschlechtes, die immer einen alten abgeschabten Pelz trug. Die Nase der »Verhärmten« war lang, tropfte dauernd, hatte eine blaue Spitze.
Eduard Sawenko verdiente wenig. Um es genau zu sagen, fast gar nichts. Und dennoch vollzog sich im Oktober, November und Dezember mit beeindruckender Geschwindigkeit die Verwandlung des jungen Arbeiters aus einem Halbkriminellen in einen Anderen, man weiß nicht so recht in wen, zumindest wechselte er aber in diesen kalten Monaten in eine andere soziale Klasse über. Der Leser soll sich die Schwierigkeiten dieses Prozesses einmal vor Augen halten! Ein solcher Wandel erfordert manchmal die Anstrengungen mehrerer Generationen.
Abends beeilte sich unser Verkäufer, die Bücher zusammenzupacken und die Pakete zusammen mit den Tischen zurück in die Buchhandlung Nummer Einundvierzig zu bringen, so wie die Biene zum Stock zurückfliegt, der Vogel zum Nest, das Flugzeug zu seinem Flugzeugträger. Der Verkäufer beeilte sich, die Zukunft wartete auf ihn, verborgen in den Alleen des Taras-Schewtschenko-Parkes, im »Automaten«, in der Sumskaja-Straße, in den Zimmern von Charkow. Die Zukunft verbarg sich im Dunkel der nächtlichen Stadt, sie hüllte sich in etwas altmodische, symbolistische und surrealistische Kleider. Obschon ziemlich provinziell, konnte Charkow, die ehemalige Hauptstadt der Ukraine, beim Spiel der Kultur mithalten.
Um ihn herum gab es viele Leute, mindestens hundert. Interessante und neue Leute, die niemandem sonst ähnlich sahen. Im kleinen Hinterzimmer der Buchhandlung Nummer Einundvierzig waren immer irgendwelche Leute, die gierig Manuskripte, meistens Gedichte, lasen. Der Physiker Lew mit seinem glattrasierten Schädel hatte gerade von einer Dienstreise nach Leningrad fünf oder sechs Durchschläge des Gedichtes »Prozession« von Brodskij mitgebracht. Dieses Jugendwerk, Marina Zwetajewa nachgeahmt und von zweifelhaftem künstlerischen Wert, entsprach jenem gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungsstand, den Charkow und die Mehrzahl der »Dekadenzler« aus dem Dreieck um die Buchhandlung Nummer Einundvierzig, den »Poesie«-Laden und den »Automaten« erreicht hatten (und über den sie wohl kaum hinausgelangen werden). Aus diesem Grund war dieses Gedicht außergewöhnlich beliebt. Von morgens bis abends standen die Leute Schlange, um Brodskij zu lesen. Einer der Leser war der Dichter Motritsch.
Im Rückblick, und wenn man die Elle der Zeit anlegt, um den Wert des Dichters Motritsch zu messen, muß man zugeben, daß er weder ein Genie war, wie seine Bewunderer 1964 annahmen, geschweige denn ein irgendwie bedeutender Dichter. Wenn er auch nur einen Funken Originalität besaß, so fiel der nicht auf. Wie dem auch sei, Wladimir Motritsch, früherer Vorarbeiter in der Fabrik »Hammer und Sichel« — die sich uns so von neuem in gute Erinnerung bringt — (später erinnerte sich Sawenko, daß Boris Tschurilow ihn zum Walzwerk begleitet hatte, wo damals, 1963, »der echte Dichter Motritsch« noch arbeitete) war ohne jeden Zweifel ein DICHTER. Ein wirklicher DICHTER: ein Dichter, das sind nicht bloß Gedichte, das ist auch ein Geist, eine Aura, ein starkes Feld voller Emotionen, welche eine Persönlichkeit ausstrahlt. Und Motritsch strahlte aus, oh ja…
Eines Tages… Ed hatte seine Bücher zurückgebracht, die Direktorin Lilja hatte die Wochenabrechnung in das große Buch übertragen und die Einnahmen des Tages hinzugefügt… Diese Operation sollte eigentlich täglich geschehen, aber der Verkäufer und die Direktorin nahmen sie aus Überlastung oder aus Faulheit nur einmal wöchentlich vor… Oh Gott, es fehlten neunzehn Rubel. Schlecht gelaunt verließ Eduard den Keller und entschied sich, die Sumskaja-Straße hinunterzugehen bis zur Haltestelle der Straßenbahn, die ihn ins langweilige Saltow zurückbringen sollte… Als er jedoch auf der letzten Stufe angekommen war, sah sich der Verkäufer Stirn an Stirn Milka, Vera und dem Dichter Motritsch gegenüber, die ihn nicht vorbeiließen. Es schneite, der lange und magere Körper des Dichters war mit dem berühmten schwarzen Mantel mit dem hohen Kragen bekleidet. Die romantischen Symbolisten von Charkow hatten den neuen Mantel von Motritsch schon »den fürstlichen Pelz« getauft. Wir haben allen Grund anzunehmen, daß Motritsch selbst seinen Mantel als fürstlichen Pelz ansah. Jedenfalls deklamierte er oft mit Behagen das Gedicht von Mandelstam, das sich darauf bezog.
»Ed!« sprach Motritsch den Verkäufer an. Der freute sich insgeheim. Ein düsteres Lächeln erhellte das kroatische Gesicht des Dichters mit den hohlen dunklen Wangen, der langen Geiernase und den Nasenlöchern, aus denen schwarze borstige Haare wuchsen.
»Du bist doch Ed? Und arbeitest hier bei Lilja?«
»Ja«, gab Ed zu. »Der bin ich.«
»Wunderbar«, freute sich der Dichter, und die Mädchen brachen in Lachen aus.
»Was machst du jetzt, Ed, hast du was vor?«
»Ich gehe nach Hause«, antwortete Ed traurig. »Ich habe nichts vor.«
Er arbeitete schon eine Woche »bei Lilja«, und jeden Abend hatte er voller Neid beobachtet, wie sich im Laden oder in der Umgebung Gruppen bildeten und vergnügt im geheimnisvollen nächtlichen Charkow verschwanden. Ed, der Straßenbuchverkäufer, fuhr normalerweise nach Hause. Eines Tages hatte Boris Tschurilow, der zur ersten Schicht gehörte, Ed zum »Automaten« mitgenommen, den man auch »das MG« nannte. In dem sehr grellen Licht des abscheulich modernen Selbstbedienungscafés tranken Snobs, den Mantel bis zum Hals zugeknöpft und in abgewetzten Hosen, aus winzigen Tassen Kaffee. Einer hatte sogar einen Stockschirm.
»Willst du mit uns trinken gehen?« fragte Motritsch; und er erklärte auch, wieso: »Das ist der erste Schnee heute.«
»Einverstanden«, stimmte der Buchverkäufer zu und fiel vor Freude fast in Ohnmacht. Motritsch war der erste lebende Dichter, den er in seinem Leben traf. Und konnte man die Einladung durch den ersten lebenden Dichter, den man trifft, zu Ehren des Schnees zu trinken, überhaupt abschlagen? Milka nahm den Buchverkäufer beim Arm, und sie liefen alle vier die Sumskaja-Straße hoch; es schneite und sie lachten die ganze Zeit ohne Grund…
Im »Automaten« tranken sie einen Kaffee und einen Porto. Der nun (er wußte nicht wieso) der Ehre, in das Gefolge von Motritsch aufgenommen zu werden, würdige Verkäufer wurde einer großen Menge von Snobs und vielen absichtlich schlecht gekleideten und traurigen jungen Leuten vorgestellt. »Die Boheme«, erklärte Motritsch, der den Ausdruck des Schreckens auf dem Gesicht des früheren Gießereiarbeiters wahrgenommen hatte, als ein junger Mann, blaß wie ein Chicoree, der von seinem Militärmantel alle Abzeichen und Schulterklappen entfernt hatte, und dessen ausgelatschte schwarze Schuhe eine nasse Spur hinter sich ließen (seine Stiefel hatten sich offensichtlich mit Wasser vollgesogen), sich von ihnen entfernte, nachdem er einige Worte mit dem Meister Motritsch gewechselt hatte.
»Der surrealistische Maler Kutschukow«, erklärte Motritsch. »Sein Vater ist Oberst in der Miliz…« Als er sah, daß »Oberst in der Miliz« überhaupt keinen Eindruck auf den Buchverkäufer machte, fügte er hinzu: »Aber das ist nicht das Erstaunlichste, Ed. Jurka ist Ostjake: Er ist der letzte Repräsentant dieses ausgestorbenen sibirischen Stammes. Er behauptet, daß Khan Kutschum sein Urgroßvater war… Du weißt, der von dem berühmten Jermak Timofeewitsch besiegt wurde…«
Dieser Typ lügt, dachte der ungläubige Buchverkäufer, aber er teilte Motritsch seine Zweifel nicht mit, er genierte sich. Die anderen jungen Leute, die ihm Motritsch und die jungen Frauen an diesem Abend vorstellten, hatten genauso aufsehenerregende Biographien und Abstammungen vorzuweisen. Sie verbrachten eine Stunde im »Automaten-MG«, während der Motritsch drei starke schwarze Kaffees trank, die ihm von der »Tante« Tschura zubereitet wurden, dann kauften sie im »Gastronom« ein paar Flaschen Porto, überquerten die Sumskaja-Straße und betraten den schon schneeweißen Taras-Schewtschenko-Park. Die Gruppe vergrößerte sich um Tolik Melechow mit seinem runden Gesicht, der an der philosophischen Fakultät der Universität von Charkow studierte und nachts als Heizer in einer großen Wohnanlage arbeitete. Nachdem sie sich auf eine Bank gesetzt hatten (von der Vera zuvor eifrig, lustvoll und etwas aufdringlich den Schnee entfernt hatte, sie trug wollene Fäustlinge), begannen sie Motritsch zuzuhören, der vor der Bank im Schnee hin- und herstapfte. Den fürstlichen Pelz hatte der Dichter aufgeknöpft und hielt in der Hand eine Flasche Porto, aus der er von Zeit zu Zeit einen tiefen Schluck nahm. Motritsch las Gedichte. Mit der Freude, mit der ein Verhungerter sich auf das Fleisch stürzt. Er konnte kaum das Schmatzen und Gluckern vermeiden. Die Gedichte kamen sehr materiell, sehr fühlbar aus seinem kroatischen Hals, das war keine elegante, leichte, immaterielle Literatur. Er las Mandelstam und »Der Rattenfänger« von Brodskij, er las SEINE EIGENEN GEDICHTE…
Und Jesus selbst wie ein Pferdedieb
In einem Hemd aus farbigem Kattun…
Das tiefe Flüstern (und ganz besonders das s in Jesus beunruhigte wie das Geräusch des Bohrers beim Zahnarzt) des ersten lebenden Dichters, dem der junge Sawenko begegnete, ließ dem Buchverkäufer die Haare zu Berge stehen. Ohne sich zu regen, hypnotisiert, mit offenem Mund, schauten die Freundinnen im Pelzmantel, Milka und Vera, zu Motritsch hoch und schmiegten sich eine an die andere. Vielleicht hörten sie das Gedicht zum hundertsten Mal…
»Wolodja, liest du für uns ›Der kleine Mensch aus Holz‹?« fragte der Student Melechow.
Wolodja ließ sich nicht bitten. Er trat dichter an den Buchverkäufer heran, wie an einen ganz neuen Zuhörer, und sang die Geschichte vom kleinen Menschen aus Holz. Aus Holz…
Er lebte auf einem Speicher
Hundert Spindelstufen
Und bei jedem Unglück
fand der kleine Mensch…
Ed verstand, daß der kleine Mensch aus Holz eine boshafte Puppe liebte, die ihn betrog, das kleine Luder.
Ketten aus farbigem Glas
Die Seele in diesen Perlen angefacht
Schlich sich die Puppe heimlich zum Rendezvous
Mit einem rosa Bübchen
Und von der Puppe ohne Herz
Läuft er fort und zu sich hinauf
Der kleine Mensch aus Holz
Der Mensch aus Holz…
Trotz der auf ihm lastenden Vergangenheit eines kriminellen Herumtreibers, trotz der Fabriken, in denen er gearbeitet hatte, trotz seiner langen und nicht ganz unschuldigen Reisen auf der Krim, durch den Kaukasus und die asiatischen Republiken, kannte Ed noch nicht die Natur der Puppen, er wußte nicht, daß es in der Ordnung der Dinge lag, daß die Welt so eingerichtet ist, daß die Puppen insgeheim zu Rendezvous mit rosa Bübchen gehen. Der Kroate, von dem man nicht wußte, welcher Wind seine Familie nach Charkow gebracht hatte, überzeugte ihn davon und griff damit seiner eigenen Erfahrung eines Buchverkäufers voraus… Und Eduard Sawenko glaubte, daß solcherart die Natur der Puppen sei… Das ist die Macht der Kunst. In einem Augenblick verstand Ed Sawenko, als er noch nicht Limonow war, was ihn erwartete. Er verstand und vergaß es wieder.
Bei der Betrachtung der düsteren Züge des Dichters (die kroatischen Borsten bohrten sich unerbittlich ihren Weg durch die Haut) gab sich Ed das Versprechen, ein Dichter zu werden wie Motritsch. »Was auch immer passieren wird«, murmelte er entschlossen. Auf daß zwei junge Frauen im Pelz, eng aneinander geschmiegt, ihn ununterbrochen ansehen. Auf daß das runde Gesicht des Wissenschaftlers Melechow voller Zustimmung und Verzückung grinst und seine Lippen sich im Rhythmus der Verse wortlos mitbewegen… Seine Berufswahl war getroffen…
Melechow blieb noch bis um drei Uhr morgens mit dem Buchverkäufer an der Straßenbahnhaltestelle stehen und las ihm Gedichte vor. In dieser schneereichen Nacht des Jahres 1964 hörte Ed zum ersten Mal die Namen Chlebnikow und Chodasewitsch. Den Namen von Andrej Belyi. Und vielleicht noch ein Dutzend anderer genauso berühmter Namen. Die letzte Straßenbahn war längst schon nach Saltow abgefahren; der Sohn einer Hausmeisterin, Melechow, setzte die Erziehung des Neulings fort und erstaunte ihn durch die Ausmaße der Welt der Kultur, durch die hohe Weite ihres leuchtenden Tempels. Und der Sohn des kleinen sowjetischen Offiziers vernahm in dieser Nacht zum ersten Mal die weisen Worte von Wassilij Wassilewitsch Rosanow. Er hörte von seltsamen, komischen, kranken, talentierten und wahnsinnigen Dichtern reden, er hörte von den besten Russen, die seit fünfzig Jahren von den Mittelmäßigen in unerreichbare Finsternis verbannt worden waren.
Das Schicksal von Melechow war tragisch. Aber es ist wohl kaum vernünftig, den Jahren vorauszueilen und jetzt schon davon zu berichten. Der Buchverkäufer ging zu Fuß nach Hause. Er brauchte fast zwei Stunden, um durch die weißen Straßen von Charkow die Siedlung Saltow zu erreichen und die Zelle wiederzufinden, die er mit seinen Eltern teilte, um sich dort auf dem Sofa auszustrecken, das ihm als Bett diente. Aber es gelang ihm nicht einzuschlafen.
6
Am anderen Tag kam Melechow in das schmutzige Foyer des Kinos »Komsomol«, wo der Buchverkäufer seine Tische aufgestellt hatte; er sah in seinem modischen Synthetikregenmantel etwas plump aus — seine runde und etwas schlichte Physiognomie paßte überhaupt nicht zu diesem futuristischen Erzeugnis einer Fabrik aus Riga, das er trug. Er holte aus einer Tasche, die er bei sich trug, ein vergilbtes Buch, das in schon zerfetztes Papier eingewickelt war. »Hier«, sagte Melechow. »Damit kannst du anfangen. Das wird die Grundlagen legen, die Fundamente. Ohne dieses Buch wirst du nichts von der heutigen Welt verstehen. Wenn es irgend etwas gibt, was du nicht verstehst, dann erschrick nicht. Du mußt nicht alles auf Anhieb verstehen. Wenn du willst, dann erkläre ich dir später, was du nicht verstanden hast. Geh sorgfältig mit dem Buch um!« Und nachdem er dem Buchverkäufer die Adresse des Heizkraftwerks gegeben hatte, in dem er arbeitete, ging Melechow zum Dienst. In der Hand hielt er die Tasche, die mit Büchern und Manuskripten vollgestopft war. Ed öffnete das Buch. Einführung in die Psychoanalyse, S. Freud, Vorwort von Professor Jermakow.
»Tolik Melechow ist ein guter Bursche. Gewinne ihn zum Freund«, meinte die Verhärmte, die neben ihm stand. Es war Monatsende, das Geschäft hatte Mühe, den Plan zu erfüllen; also hatte man ihm die Verhärmte geschickt, um ihm zu helfen. »Und wieviel er über Bücher weiß!« — die Verhärmte klapperte vor Begeisterung mit ihren ständig feuchten Augenlidern.— »O-o-oh! Tolik hat eine Bibliothek mit vielen raren Büchern. Obwohl er sehr arm ist. Er hat sie durch Tausch erstanden, aus Liebe eines nach dem anderen gesammelt. Was für ein Typ!« — die Verhärmte schnalzte sogar mit der Zunge. »Welch ein Glück für Anja! Einen solchen Mann zu finden!« Die Verhärmte wollte selbst unheimlich gern heiraten, und obschon sie erst zwanzig war, beklagte sie ständig ihr Schicksal, das noch nicht von den Ketten der Ehe befestigt war. Mit fester Hand war sie indes dabei, einen gewissen Jurij in Ehe und Vaterschaft zu führen.
»Wer ist Anja«, interessierte sich der Buchverkäufer und fragte sich, ob das nicht diese jüdische Dame mit den Pfennigabsätzen und den ebenso scharfen Augen war, die ihm Boris Tschurilow im »Poesie«-Laden vorgestellt hatte.
»Anja Wolkowa, die Tochter eines sehr großen Mannes«, sagte die Verhärmte mit leiser und wissender Stimme, als wenn sie einem Freund ein schreckliches Geheimnis anvertraute. Ihr leichenblasses Gesicht, von der Farbe des Fleisches eines seit ein paar Tagen toten Huhnes, erhellte eine fast religiöse Verzückung. »Anja Wolkowa ist die Tochter von Wolkow selbst.« Und die Verhärmte warf einen triumphierenden Blick auf ihren Kollegen.
»Und wer ist Wolkow selbst?« fragte der frühere Gießereiarbeiter und begann zu lachen.
»Du scherzt? Du weißt nicht, wer Wolkow ist?« Die Verhärmte sprang plötzlich hinter ihrem Büchertisch hervor und packte einen flegelhaft aussehenden Jugendlichen am Arm. Der Buchverkäufer Ed sprang auch auf, und zu zweit zogen sie aus dem weiten Mantel des kleinen Diebs ein gestohlenes Buch. Die Verhärmte gab dem unglücklichen Dieb eine Ohrfeige und seufzte. »Wolkow«, sagte sie, »ist der Direktor des Fleisch-und-Fisch-Trusts von Charkow!«
»Fleisch-und-Fisch-Trust von Charkow« ließ den Buchverkäufer kalt wie Marmor. Parteisekretär, KGB-General, es gab wenig Titel, die ihn beeindrucken konnten. Und dann Direktor eines Fleisch-und-Fisch-Trusts!
»Ist sie wenigstens schön?«
»Du hast sie doch gesehen! Sie kommt oft vorbei. Gestern noch war sie im Geschäft. Sie trägt eine Brille. Groß. Eine randlose Brille…«
Ed erinnerte sich an das Mädchen. Eine Studentin. Eine Brille und bemerkenswert rosa Wangen. Nichts Besonderes an ihr, wenn nicht die Sicherheit ihres Verhaltens… Übrigens war Melechow trotz seiner Belesenheit ein Bauer. Innerhalb eines Jahres würde der Buchverkäufer sich selbst einen »Intellektuellen der ersten Generation« nennen. An diesem Tag jedoch empfand er sich noch als »Bauer«.
Seine Gleichgültigkeit gegenüber den Worten »Fleisch-und-Fisch-Trust« und »Tochter des Direktors« mußte sich auf seinem Gesicht gespiegelt haben, denn die Verhärmte hielt es für notwendig, Anja Wolkowa noch etwas zu untermauern. »Anja ist sehr verwöhnt. Sie ist ein junges Mädchen mit Charakter. Sie liebt Melechow, aber sie quält ihn nicht gerade wenig. Weißt du, Anja studiert auch an der philosophischen Fakultät. Da haben sie sich kennengelernt.«
Der Buchverkäufer warf einen Blick auf seine Uhr und begann, die Bücher zu stapeln. Die Verhärmte sagte nichts und beteiligte sich am Verpacken der Ware. Es war viertel vor acht. Es war noch früh. Lilja verlangte immer von ihnen, bis viertel nach acht im Foyer des Kinos stehen zu bleiben, bis die letzten Eintrittskarten für die 8-Uhr-Vorstellung verkauft waren. Die Direktorin Lilja behauptete, daß gerade die Bücherliebhaber in diese Vorstellung gingen. Der Buchverkäufer wußte, daß außer einer Bande von Rowdies, die das Foyer des Kinos »Komsomol« zu ihrem Hauptquartier erkoren hatten, und unscheinbaren Pärchen, die sich an den glühenden Heizkörpern trafen, es nach acht Uhr nicht einmal mehr eine Katze im Foyer gab. Und dort sollte man Bücher verkaufen! Draußen gab es einen Schneesturm. Die Leute waren schon längst von der Arbeit nach Hause gegangen.
»Anja und Tolik wollen heiraten. Die Mutter von Anja ist einverstanden, aber ihr Vater weiß noch nichts davon. Sie haben sogar Angst, die Existenz von Tolik zu erwähnen. Bestimmt ist er nicht einverstanden. Melechow hat keinen Vater, und seine Mutter ist Hausmeisterin. Der Vater möchte seine einzige Tochter an jemanden aus dem gleichen Milieu verheiraten…«
Wie immer plapperte die Verhärmte vor sich hin, während sie die Bücher zu festen und hohen Türmen stapelte und der Buchverkäufer Ed sie mit Schnüren umwickelte.
»Sie reproduzieren die Kasten wie in der bürgerlichen Gesellschaft«, murmelte der Buchverkäufer. Und wer ist eigentlich diese Anja… Sie ist wie Melechow. Seine Mutter ist Hausmeisterin! Wenn du ihr die Brille abnimmst, dann sieht Anja auch aus wie eine Hausmeistertochter!
»Und dein Vater? Was macht er?« fragte ihn die Verhärmte.
»Er ist Hauptmann«, gestand Ed. In den letzten Jahren war ihm der Rang seines Vaters gleichgültig geworden. Früher schämte er sich seines Hauptmann-Vaters. Manchmal hatte er sogar gelogen und gesagt, sein Vater wäre Oberst. Warum hatte er gelogen? Vielleicht weil ihm, Ed, die Schulterklappen eines Oberst einen besseren gesellschaftlichen Anstrich verliehen.
»Hauptmann wovon?«
»Was weiß ich! Ich habe in den letzten Jahren so wenig mit meinen Eltern zu tun gehabt, daß ich nicht weiß, wo er jetzt arbeitet.«
Das war die Wahrheit. Hauptmann Sawenko hatte für das NKWD-MWD1 gearbeitet. Wo er jetzt arbeitete, wußte sein Sohn nicht.
*
»Kinder! Wir kommen euch abholen!« Der Dichter Wladimir Motritsch höchstselbst schüttelte den Schnee von seinem fürstlichen Pelz, nachdem er in das Foyer des Kinos getreten war. Ein großer junger Mann folgte ihm, den Rücken ein wenig gebeugt, schwarzgekleidet, ein stolzes Gesicht mit dem Profil eines Elches. Der junge Mann warf einen spöttischen und herablassenden Blick auf die Bücher, die Verhärmte und Ed. Die Rowdies, die bis jetzt in aller Stille Schimpfwörter in die Gipswand neben den glühenden Heizkörpern geritzt hatten, begrüßten Motritsch. Er antwortete ihnen mit einer gewundenen und fürstlichen Handbewegung. Es versteht sich von selbst, daß die Rowdies nicht die Gedichte von Motritsch lasen, aber Motritsch wohnte in der Rymarskaja-Straße, einer Parallelstraße der Sumskaja-Straße, gleich hinter dem Kino. Er gehörte also zu dem Viertel, und die Rowdies in der Ecke kannten ihn daher.
»Ed, ich stelle dir den Maler Mischa Bassow vor.« Motritsch trat sehr zeremoniell zur Seite, um es so dem Buchverkäufer Ed zu ermöglichen, den jungen Mann mit dem Elchgesicht zu mustern. An der Art, wie er zur Seite trat, an der ganzen Aufmerksamkeit, die er an den Tag legte, konnte man erraten, daß der junge Mann mit dem Elchgesicht ein naher Freund von ihm und daß Motritsch stolz auf ihn war. Ohne weitere Umstände musterte der junge Mann den Buchverkäufer von oben bis unten. Arrogant aber konnte man seinen. Blick nicht nennen. Es lag eine ruhige Überheblichkeit in diesem Blick. Der Buchverkäufer bemerkte, daß der Maler gewissen Portraits aus der Zeit der Jahrhundertwende glich, er sah vielleicht aus wie Alexander Blok, der einzige Dichter, dessen Gedichte der Buchverkäufer, außer den Gedichten von Jessenin, damals kannte. Als sie noch zusammen in der Gießerei arbeiteten, hatte Boris Tschurilow ihm zum Geburtstag die neun blauen Bände von Blok geschenkt. Wie ein Pygmalion führte Boris unseren jungen Mann durch das Leben.
»Sind Sie nicht ein Freund von Tschurilow?« fragte Bassow, der junge Mann mit dem Elchgesicht, anstelle einer Begrüßung. »Und wenn ich mich richtig erinnere, Ed, schreiben Sie nicht auch Gedichte?«
»Ich habe welche geschrieben«, antwortete der Buchverkäufer schüchtern.
»Und Sie haben damit aufgehört?«
Der Buchverkäufer nickte.
»Da haben Sie recht getan«, lobte ihn gleichgültig der Mund Bloks. »Alle Welt schreibt heute Gedichte… Aber Motritsch bleibt der einzige«, schloß er wie ein gewöhnlicher Schmeichler. Und er warf einen Blick auf seinen Dichterfreund, der gerade seine Pelzmütze abnahm und den Schnee davon abschüttelte.
Der Fußboden in der Kinovorhalle war mit einem schmierigen Matsch bedeckt, den hunderte von Füßen von draußen hereingetragen hatten. Die mageren Beine von Motritsch endeten in kurzen tschechischen Stiefeln, die noch magereren Beine des jungen Mischa Bassow waren schlammbeschmutzt und verschwanden in einer Art Fußgestell, das aus zwei groben und selbstgemachten Stiefeln bestand und das durch eine Vielzahl von Löchern mit einem langen Schnürsenkel zusammengeknotet war; die Beine staken im Schlamm. Als er diese Stiefel sah, verzieh der Buchverkäufer dem Maler seine verächtliche Ungläubigkeit, die er bei der Vorstellung an den Tag gelegt hatte, jemand anders als Motritsch könne gute Gedichte schreiben. Allem Anschein nach war er arm. Arm und intelligent. Arm und intelligent — diese Verbindung achtete der Buchverkäufer. Ein Dieb oder ein Bandit darf nicht arm sein, fand der Buchverkäufer. Aber ein Mann der Kunst — das ist etwas anderes. Ein klassischer Mann der Kunst, ein Dichter, ein Maler muß arm sein. So muß es sein. Wie bei van Gogh, dessen bemerkenswerte Briefe eben in russischer Übersetzung herausgekommen und zusammen mit den Reproduktionen seiner Werke in einem dicken und schweren Band abgedruckt waren, der aussah wie ein Familienalbum. Der Buchverkäufer hatte das Buch bei Lilja an sich genommen und es von der ersten bis zur letzten Seite (einschließlich des Einbandes) gelesen. Arm wie Jessenin, dem es immer an Geld gefehlt hatte…
Motritsch klappte einen Tisch zusammen und nahm ihn unter den Arm, unter den anderen nahm er ein Bücherpaket. Ed nahm drei Pakete, Mischa Bassow einen Tisch und ein Paket, während die Verhärmte, glücklich und unbeschwert, bald ihnen hinterherlief, bald ihnen voraus die Sumskaja-Straße durch den tiefen Schnee hinauftrottete, der schon, matschig braun, von tausenden Passanten zertrampelt worden war.
7
Hier erscheint es nun angebracht, einige grundlegende Informationen über die Geschichte und die Topographie von Charkow nachzutragen, damit der Leser den Abenteuern unseres Helden in Raum und Zeit besser folgen kann.
»Die große Stadt des Südens«, wie Bunin sie nannte, liegt in Europa, ganz im Norden der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik, etwa hundert Kilometer von der Grenze zur russischen SSR entfernt. Sie wurde Ende des sechzehnten, Anfang des siebzehnten Jahrhunderts von verwegenen Kosaken gegründet, die zu der Zeit das ganze riesige Gebiet zwischen dem fünfzigsten Breitengrad (auf dem genau der dicke Punkt der Stadt liegt, wenn Sie auf die Karte sehen) und dem warmen Schwarzen Meer mit Unheil überzogen.
Nach der Oktoberrevolution spielte die Stadt bis 1928 die Rolle der Hauptstadt der Ukraine. Während dieser zehn Jahre hatte man Zeit genug, einige der häßlichen Gebäude zu errichten, die dort nie gebaut worden wären, wenn Charkow nicht die Hauptstadt gewesen wäre. Im November 1930 fand dort der Internationale Kongreß der proletarischen Schriftsteller statt, an dem Romain Rolland, Barbusse und Louis Aragon teilnahmen. In Charkow wurde Tatlin geboren, der berühmte Konstrukteur des Projektes eines Turmes für die Internationale, und es war die Geburtsstadt von Vvedenskij, des berühmten Dichters der Oberiu-Gruppe2, sowie schließlich des weniger bedeutenden Politikers Kossygin. Aber der Stolz und der Ruhm von Charkow gelten den zahlreichen Fabriken, die man in seiner Umgebung errichtet hat. Charkow ist ein riesiges industrielles Zentrum, vergleichbar etwa Detroit in den USA.
Die Sumskaja-Straße ist die wichtigste Straße der Stadt. Nicht, weil sie besonders lang oder breit oder modisch wäre, aber diese frühere Landstraße, die zu der anderen ukrainischen Stadt Sumy führt, verdankt ihre Beliebtheit der Tatsache, daß sie zentral liegt, daß sie mitten durch das Herz der alten Stadt führt und daß an ihr die bekanntesten Restaurants, Kinos und Verwaltungsgebäude der Stadt hegen. Die Sumskaja-Straße beginnt am Tewelew-Platz, führt den Berg hoch und endet am Dserschinskij-Platz.
An eben diesem Tewelew-Platz Nummer 19 wohnt Anna Moissejewna Rubinstein mit ihrer Mutter Zilja, und dort hat sich zu Beginn des Jahres 1965 unser Held eingenistet, dieser kleine Dreckskerl Eduard Sawenko. Am Tewelew-Platz bemerken wir — man kann diese Aussicht auch aus den Fenstern der Familie Rubinstein genießen — das Gebäude der alten Adelsversammlung, die Ecke der Sumskaja-Straße und das dort befindliche Restaurant »Theater« sowie das Gebäude des Institutes für Kältetechnik.
Auf dem Dserschinskij-Platz erhebt sich das kasernengelbe Gebäude des Gebietsparteikomitees mit seinen zahllosen Säulen und Stockwerken. Der größte Platz Europas versammelt in seinem Umkreis einige nicht weniger großartige, aber weniger mächtige architektonische Ensembles: Das Hotel »Charkow« erinnert an die Stufenpyramiden der Azteken, die Universität ist eine verkleinerte Kopie der Universität von Moskau, und dann gibt es noch das berühmte und erstaunliche GOSPROM, das Amt für Staatsindustrie, ein konstruktivistisches Gebäude, das einem Gefängnis ähnelt, ein massiger und häßlicher Bau aus Glas und Beton.
In erster Linie spielt sich das Leben unseres Helden und seiner Freunde zwischen dem Tewelew-Platz und dem Dserschinskij-Platz ab.
Zwischen diesen beiden Plätzen befinden sich in der Sumskaja-Straße die Buchhandlung Nummer Einundvierzig, das Theaterinstitut, dessen niedliche Schönheiten zwischen den Stunden mal kurz auf die Straße herunterkommen, und der berühmte »Spiegelbrunnen«, der nichts Außergewöhnliches darstellt — er besteht bloß aus einem Weiher und einem Wasserfall —, aber auf Dutzenden von Postkarten und in jedem Führer von Charkow verewigt ist. (In den Archiven von Raisa Fjedorowna Sawenko, der Mutter unseres Helden, findet sich ein Photo von Eduard im Alter von zehn Jahren, auf dem er, ohne Kopfbedeckung, mit einem Gürtel über der Weste und in kurzen Hosen, neben dem »Spiegelbrunnen« steht.)
Genau hinter dem »Spiegelbrunnen« und dem Theaterinstitut befindet sich im Erdgeschoß eines großen Gebäudes der berühmte »Automat«, ein Café, das in Charkow die Rolle der »Rotonde«, der »Closerie des Lilas« oder des Café »Flore« spielt. Um es genauer zu sagen, die Rolle all dieser Cafés zusammen. (Hier hat der Autor eine interessante Idee: ist die Explosion des kulturellen Lebens in Charkow, in jenen Jahren der Charkower Kulturrevolution, etwa der Eröffnung des »Automaten« zu verdanken?) Einige Häuser vom »Automaten« entfernt, auf der anderen Seite der Sumskaja-Straße, genau gegenüber dem Denkmal, das man im Park zu Ehren des großen Kobsa-Spielers Taras Schewtschenko errichtet hat, befindet sich, für die Geschichte von Charkow in jenen Jahren sehr wichtig, der »Gastronom«, das zentrale Lebensmittelgeschäft. Dort kaufen die Helden dieses Buches Wein und Wodka. Hinter dem »Gastronom«, die Sumskaja-Straße etwas weiter oben, liegt das zweigeschossige Gebäude, in dem die Redaktionen der Zeitungen »Lenins Nachfolge« und »Sozialistisches Charkow« residieren.
Der Taras-Schewtschenko-Park beginnt genau gegenüber dem Eingang zum »Automaten«, wenn der Passant die Sumskaja-Straße vom Tewelew-Platz aus hochgeht. Der Park, einige Quadratkilometer von Bäumen und Büschen, die sich bis zum Campus der Universität erstrecken, beherbergt den zoologischen Garten (in dem Genka, Ed und Anna sich jetzt gerade befinden), ein Freilichtkino, einige öffentliche Toiletten-Bunker (mit herrlichen Wandmalereien) und das Restaurant von Genkas Vater, das »Kristall«. Dort, wo der Park an das Pflaster des Dserschinskij-Platzes grenzt, hat man durch das Gebüsch einen schrägen Blick auf das Haus der Pioniere, wie es sich sklavisch unter das große Gebäude des Gebietsparteikomitees duckt.
In den tiefen Schluchten, die den Park durchschneiden, spielen die Charkower um hohe Summen »Préference« und »Chemin de fer«. Wie in allen Parks, die etwas auf sich halten, gibt es im Taras-Schewtschenko-Park einen zentralen Brunnen, neben dem jeden Sonntag eine Militärkapelle unter der Leitung eines armenischen Dirigenten Militärmärsche spielt. Der Schnurrbart des Dirigenten ist so dicht wie die Borsten eines neuen Besens und in der ganzen Stadt bekannt.
Parallel zur Sumskaja-Straße verläuft, wie wir bereits bemerkten, die Rymarskaja-Straße. Sie beginnt gleich neben Anna Rubinsteins Haustür. Weiter unten, genau gegenüber von Annas Hauseingang, erstreckt sich der berühmte Bursatskij-Abhang. Davor, auf halbem Weg zum größten Markt der Stadt, der weiter unten liegt, dem Mariä-Verkündigungs-Markt, sehen wir das Gebäude des früheren Priesterseminars, heute beherbergt es das Institut für Bibliothekswissenschaft. Der Schriftsteller Pomjalowskij hat es in seinem im neunzehnten Jahrhundert so populären Buch »Aufzeichnungen aus dem Priesterseminar« beschrieben. Die wilden Seminaristen überfielen damals immer die friedlichen Händler des Mariä-Verkündigungs-Marktes. Die Legende will es, daß hier, auf einer der Bänke des Bursatzkij-Abhangs, der große Chlebnikow sein Gedicht »Ladomir«3 geschrieben hat. Hinter der Sumskaja-Straße, dem Mariä-Verkündigungs-Markt und dem Dserschinskij-Platz liegen die vielen kleinbürgerlichen Wohnviertel der Stadt und die Arbeitervororte. Glücklicherweise befinden sie sich außerhalb der Grenzen des Schauplatzes unserer jetzigen Erzählung.
»Verbrecher, Verrückte und Lumpenpack« bevölkerten die Stadt zur Zeit Chlebnikows. »Das Lumpenpack« ist ein Wort aus Charkow, ja, es kommt sogar vom Bursatzkij-Abhang, um es genauer zu sagen. Heute, viele Jahre später, so schien es dem Buchverkäufer, waren das Lumpenpack und die Verrückten in Charkow wieder aufgetaucht. Zumindest die Verrückten. Irgend etwas geht vor in Charkow. Etwas, was der Buchverkäufer, der seine schweren Bücherpakete schleppt, noch nicht ganz versteht.
»Ed, wir gehen zu Anna Rubinstein. Kommst du mit?« fragte ihn Motritsch, nachdem sie die Ware in den Laden Nummer Einundvierzig zurückgebracht und sie Lilja ausgehändigt hatten, die sich beeilte, weil sie mit ihrem jungen Mann Alik ins Theater gehen wollte. Die Direktorin überprüfte nicht einmal die Einnahmen und tat das Geld, nachdem sie es in einen Umschlag gesteckt hatte, in die Kasse und verschloß sie mit dem Schlüssel.
»Ja, ich komm mit.« Er wollte mitkommen. Er hatte vielleicht das erste Mal in seinem Leben mit Leuten zu tun, die er wirklich sehen wollte. Ein seltsames Gefühl ruhiger Befriedigung durchströmte ihn.
»Wir müssen etwas zu trinken kaufen.« Motritsch begann, in den Tiefen der Taschen seines fürstlichen Pelzes zu suchen. Sek langem schon arbeitete er überhaupt nicht mehr und hatte, wie der Buchverkäufer wußte, kein Geld. Die Direktorin Lilja hatte den Buchverkäufer nachdrücklich davor gewarnt, Motritsch Geld zu leihen. Weder sein eigenes Geld, geschweige denn Geld aus der Kasse. »Selbst wenn er verspricht, es dir sofort zurückzugeben, gib ihm nichts. Wolodja ist ein genialer Dichter und deshalb trinkt er zweifellos zu viel. Doch wirst du dein Geld nicht wiederbekommen. Und bei einem genialen Dichter Schulden einzutreiben, wird recht unangenehm sein. Merk dir das — für Motritsch hast du kein Geld!« Der Buchverkäufer gab ihm einen Fünfrubelschein. Mischa Bassow versuchte nicht einmal, in seinen Taschen nach Geld zu suchen. Offenbar hatte er nie welches. Der Buchverkäufer, der bei sich zu Hause in Saltow sechs Anzüge hängen hatte, verfügte noch über etwa hundert Rubel von seinem letzten Lohn aus der Gießerei, und nachsichtig verzieh er dem Intellektuellen die Armut, die ihn erhöhte.
Ein nasser und pappiger Schnee fiel in großen und ungleichen Flocken auf Charkow herab und wurde von Zeit zu Zeit von Windböen verweht, die aus den Querstraßen in die Sumskaja-Straße einfielen. Der Buchverkäufer beeilte sich, hatte aber Mühe, mit dem großen, in seinen fürstlichen Pelz gewikkelten Motritsch und dem Elch Bassow, in seinem leichten Tuch, Schritt zu halten. Auf Schultern und Köpfe der jungen Leute fiel ein Schnee, der der »Schaubude« oder den »Zwölf« von Blok würdig war. Und auch auf die schwarze georgische Schirmmütze, die der Buchverkäufer trug, fiel der Schnee, sie und der schwere Rating-Mantel waren eine Hinterlassenschaft des kleinen mutigen Juden Mischa Kopissarow, der dem Leben ein Schnippchen schlagen wollte und später hart dafür bezahlte. Noch vor seinem Vorschlag, mit ihm zusammenzuarbeiten, hatte Mischa Ed drei Meter Ratine für einen Mantel geschenkt, der Meter zu 57 Rubel…
Es war ein surrealistischer Schnee, der die Stadt von Wrubel4 und Chlebnikow, von Tatlin und Vvedenskij bedeckte; durch ihn liefen — ihrer Gegenwart verhaftet — Motritsch und Bassow, der Buchhändler aber in seine Zukunft. In der Zukunft erwartete ihn Anna Moissejewna Rubinstein — »das verlorene Kind des jüdischen Volkes«, wie sie sich selbst nannte —, eine Frau, die im Leben von Eduard Sawenko die Hauptrolle spielen sollte. Der frühere Gießereiarbeiter, der noch nicht so recht wußte, was er wollte, hatte unbewußt Anna für diese Rolle auserwählt. Später wird man seine Wahl »Schicksal«, »Bestimmung«, »Zufall« nennen. Wenn man auf eine gewiß weniger romantische, aber authentischere Erklärung zurückgreifen will, so könnte man sagen, daß der junge Arbeiter ein Intellektueller, ein Dichter werden wollte, daß er immer mehr wissen und lernen wollte.
Und das wollte er leidenschaftlich und aktiv. Nachdem er ein paar Dutzend Seiten der »Einführung in die Psychoanalyse« gelesen hatte, hatte er sich ein großes Heft zugelegt und damit begonnen, das Buch Zeile für Zeile abzuschreiben, weil er verstanden hatte, daß dieses Buch wichtig für ihn war. Es gab leider kein anderes Mittel, dieses rare Buch zu reproduzieren. Und er konnte das Buch von Melechow nicht behalten. Genauso wie es nur ein Exemplar von Anna Moissejewna gab, das er sich aneignen mußte.
Anna Moissejewna öffnete selbst den durchnäßten Dichtern, mit ihren Portoflaschen in den Taschen, die Tür. Eng um ihre Gasbrenner gerückt, warfen die Frauen im Gemeinschaftsflur der Wohnung, in ihre Morgenröcke gehüllt, erschrockene Blicke auf den Einzug der großen Dekadenzler. Nachdem sie geschrien hatte: »Oh, Wolodja!… Mischa!«, ging Anna in einem Kleid von der Farbe toten Herbstlaubes voran, und durch die schweren Düfte von zwanzig verschiedenen Mahlzeiten steuerten alle vier durch die Wohnung. Anna ließ in dem kurzen dunklen inneren Korridor den Dekadenzlern den Vortritt, riß die schwere Tür ihres Zimmers auf (daran hingen ihr Mantel und ihre Kleider) und ließ sie eintreten. Auf dem Spieltisch (auf dem unser Dichter seinen ersten Gedichtband und später auch »Die Köchin« und »Das Riesenbuch« schreiben sollte) brannte eine Kerze, und die Freundin von Anna, Wika Kuligina mit dem großen Mund, stand lächelnd von dem schmalen Holzbett auf.
»Wer kommt denn da, Anetschka?« Der Türflügel öffnete sich zum Zimmer hin, die Zigarette von Zilja Jakowlewna erschien und dann Zilja Jakowlewna selbst. »Ah… die Dichter sind da!« Zu der Zeit freute Zilja Jakowlewna sich noch über den Besuch der Dichter.
»Guten Abend, Zilja Jakowlewna!« Zur Überraschung des Buchverkäufers bahnte sich der klatschnasse Bassow einen Weg bis zur Dame mit der Zigarette und nahm ihre Finger in seine feuchte Hand und drückte seine Lippen drauf. Der Buchverkäufer wußte noch nicht, daß derjenige, den er für einen Symbolisten hielt, Mischa Bassow nämlich, in Wirklichkeit ein Surrealist war, und daß der belesene junge Mann nur den Meister André Breton mit seinem Handkuß für die Damen nachahmte. Der unbelesene Buchverkäufer murmelte bloß ein schüchternes »Guten Abend«.
»Mama, geh wieder in dein Zimmer! Es ist Zeit zu schlafen!…« Anna drängte ihre Mutter zärtlich, aber ohne Umstände aus dem Zimmer. Sie entzündete eine andere Kerze und stellte sie auf das Fensterbrett. Ein unvorstellbar dichter Schnee fiel mittlerweile draußen vor dem Fenster… Auf den Tewelew-Platz, auf das frühere Gebäude der Adelsversammlung, auf das Restaurant »Theater« an der Ecke Tewelew-Platz/Sumskaja-Straße, auf die Passanten mit ihren hochgeschlagenen Mantelkragen, auf das giftig-rote Transparent »Bringen Sie Ihr Geld auf die Sparkasse«, ein unbeholfenes Produkt einer rückständigen Werbeagentur aus Charkow, das zu niedrig unter den Himmel gehängt war.
Warum schneit es so, fragte sich der Buchverkäufer und schaute zum Fenster hinaus. Vielleicht ist etwas passiert? Vielleicht geht die Gegenwart bereits in die Zukunft über, dachte er, und er bekam Angst.
8
Aus dem grünen Graben, der die Garküche umgibt, tauchen zwei weitere Mitglieder der berühmten »SS«-Bande auf: Paul und Viktor. Letzterer hat einen grünen Zweig an seinen Strohhut gesteckt. Genka begrüßt die Freunde, während er aufsteht und der Kellnerin Dusja einige Befehle zuwirft.
Als man Ed in die »SS« aufgenommen hatte, gehörten Paul und Viktor schon dazu. Genka hatte Paul-Pavel kennengelernt, als er sein kurzes Gastspiel als Meister in der Fabrik »Der Kolben« gegeben hatte. Genka und eine Fabrik! Es fällt sehr schwer, sich Gennadij Sergejewitsch vor dem Hintergrund von Maschinen und eingefetteten Metallteilen vorzustellen. Auch wenn er einen blauen Kittel trug und in der Hand den Notizblock des Meisters. Und dennoch gab es die Kolben-Periode in seiner Biographie, und so seltsam es auch erscheinen mag, Genka war stolz auf dieses arbeitsame Zwischenspiel. Obschon es ganz prosaisch ein Freund seines Vaters gewesen war, der ihn im »Kolben« eingestellt hatte, damit er die Arbeitspapiere bekam, die für die Zulassung zum Institut erforderlich waren, kann man doch mit Sicherheit annehmen, daß Genka die Arbeit in der Fabrik als ein exotisches Abenteuer auffaßte und ihm der metallische Dschungel im »Kolben« in diesem Sinne gefallen hatte. Ed hatte schon oft Gelegenheit, die konfusen und begeisterten Erinnerungen der alten »SS« an jene legendäre Periode, in der die »SS«-Bande geboren wurde, anzuhören. Paul Schemmetow arbeitete in der Gießerei der Fabrik »Der Kolben«, Fima war dort Ingenieur, Genka schrieb die Aufträge und Wagritsch Bachtschanjan schrieb die Losungen auf Schablonen. Dennoch hat Ed bisher nicht verstehen können, wer dort wer war und in welcher Reihenfolge sie miteinander bekannt wurden. Es sieht so aus, als wenn der dicke frankophile Paul Bachtschanjan Genka vorgestellt hatte.
Über sein ganzes breites Gesicht lachend, betritt der ehemalige Matrose Paul, »M'sieur Bigoudi« (so nennt Viktor ihn wegen der kastanienfarbenen Locken, die wie eine Kappe den Kopf des Ex-Matrosen bedecken), die Garküche; seine Gangart ist alles andere als sowjetisch, er trägt eine Hose, die »M'sieur Eduard« ihm genäht hat und die wie die Falten einer Ziehharmonika über seine Stiefel fällt. Der Gang des trockenen, kompakten, germanophilen Viktor, der ihm folgt, erinnert eher an eine mechanische Puppe. Die beiden Freunde haben es verstanden, vollkommen der Rolle zu entsprechen, die sie sich gewählt haben. »M'sieur Bigoudi« hat es geschafft, ohne je auch nur einen Fuß auf französischen Boden gesetzt zu haben, ein akzentfreies Französisch zu sprechen. Vier Jahre lang hat er, als er noch bei der Marine war, allein mit Wörterbüchern gelernt, und seinen Akzent hat er verloren, indem er regelmäßig repatriierte Russen besucht hatte, die aus Frankreich zurückgekommen waren. Paul ist in der Nähe von Charkow, in Tjura, geboren worden und aufgewachsen. Nach seinem Dienst in der Marine ist er zu seinen Eltern nach Tjura zurückgekehrt, zu diesen »Nieten«, wie er sie selbst verachtungsvoll bezeichnet. Er schämt sich dieser Halbbauern aus Tjura, die kein Französisch sprechen.
Jetzt ist es schon ein Jahr her, daß »M'sieur Bigoudi« ein Mädchen aus dem Zentrum mit dem Spitznamen »Häschen« geheiratet hat und beim »Häschen« und ihrer Mutter eingezogen ist. (Genau wie unser Hauptheld. Beachten Sie den Drang der Provinzjugend zum Stadtzentrum!) Ed und Paul-Pawel kennen sich jetzt schon ungefähr zwei Jahre, aber erst kürzlich haben sie entdeckt, daß sie alte gemeinsame Bekannte haben. Es stellte sich heraus, daß Paul häufig die Familie Wischnewskij, Repatriierte aus Frankreich, besuchte, mit deren jüngster Tochter Asja (das ist nämlich Lisa) der junge Sawenko irgendwann einmal befreundet war. Das ist nicht verwunderlich, denn Paul lebte schließlich in Tjura, und Asja und Ed ganz in der Nähe, im benachbarten Saltow. Wenn er in seinem Gedächtnis wühlte, und einen geduldigen Sucher belohnt es immer mit einem Fund, erinnerte Ed sich an eine Szene, die sich im Jahre 1958 am Kranich-Strand abgespielt hatte. Die halbnackte Bande aus Tjura saß unter einem wolkenbedeckten Himmel am Strand und zeigte ihm einen bärtigen Kerl, der mit riesigen Hanteln am Ufer entlang lief. »Unser Matrose Paul… Er ist gerade von der Marine zurückgekehrt…« sagten die Freunde aus Tjura. »Er ist so stark wie ein Stier und zwitschert ein perfektes Französisch, aber das ist noch nicht alles…« Kolja, der Zigeuner, hatte einen Finger auf seinen Kopf gelegt und ihn einmal herumgedreht, als wenn er ihn in den Schädel bohren wollte. Er wollte damit ausdrücken, daß der Matrose ein wenig seltsam und angeschlagen war, daß er eine Schraube locker hatte. In Tjura achtete man die Kräftigen, aber nicht die Verrückten. So hatte »M'sieur Eduard« zum ersten Mal M'sieur Bigoudi gesehen, das war nun schon neun Jahre her.
Die »SSler« betreten die Veranda; Paul, in seiner grau und schwarz gestreiften Hose, macht einen tiefen Bückling. Er spricht wenig, murmelt bloß ein »Bonjour…« und setzt sich an den Tisch. Im Gegensatz zu ihm ist Viktor, lustig, elegant und begeistert wie ein junger Offizier, einen Hut auf dem Kopf, mit Khakihose, Sandalen und kurzärmeligem Nylonhemd bekleidet, geradezu geschwätzig. Nach einem kurzen Blick über die Veranda hat er entschieden, daß es genügend Zuschauer gibt, stellt sich in Pose und brüllt »Heil«, wobei er den Arm zum Hitlergruß erhebt. Die schockierte Hammelherde, Häppchen essend und auch Wodka trinkend (eingegossen wird er aber unter dem Tisch), murrt dumpf und unverständlich. »Rowdy!« bemerkt am Nebentisch eine Frau mit Brille erschreckt und dreht sich zu ihm um. Ihr häßliches Gesicht verzieht sich schmerzlich.
»Soldaten…!« beginnt Viktor strahlend seinen Auftritt. Eine Hitlerrede. Viktor ist nicht faul gewesen und hat ein Dutzend Reden auswendig gelernt, er beherrscht die Intonation und den Stil des Führers, das vollkommenste Deutsch. Viktor hat ein Studium am Institut für Fremdsprachen abgeschlossen und in Bratsk, in Ostsibirien, an einer Sprachenschule unterrichtet, nach sechs Monaten ist er aber von dort zurückgekommen. In sechs Monaten hat er es geschafft, zu heiraten und sich scheiden zu lassen, nachdem er ein Messer auf seinen Schwiegervater, einen Arzt, geworfen hatte. Das Messer war, genau über dem Skalp des Arztes, in der Tür stecken geblieben.
Viktor beendet seine Rede, und für einen Augenblick hat Ed das Gefühl, gleich würde sich die ganze Hammelherde auf sie stürzen. Ein ungutes Schweigen liegt über der Veranda. Bloß die Tiger brüllen, aus Hunger oder Ärger, in der Ferne. Genka zögert noch etwas, genießt das ungute Schweigen, schiebt, ohne sich sonderlich zu beeilen, den Stuhl zurück, erhebt sich und sagt schließlich, indem er sich an die Essenden wendet: »Genossen! Applaudieren wir dem Studenten aus der Deutschen Demokratischen Republik, der uns so brillant diese Hitlerrede aus dem Theaterstück ›Der Fall von Berlin‹ vorgetragen hat!« Die Hammelherde applaudiert begeisterter als eigentlich nötig. Ihre Ehre ist gerettet. Eine Schlägerei ist nicht nötig. Vielleicht hat niemand geglaubt, daß es ein Stück mit dem Titel »Der Fall von Berlin« auch wirklich gibt, aber wesentlich ist, daß die in der deutschen Rede allein verstandenen unguten Worte »Kommunisten«, »Kommissare«, »Juden« und »Partisanen« legitimiert und erklärt wurden. Der heiße Augusttag ist wundervoll, der Wodka und der Porto sind gut und brennen, die Achseln an den Kleidern der Frauen zeigen dunkle Flecken, und der fleischliche, materielle, lebendige Schweißgeruch zieht zwischen den Tischen durch und mischt sich mit dem Geruch des Essens. Ganz in der Nähe, kaum zehn Schritte weiter, liegt die Schlucht, in der man für alle möglichen Bedürfnisse verschwinden kann, bloß um zu pissen oder zu kacken oder auch für einen sommerlichen Beischlaf. Warum also soll man sich schlagen?
»Ich danke Ihnen, Genossen!« Der Deutschdemokratische erhebt noch einmal den Arm zum »Heil«, wobei er die Absätze zusammenschlägt, während Genka, der seine Freunde und die kritischen Augenblicke über alles liebt, ihm mit einem glücklichen und verhaltenen Lächeln ein Glas Wodka anbietet. Der Student aus der guten deutschen Republik nimmt einen kleinen Schluck und setzt sich. Er trinkt wenig. Möglicherweise verdankt er seine Abneigung gegen den Alkohol seinem Vater, der ein Alkoholiker ist. Der Alkoholiker hat vor sechs Jahren ein Auge verloren. Viktor hat ihm das Auge ausgeschlagen. In der Version von M'sieur Bigoudi soll sich das folgendermaßen zugetragen haben:
Die Eltern von Viktor leben, wie die Eltern von M'sieur Bigoudi, in Tjura in einem eigenen kleinen Haus. Eines Tages, kurz nach seiner Heirat (seiner ersten), hatte Viktor sich nach dem Mittagessen mit seiner Frau im Garten unter den Apfelbäumen schlafen gelegt. »Nun gut, ich weiß nicht, ob sie rumgefummelt haben oder nicht…« lacht Paul boshaft; außer Französisch beherrscht M'sieur Bigoudi bloß die Sprache seines heimatlichen Tjura. »Jedenfalls haben sie sich hingelegt… Der Vater kommt betrunken von der Arbeit und läuft, auf der Suche nach einem Abenteuer, das etwas Leben in seinen Schwanz bringt, im Garten rum… Als er die jungen Eheleute daliegen sieht, packt der Vater Viktors Frau ans Bein.— ›Scher dich zum Teufel, alte Sau!‹ schreit Viktor. Die alte Sau verschwindet überhaupt nicht, sondern beginnt, am Lager der jungen Eheleute zu nesteln, und versucht, sie umzuschmeißen… Wieder schreit Viktor seinen Vater an, sich zum Teufel zu scheren und ihn, Viktor, nicht weiter zu stören. Darauf sagt der Vater zu Viktor, er soll sich verpissen, steckt seine Hand unter das Laken und packt Viktors Frau an den Hintern.«
M'sieur Bigoudi schüttelt sich in einem lautlosen Gelächter und schlägt sich auf die Schenkel. »Viktor steht auf, nimmt einen Ast und schlägt seinem Papa auf den Kopf. Er spaltet ihm treffsicher den Schädel, und eine Ambulanz muß seinen Papa verarzten.« Der Erzähler findet seine Geschichte schrecklich komisch und reißt lauthals lachend den Mund auf. »Aber auch die Ambulanz konnte nichts mehr machen, Ed. Der Ast hatte einen kleinen Zweig am Ende, und der ist dem Papa ins Auge gegangen… Das ganze Auge ist ausgelaufen, wie ein Spiegelei in der Pfanne…«
»So sind diese Wilden in Tjura«, sagt sich Ed, der zwischen den riesigen und erhitzten Körpern von Anna Moissejewna und M'sieur Bigoudi eingequetscht sitzt. »Selbst die besten unter ihnen…« Viktor lebt immer noch bei seinen Eltern. Sein Vater hat ihm auf eine gewisse Art sogar verziehen, und Viktor leidet nicht zu sehr darunter, seinem Vater ein Auge ausgeschlagen zu haben. Eines Tages hat er Ed im Scherz seine Version der Geschichte vom Auge erzählt, die sich nur geringfügig von Pauls Version unterschied. Nach einer Französischlektion — Ed nimmt jetzt zweimal die Woche Französischunterricht bei Viktor. Ja, Viktor kennt die Sprache der Franzosen, das war seine zweite Sprache an der Universität. Warum unterrichtet Viktor, und nicht Paul, Ed in Französisch? Dieser Snob von M'sieur Bigoudi hat gesagt, daß es ihm ein Vergnügen sein werde, mit Ed zu parlieren, aber erst dann, wenn er es bei Viktor gelernt habe, denn er selbst verstehe es weder noch liebe er es, Sprachunterricht zu erteilen. Viktor gibt Ed also für etwas Geld Französischstunden. Er verlangt nur halb so viel, wie andere nehmen würden. Deutsch will Ed nicht lernen. In der Schule hat er mit Französisch angefangen und 1961, als es ihn in eine Kochschule verschlagen hatte, damit weitergemacht. (Die Miliz hatte ihn damals zur Arbeit genötigt, und er hatte es vorgezogen, Borschtsch und Pasteten-Rezepte zu lernen, Hühner auszunehmen und Schweinefleisch zu zerlegen, anstatt hundert Kilometer von Charkow entfernt in die Verbannung zu gehen. Man hatte ihn sehr schnell wegen Hühnerdiebstahles und dauernder Abwesenheit rausgeschmissen.) Warum versucht Ed, sein Französisch wiederaufzufrischen, das er im Verlauf seiner wüsten Reisen ganz einfach vergessen hatte? Welches ferne Ziel verfolgt er, wenn er Französisch lernt? Schwer zu sagen, vielleicht zukünftige Abenteuer auf der Oberfläche der Erdkugel. Im Stil der Abenteurer Alain Delon und Lino Ventura. Vielleicht daß er und Genka…
Allerdings erkennt Ed immer deutlicher, daß sein prächtiger Freund Genka — sein Stolz, sein Freund, in gewissem Sinne auch sein Führer und Lehrer — schwach ist… Selbstverständlich ist diese Schwäche nicht physischer Natur, es ist eher eine Schwäche des Charakters. Über seine Aufenthalte in der Garküche, seine Ausflüge ins »Monte-Carlo«, seine winterlichen Flußbäder, seine Sauftouren und kleinen Betrügereien, gehen die verschiedenen farbigen Wünsche und Phantasien Genkas nicht hinaus. Das dolce vita in Charkow. Ihr gefährlichstes Abenteuer war der mißglückte Versuch, ein Frachtflugzeug zu besteigen. Man hatte sie festgenommen. Genka, ruhig, elegant, geschniegelt und gepflegt, hatte Ed und sich für Agenten des KGB ausgegeben, er hatte ihnen Familiennamen einiger sehr bedeutender KGB-Leute aus Charkow genannt, und der Sicherheitsbeamte hatte sie wieder freigelassen und ihnen sogar noch einen Kognak am Büffet ausgegeben. »Dieser Idiot!« hatten Genka und Ed in dem Taxi gesagt, das sie vom Sicherheitsposten auf dem Flughafen von Charkow abholte.
*
»Ed, Ed, Ed! Was ist, schläfst du ein?« ruft Anna und winkt mit ihrem Arm vor seinen Augen. »Träumst du?«
»Was hat denn unser geschätzter Dichter?« erkundigt sich der Enthusiast Viktor fröhlich. Er wendet sich immer mit einem ironischen Unterton an seinen Schüler, er achtet Ed nicht etwa, weil er Gedichte schreibt, sondern weil er Hosen nähen kann und sein Geld verdient, ohne aus dem Haus gehen zu müssen. Nur ganz wenige glauben an seine Gedichte. Alle glauben an seine Hosen. Die Hosen — das liegt auf der Hand. Ed kann jeden Tag zwei nähen, und wenn er frühmorgens anfängt und bis spät in der Nacht arbeitet, schafft er sogar drei.
9
Wegen Anna hatte er angefangen, Hosen zu nähen. Eines Tages hatte er die jüdische Frau in einer Khaki-Jeans mit Schlag besucht. Im Winter 1964/1965 waren Jeans mit Schlag in Charkow sehr modisch.
»Was für eine wunderbare Hose, Ed!« hatte Anna gesagt. »Wer hat sie dir gemacht?«
»Ich selbst«, hatte Ed gelogen und damit seine finanziellen Probleme für die nächsten zehn Jahre geregelt.
»Ich wußte gar nicht, daß du nähen kannst.« Anna war wirklich überrascht. Bis dahin hatte sie ihn nicht ernst genommen. Das war noch, bevor er sie auf der Krim, im Sanatorium in Aluschta besucht hatte, wo sie sich damals von Charkow und ihren Problemen hatte erholen wollen. Das war noch, ehe sie miteinander ins Bett gingen, ehe Ed zu Anna gezogen war und in der jüdischen Familie als Pflegekind lebte. Das war noch vor unserer Zeit. Anna und er waren damals nur befreundet. Er kam jeden Abend zu Anna Moissejewna, setzte sich in eine Ecke und schwieg die meiste Zeit, während er die Gäste mit den verwunderten und unschuldigen Augen eines Arbeiters und Verbrechers betrachtete. Er schwieg, weil er nichts zu sagen hatte, er kannte nicht die Namen der Maler, der Schriftsteller und Dichter Rußlands und der Welt, er kannte nicht die damals modischen Gedichte von Pasternak. Oh! Er wußte nicht einmal, wer van Gogh war, und es hatte noch monatelang gedauert, bis er ihn von Gauguin unterscheiden gelernt hatte, und noch einen weiteren Monat, um zu verstehen, wem das abgeschnittene Ohr gehörte.
Trotz der Verwirrung und der Scham, die ihm sein erzwungenes Schweigen bereitete, kam der Buchverkäufer hartnäckig jeden Abend in Annas Zimmer und brachte unweigerlich einige Flaschen Porto mit, weil er wußte, daß ihm vom Portwein leichter ums Herz wurde. Jeden Abend gab es in diesem Herbst, am Tewelew-Platz Nr.19, Diskussionen, Kerzen, Lesungen von Gedichten und Porto. Wenn Anna mit Wika Kuligina und dem früheren Ehemann von Wika, Tolik Kuligin, alleine war, zogen sie trockenen Weißwein dem Porto vor. Der Buchverkäufer, der gerade erst begonnen hatte, seinen Geschmack zu entwickeln, verschmähte den trockenen Weißen und bevorzugte den Porto.
Vom heutigen Standpunkt aus gesehen, durch die dichte Hülle der Zeit, kann das Verhalten des Arbeiters Sawenko und seine lebhafte Entschlossenheit nur Entzücken hervorrufen. Auch wenn er nicht genau begriff, warum Anna und diese Leute, die er nicht so richtig verstand, die manchmal lustig und manchmal etwas steif wirkten, für ihn notwendig waren, so flüsterte ihm doch ein mächtiger Instinkt zu: »Bleib hier. Das brauchst du, diesen Ort. Bleib hier. Das sind sie. Das sind die Leute, die du vergeblich in den Fabriken, den Gemüsehallen, auf den Straßen der Krim, des Kaukasus und Asiens gesucht hast. Bleib, schweige und lerne!« Und genau das tat er. Ohne das unerbetene Mitleid und manchmal sogar den Spott zu beachten. Der Elch Mischa Bassow war von allen der ironischste. Und mehr als einmal hatte der Buchverkäufer seine spöttischen Blicke bemerkt. Hosen… Zehn Tage später hatte Anna ihn plötzlich gefragt:
»Hör mal, Ed, kannst du für einen Freund eine Hose nähen? Er ist so mager wie eine Bohnenstange, und die sowjetische Produktion kleidet ihn wie in einen Sack. Sein Mädchen, meine Freundin Schenja aber will, daß Sajatz gut aussieht. Willst du es machen?«
»Gerne, Anna. Er soll ein Meter zwanzig Stoff kaufen«, hatte der Lügner geantwortet, er erinnerte sich an die Stellen, wo Maxim, der Typ, der ihm seine Khakihose genäht hatte, Maß genommen hatte. Mit dieser Lüge bereitete er sich unnütze Sorgen, aber er würde schon einen Weg finden. Er würde sich die Maße von Annas Freund notieren und sie zusammen mit dem Stoff zu Maxim tragen, Maxim würde die Hose nähen, Ed sie dem Freund von Anna aushändigen und alle wären zufrieden. Aber das boshafte Schicksal ließ dieses Stück anders aufführen. Nachdem er von Jurij Kopissarow, dem Bruder des unglücklichen Abenteurers Mischa, die Adresse von Maxim bekommen hatte, begab sich der Lügner in eine alte und entzückende Gasse, klopfte an eine nicht weniger entzückende Tür, die schon zum abstrakten Kunstwerk geworden war, und aus dem Haus kam, anstelle von Maxim, eine alte Frau, ganz genauso entzückend wie Gasse und Tür, und stellte sich vor den reglosen Buchverkäufer mit seinem Paket in der Hand. »Ah, Maxim ist in der vergangenen Woche zur Armee eingezogen worden«, bemerkte die Frau voller Freude und fügte hinzu: »Gott sei Dank!« Was hatte er getan, um dieses »Gott sei Dank!« zu verdienen? Eduard hat es nie erfahren. In der alten und hübschen Straße roch es stark nach Rauch, als der Buchverkäufer traurig wieder zur Straßenbahnhaltestelle ging. Er kannte keinen anderen Schneider. Übrigens hätte ein normaler Schneider eine Hose mit Schlag weder schneidern können noch wollen.
Was tun? Als Eduard Jurij Kopissarow um Rat fragte, sagte Jurij, daß er keinen anderen Modeschneider kenne, und bemerkte philosophisch: »Warum hast du auch gelogen?«
Es kam nicht in Frage, Sajatz den Stoff zurückzugeben. Das hätte ihn in den Augen seiner neuen Freunde auf ewig kompromittiert, und ganz besonders in den Augen von Anna. Man würde ihn für einen Aufschneider halten. Eduard dachte nach und beschloß, die Hose selbst zu nähen. Er nahm an über hundert Stellen seiner eigenen Hose Maß und übertrug diese Maße auf Papier. So entwarf er die Zeichnung einer Hose. Raissa Fjodorowna beobachtete skeptisch die Bewegungen ihres Sohnes, der mit Kreide, Winkel, Stoff und Papier sich an dem runden Familientisch ihres einzigen Zimmers eingerichtet hatte.
»Wie willst du es machen? Du kannst doch gar nicht nähen«, bemerkte sie. Es war aber offensichtlich, daß es sie interessierte zu beobachten, wie ihr Sohn aus dieser Geschichte wieder herauskam: Normalerweise äußerst zurückhaltend, hatte er dieses Mal, weiß Gott warum, beschlossen, ihr die Geschichte zu erzählen.
Er hatte noch nie eine Hose genäht, aber er konnte eine Nadel halten. Einige Jahre lang hatte er heimlich, unbeobachtet von seiner Mutter, seine eigenen Hosen durchaus zufriedenstellend umgenäht. Er hatte eine natürliche Begabung als Zeichner und ein gut entwickeltes Verständnis für Geometrie. Schon in seiner Kindheit hatte er sich als Genie erwiesen, als er sich ein paar Rubel damit verdiente, daß er für die Nachbarinnen, und als sich sein Ruhm herumsprach, auch für andere, die Schnittmuster aus der Zeitschrift »Die Arbeiterin« vergrößerte.
Und letzten Endes kam er mit jedem Schnittmuster zurecht. Mit diesen ersten praktischen Erfahrungen und einem gesunden Geist versehen, vollendete er die Hose, nachdem er bei seinem Unternehmen schon achtundvierzig Stunden verloren hatte (besondere Schwierigkeiten hatte ihm der Schnitt der Taschen bereitet). Und seine Mutter, Raissa Fjodorowna, war überrascht, mußte aber anerkennen, als ihr Sohn die Hose anprobierte, daß es eine schöne Hose sei. Man kann sogar sagen eine bemerkenswerte. Weil sie aber keinesfalls ihre Einschätzung revidieren wollte (der zufolge ihr Sohn zu nichts Vernünftigem taugte), fragte Raissa Fjodorowna: »Und dieser Sajatz, ist der genauso groß wie du?«
»Ein bißchen magerer«, murmelte der Sohn. Als er am Montag wieder zu seiner Arbeit ging, um dem Volk Bücher zu verkaufen, nahm er die neue Hose von Sajatz mit.
Zur Mittagspause erschienen der dürre gelehrte Physiker Sajtzew, genannt Sajatz, mit seinem faltigen Gesicht, die weiße und feurige brünette Schenja Katznelson in einem schwarzen Pelzmantel und Anna mit einem leuchtend geblümten Schal über ihrem groben Wollmantel mit Pelzkragen. Da es kalt war, hatte man dem Verkäufer erlaubt, seinen Tisch ganz in der Nähe der Buchhandlung Nummer Einundvierzig aufzuschlagen, und mit dem Einverständnis von Lilja durfte Sajatz in den Keller hinuntergehen und dort die Hose anprobieren. Das war ein anderer Mann, der da aus dem Keller zurückkehrte.
»Sajatz, was für eine tolle Figur du hast!« rief Anna aus. »Ich habe immer geglaubt, daß du einen mageren Oberkörper und einen riesigen Hintern hast. Aber das kommt bloß von diesen schrecklichen Hosen! Alle Achtung, Ed!« Und Anna umarmte ihn.
»Ja, sie ist gut«, sagte Sajatz und betrachtete sich in der Spiegeltür. »Das hätte ich nicht erwartet. Wieviel schulde ich dir?«
»Nichts«, antwortete der Buchverkäufer und schaute woanders hin. Er verstand es noch nicht, sich für seine Arbeit bezahlen zu lassen.
»Zeig mal, Sajatz, dreh dich einmal um!« verlangte Schenja streng. Sajatz gehorchte mit einer Grimasse und drehte sich um. »Ist sie nicht hinten etwas weit?« fragte sie mit einem Blick auf den Buchverkäufer.
»Das muß so sein«, entschied die Direktorin Lilja, die stolz auf ihren begabten Untergebenen war.
»Wieviel schulde ich dir also?« fragte Sajatz noch einmal und klopfte dem Buchverkäufer freundschaftlich auf die Schulter.
»Hattest du nicht sieben Rubel gesagt, Ed?« meinte Anna. (Vielleicht hatte er sieben gesagt, jedenfalls war es nötig, irgendeinen Preis zu erfinden, er hatte vergessen, wieviel ihm Maxim abgenommen hatte.)
»In Ordnung, ich bin dir sehr dankbar, mein Alter.« Sajatz überreichte ihm ungeschickt einen Zehnrubelschein.
»Warte, du kriegst noch was zurück.« — Der Buchverkäufer wühlte in seinen Taschen.
»Ach was… Vergiß es.« — Jetzt war Sajatz verlegen.— »Gehst du essen? Komm mit uns ins Café, ich lade dich ein.«
»Ich weiß nicht. Ich muß arbeiten…« Der Buchverkäufer sah zur Direktorin hinüber.
»Bitte die Verhärmte, dich für eine Stunde zu vertreten…«
»Ich vertrete dich, ich vertrete dich…« sagte schnell die Verhärmte, die hinter dem Vorhang hervorkam, wo sie gerade die Abrechnung machte. Glücklich verließ der Buchverkäufer den Laden mit seinen neuen Freunden, und sie gingen ins Cafe am Gogol-Platz, um auf seine erste Hose zu trinken.
So also ist er Schneider geworden.
Nach Sajatz mußte er Hosen für Kuligin, den ehemaligen Mann von Wika und damaligen Liebhaber Annas, nähen. Damals schlief Anna noch manchmal mit Tolik. Ed hatte jedenfalls den Eindruck, aber damals schlief er selbst ja noch nicht mit Anna. Kuligin… ein Mensch mit Brille, ein Mensch mit einem Buch… Der kluge Tolik, der geistreiche Tolik, der allwissende Tolik, der bezaubernde Tolik… Er hatte nur einen Fehler — er trank zuviel — zu den ganzen übrigen neunundneunzig Prozent bestand er aus nichts als Vorzügen.
«Inzwischen sind zweieinhalb Jahre vergangen. Ed Limonow, älter und erfahrener geworden, sitzt mit seinen Freunden in der Garküche; er schweift von dem Gespräch ab und wendet sich Kuligin zu, dem Menschen überhaupt, dem Menschen und seinem Schicksal. Kann man vorhersehen, was aus diesem oder jenem Kind, Heranwachsenden, jungen Mann eines Tages wird?
Nehmen wir mal Kuligin. Seine Freunde waren der Ansicht, daß er überaus begabt war und zu großen Hoffnungen berechtigte. Die Briefe und die Erzählungen, die Anna Ed gezeigt hatte, waren in einem sauberen, etwas bemüht wirkenden Stil geschrieben und wimmelten von interessanten Beobachtungen. Ed mochte weder das zu feminin wirkende lila Papier noch die rote Tinte dieser Briefe. Aber das alles, die Farbe des Papiers und der Tinte, begründet noch keinen ernsthaften Vorwurf. Die Begabung war offenkundig. Aber die Erzählungen und die Briefe gehören zur Vergangenheit Kuligins und Annas, und nicht zu Eds. Schon lange schreibt Kuligin nicht einmal mehr Briefe. Er trinkt und liest. Er liest wie ein Süchtiger! Warum hat er nichts aus seiner Begabung gemacht? Warum? Das weiß der Teufel! Er ist überhaupt nicht ehrgeizig. Es fehlt ihm der Motor, der einen Mann dazu treibt, mit aller Kraft besser zu schreiben als die anderen und auch noch die höchsten Gipfel zu bezwingen. Kuligin ist nett, will aber nichts anderes als seinen Porto, Ruhe und Bücher. Kuligin hat einen Hund und eine Tochter, Tanja, und manchmal geht er mit ihnen im Taras-Schewtschenko-Park spazieren. Er war Wärter und arbeitet jetzt in der Heizerei einer chemischen Fabrik. Hat er keinen anderen Ehrgeiz? Offenbar nicht.
Ist Ed ehrgeizig? Ja. Er hat sich eingeschlossen und schreibt den ganzen Frühling und Sommer 1965 Gedichte. Er hat schon zwei Pakete mit je 500 Blatt eines groben und grauen Papiers vollgeschrieben, die Anna für ihn im Laden gestohlen hat. Und alles, was er schrieb, erschien ihm am nächsten Tag bloß mittelmäßig… Manchmal entschloß er sich, das was er geschrieben hatte, Melechow, dem einzigen Wesen, vor dem er sich nicht schämte, zu zeigen.
»Schlecht!« stellte Melechow mitleidig fest und gab Eduard das gewichtige Paket mit den grauen Blättern zurück. »Das ist schlecht, aber schreib weiter und schmeiß das nicht weg.«
Von neuem schloß sich Ed einen ganzen Tag in Annas Zimmer ein, während Anna in den Buchladen ging, sie arbeitete jetzt in der »Wissenschaftlichen Buchhandlung«, wo die Disziplin viel strenger war und von wo sie nicht vor sieben Uhr abends zurückkehrte. Der Sommer war warm, man schwitzte, und der ehrgeizige Mann fuhr fort, Zeile für Zeile auf das graue Papier zu schreiben… Und wieder ließ Melechow, während er woanders hin sah, fallen: »Das ist schlecht, Ed, aber…« Er schrieb vielleicht ein Jahr lang schlechte Verse, bis er sich eines Tages gegen sich selbst auflehnte und es schaffte, aus dem tiefsten Wesen seines Seins die Melodie zu ziehen, die, wenngleich in konfusen und schlecht zusammengesetzten Phrasen, doch seine eigene Melodie war, er fühlte es. In aller Eile schrieb er noch ein weiteres Dutzend dieser unordentlichen Melodien und gab sie Melechow. Der ließ sich eine Woche lang nicht blicken, und Eduard erwartete die ganze Zeit voller Unruhe seinen Besuch. Er traf ihn endlich eines Abends im »Automaten«. Tolik zog aus seiner großen Aktentasche (auf Drängen von Anja Wolkowa und ihrer Mutter benutzte er jetzt lieber eine Aktentasche als seinen Beutel) die Gedichte von Eduard und sagte ernst, ohne zu lächeln: »Ed, nun kann man sagen, daß du ein Dichter bist. Du hast wirkliche Gedichte geschrieben. Da, nimm sie«, und er fügte traurig hinzu: »Ich werde nie solche Gedichte schreiben.«
Ed kannte ein Gedicht von Melechow »Das Weiße und das Unkörperliche«. Das Gedicht war sogar etwas komisch, ›das Weiße‹ verfolgte ›das Unkörperliche‹.
»Intellektuellengewäsch«, hatte Motritsch über das Werk von Melechow gesagt, als er seine Nase für eine Minute aus seinem fürstlichen Pelz streckte. »Du, Tolik, sollst nicht schreiben. Du verstehst alles von Gedichten, aber schreib keine. Es ist besser, wenn du uns kritisierst.« Und Motritsch hatte seinen dreifachen getrunken, das heißt seinen dreifachen Kaffee. Der einfache Kaffee aus der ungarischen Kaffeemaschine »genügte« Motritsch schon lange nicht mehr.
Eduard vertraute Melechows Geschmack. Der einfache Hausmeisterssohn mit dem vollen Gesicht, das immer leuchtete, erschuf Ed Sawenko und fand sogar ein gewisses Vergnügen daran. Melechow gab ihm nacheinander die drei Bände der Gedichte von Chlebnikow zu lesen, herausgegeben unter der Leitung von Professor Stepanow, und der junge Sawenko schrieb gewissenhaft Zeile für Zeile die Gedichte ab. Er hatte schon vor längerem entdeckt, daß, wenn er jeden Tag ein bißchen arbeitete, schließlich auch die große Arbeit getan war. Er schrieb die drei Bände ab, aber ohne die Kommentare. Melechow erklärte ihm, worin »der Automatismus der Wahrnehmung« bestand, und begann, ihm die vergilbten Opojas5-Hefte mitzubringen — eine Zeitschrift der Vertreter einer formalistischen Richtung in der sowjetischen Literaturwissenschaft der zwanziger Jahre. Dank Schklowskij, Aichenbaum, Tomaschewskij und Tolik Melechow erfuhr der junge Sawenko, daß ein »blauer Himmel« keinen Leser mehr berührt, weil nach diesen tausenden von blauen Himmeln, die über den Köpfen der Leser aus tausenden von Büchern geblaut hatten, diese unglücklichen Leser das Blau des Himmels gar nicht mehr wahrnehmen. Man mußte den Leser verwundern, begriff der junge Sawenko gerade in den Tagen, als er Limonow wurde.
10
»Ach, Ed, du bist noch immer nicht nach Moskau abgehauen?« fragt Paul und lächelt boshaft.
»Warum soll er auch woanders als in Charkow herumhängen, M'sieur Bigoudi?« fällt Genka ihm schnell ins Wort. Er will nicht, daß Ed weggeht. Er würde sich langweilen. Und er glaubt auch nicht an Eds Abreise.
»Wir sind fest entschlossen, euch im September zu verlassen«, bestätigt Anna. Ich fahre zuerst und Ed kommt zehn Tage später nach. Wir bringen Zilja Jakowlewna nach Kiew, vermieten die Wohnung und dann kannst du uns gern haben, Charkow!«
»Und zwei Wochen später seid ihr wieder da«, meint Genka und lacht. »Ed ist schon im April in Moskau gewesen. Es hat ihn dort nicht gehalten, und er ist zurückgekehrt zu seinen Penaten!«
»Unser Bach ist auch dort. Und ist dortgeblieben. Bach hat es geschafft. Er ist nicht für Charkow gemacht. Er hat ganz recht, diese Sauerei von Ukraine überzuhaben.« — M'sieur Bigoudi deutet mit dem Kinn auf die Essenden in der Garküche.
»Ich hasse diese Scheißer«, murmelt er und knetet seine großen mit roten Härchen bedeckten Fäuste. »Ich werde auch nach Moskau abhauen«, rückt er endlich damit raus, »ich verdufte.«
»Auch du wirst wiederkommen, Paul. Was habt ihr bloß alle, daß ihr nicht in Charkow bleiben wollt…« Genka ist es zuwider, vom Abreisen zu sprechen. Das hebt er ganz und gar nicht. Er würde vielleicht auch nach Moskau fahren, aber er kann anderswo kaum so komfortabel wie in Charkow leben, mit seinem Papa, dem Restaurantdirektor. Was wird er in Moskau sein? Ein Moskauer mehr. In Charkow ist Genka der Sohn von Sergej Sergejewitsch Gontscharenko. Selbst mit den Kleinigkeiten ist es hier leichter für ihn. Gestern brauchte er zum Beispiel Geld, er hatte Freunde zu Hause. Ohne lange nachzudenken, hat er aus dem Kühlschrank einige Dosen Krabben und zwei Dosen Kaviar genommen und sie in seine Aktentasche gesteckt. Sie sind zum Friseur gegangen, dem in der Sumskaja-Straße neben dem Cafe »Pinguin«, und in fünf Minuten waren alle Dosen verkauft. Dann sind sie ins »Lux« Schaschlik essen gegangen. In Moskau würde Genka über keinen vergleichbaren Kühlschrank verfügen, selbst wenn sein Papa seinem angebeteten Sohn genauso viel Kies wie schon jetzt schicken würde. Genka kann nicht nach Moskau gehen. Deshalb will Genka auch nicht, daß Ed geht. Und daß Anna geht. Genka braucht Gesellschaft. Er kann, egal wann — am Tag oder in der Nacht, bei Ed und Anna vorbeikommen. Wenn man von Annas Fenster aus eine gerade Linie ziehen würde, dann würde diese Linie genau auf die Treppe zu dem Weinkeller führen, der sich unter dem Asphalt des Tewelew-Platzes erstreckt. Wenn es im Sommer heiß ist, steigt der Weingeruch hoch, dringt in das Zimmer, das an einen Straßenbahnwagen erinnert, und reizt die Nasenlöcher des jungen Dichters. Wenn Genka also trinken will, wenn er sich langweilt, kann er zu Ed heraufpfeifen, und ein paar Minuten später steht sein Saufkumpan neben ihm, der mit seiner Schulter an der mit russischen Blumen bemalten Mauer lehnt. Es ist unmöglich zu begreifen, wie in dieser Stadt mit ihrer Millionenbevölkerung die patriarchalischen Sitten einer kleinen verschlafenen Stadt weiterbestehen konnten. Für Genka ist es ganz gut, in Charkow zu leben. Er liebt keine Gespräche über Abreisen.
»Im Frühling ist Ed wegen mir zurückgekommen!« erklärt Anna stolz und wirft einen provozierenden Blick auf die Burschen. Ihre kleine Nase hat sich gerötet und ihr Gesicht hat sich auch schon etwas gebräunt. »Stimmt's oder nicht, Ed?«
»Es stimmt.« Ed fühlt sich schuldig und vermeidet seine übliche Stichelei. Wenn er Anna ärgern will, dann sagt er: »Nein, das stimmt nicht…« Anna antwortet dann: »Du Lump, du bist ein kleiner Dreckskerl!« Und der Streit beginnt. Aber es stimmt, ja, ohne Anna hat er sich in Moskau alleine gefühlt. Er hatte sich an Anna Moissejewna gewöhnt, sie lebten ja nun schon fast drei Jahre zusammen!
Anna ist sein Weib, seine Freundin, seine Saufkumpanin. Wie Motritsch sagt: »Bei Anna stimmt alles!« Ed ist der gleichen Meinung. Natürlich ist sie verrückt. Aber Eduard Sawenko war auch schon einmal in einer Anstalt. Er hatte versucht, sich umzubringen. Er hatte sich über dem Roman »Rot und Schwarz« von Stendhal die Pulsadern aufgeschnitten. Das mit seinem geronnenen Blut befleckte Buch steht neben anderen Büchern im Bücherschrank seiner Eltern. Es war auf der Seite aufgeschlagen gewesen, wo der feurige Julien Sorel in das Zimmer von Madame de Rênal eindringt.
Und dennoch war Ed nicht allein wegen Anna nach Charkow zurückgekommen. Es war auch die Schuld von Moskau. Er hatte dort keinen Platz gefunden, wo er leben konnte. Er hatte bei Alla Worobewskaja geschlafen, einer ehemaligen Freundin von Anna aus Charkow, die mit Senia Pisman, einem Moskauer, verheiratet war. Senia war über Eds Aufenthalt in seinem Haus nicht gerade entzückt. Wer wäre das auch gewesen? Seine erste Reise nach Moskau war also schiefgegangen, und Ed war zurückgekommen.
»Warum wollt ihr überhaupt nach Moskau? Moskau ist nicht unbegrenzt ausdehnbar«, hatte ein Freund von Anna, der berühmte Maler Brussilowskij, gesagt, der einige Tage in Charkow verbracht hatte. Er roch nach Leder und fremden Parfums, er rauchte einen süßen Tabak in einer schönen gebogenen Pfeife (Bach erzählte, daß der Tabak mit Rosinen vermischt war), er trug einen Schnäuzer, einen Backen- und Kinnbart, Brussilowskij, den Ed sehr elegant gefunden hatte, war gekommen, um seine Jugendfreundin zu besuchen. Anna hatte sich einst geschworen, den Moskauer zu erobern, und es auch geschafft.
Die Familie hatte sich sorgfältig auf die Begegnung vorbereitet. Ed war auf den Maria-Verkündigungs-Markt einkaufen gegangen, Zilja Jakowlewna hatte Fleischpasteten, gefilte Fisch und Piroggen zubereitet.
Der Moskauer schlang wie eine Boa-constrictor. Wagritsch Bachtschanjan, den man auch eingeladen hatte, zeigte seine Werke.
»Interessant… interessant…« brummte Brussilowskij beim Anblick der Emaille-Arbeiten von Bach. »Wie haben Sie das gemacht?« Ed trug seine Gedichte vor. Im Grunde hatte man das Treffen arrangiert, um dem Moskauer das Werk des jungen Wunderkindes vorzustellen. Eine wichtige Begegnung. Das Werbegespann Anna-Zilja Jakowlewna versuchte, Brussilowskij das junge Wunderkind anzudrehen. Zum ersten Mal hatte Ed in Annas Verhalten eine wirkliche Aufregung beobachtet. Sie knabberte sogar an den Fingernägeln.
»Wunderbar! Erstaunlich!« rief Brussilowskij nach jedem Gedicht. Und vergaß nicht, weiter seine Piroggen zu verschlingen. Die Lobeshymnen des Moskauers waren Ed zu dick aufgetragen und schmeichlerisch vorgekommen, trotzdem las er weiter und hielt sich an Annas Anweisungen.
Der so hübsche ganz weiße Knabe
Die Haut so glatt wie ein Windbeutel
Wie eine Anschlagsäule. Intelligent. Der Kopf
Transparent
So ein Knabe mußte sterben, was?
Als Mädchen hatte man ihn bekleidet
Danach bloß nichts mehr von ihm gewollt
Er sagte »ich bin ein Mädchen«
Ein so hübscher kleiner Knabe
Man sah ihn nicht an
Man überwachte nicht den schönen Liebling
Was die Augen lesen, welche Bücher
Uh, die riesigen Bücher! Uh, die Alten!
Uh diese Schweinekerle!…
Der Moskauer begleitete »Das Riesenbuch« mit dem allerfettesten Ausruf aus seinem Vokabular: »Bewundernswert! Bewundernswert! Moskaus würdig!« schrie er und ließ eine Pirogge in seinem Bart verschwinden. »Das hat schon Moskauer Niveau!« Aber es war unmöglich festzustellen, ob er damit die Fleischpirogge, ein Werk von Zilja Jakowlewna, oder die Gedichte, das Werk von Ed Limonow, meinte.
»Tolik, sag deiner alten Freundin ehrlich, wir kennen uns ja nun schon über zehn Jahre: Wenn Ed nach Moskau geht, wird er dort mit seinen Gedichten… Erfolg haben? Ja?« Anna versteifte sich. Ed wurde rot und stürzte ein Glas Wodka herunter. Der Moskauer trank keinen Wodka.
Der energische Brussilowskij hatte dort, wo er keinen Bart trug, rosige und sonnengebräunte Wangen, er war widerwillig nach Charkow gekommen, um seinen Vater Raphael zu besuchen, einen kranken Schriftsteller, nun warf er einen aufmerksamen Blick auf Anna Moissejewna. Die Jugendfreundin von Anatolij Brussilowskij wußte eine Menge Sachen über ihn, die sie für schändlich hielt, die es eigentlich aber gar nicht waren, was jedoch das männliche Selbstgefühl Brussilowskijs vor zehn Jahren verletzt hatte. Sie erinnerte sich beispielsweise daran, wie seine falschen Freunde (darunter ihr früherer Ehemann) den kleinen Tolik im Taras-Schewtschenko-Park an einen Kastanienbaum gehängt hatten, nachdem sie ihm die Kleider von seinem Unterleib gerissen hatten… Tolik hatte beschlossen, sich seiner Jugendfreundin gegenüber höflich zu verhalten, er hatte die in seiner Jugend erlittenen Beleidigungen verdrängt.
»Für die offizielle Literatur sind die Gedichte deines Mannes unerträglich, sie sind avantgardistisch, man kann sie nicht verlegen. Sogar Andrej hat die größten Schwierigkeiten, veröffentlicht zu werden. (Unter Andrej, hatte Ed richtig erraten, mußte man Andrej Vosnessenskij verstehen.) Selbst er…«
Anna verfinsterte sich. Sie hielt Brussilowskij für einen intelligenten, subtilen und gewandten Mann. Und wenn Tolik »nein« sagte, dann würden die Gedichte ihres Mannes, Kindes und Schützlings nicht in Moskau veröffentlicht werden. Ihr Genie…
»Aber…« — Brussilowskij hatte sich eine weitere Pirogge auf den Teller gelegt und bereitete sich darauf vor, ein Stück in seinen Mund zu schieben — »viele Dichter leben am Rande der offiziellen Literatur. Ganz zu schweigen von meinen alten Freunden Cholin und Sapgir — (Ed spitzte die Ohren, diese Namen kannte er nicht) —, beide verdienen ihr Geld, indem sie Gedichte für Kinder schreiben.« Brussilowskij ließ mit Genuß die Pirogge in dem Spalt verschwinden, der seinen Kinnbart von seinem sorgfältig gebürsteten und geschniegelten Schnurrbart trennte.— »Sogar die JGG'ler können sich über Wasser halten…« Ed spitzte von neuem die Ohren. Wer waren die JGG'ler?
»Ihr habt noch nie von den JGG'lern gehört?« fragte der Moskauer, der das Unverständnis auf den Gesichtern der Provinzler bemerkt hatte.
»Doch, ein bißchen«, sagte Wagritsch sehr diplomatisch, er wirkte verjüngt, weil er sich gerade erst seinen armenischen Bart abrasiert hatte, er war längst fest entschlossen, nach Moskau zu gehen.
»Die JGG'ler sind eine neue literarische Avantgardebewegung. Sie nennen sich ›Die jüngste Gesellschaft der Genies‹. Der genialste ist Lenja Gubanow. Auch Wolodja Alejnikow gehört dazu. Sie sind alle noch sehr jung. Gubanow hatte man schon mit sechzehn Jahren als Genie entdeckt!« Brussilowskij betrachtete die Provinzler mit Herablassung.
Ed fühlte sich mit seinen einundzwanzig Jahren alt. Er schämte sich sogar seines fortgeschrittenen Alters. Wagritsch war noch fünf Jahre älter. Sollten sie vielleicht doch nicht nach Moskau gehen? War es vielleicht schon zu spät? Hatten sie etwa schon alles hinter sich?
»Warum wollt ihr überhaupt nach Moskau?« fragte der Moskauer lachend, selbstsicher, herrisch und frech die Provinzler. Ed bemerkte, daß die Hand des Moskauers, mit der er ruhig das Brause-Glas umfaßte, klein war und seine Finger kurz. »Hier könnt ihr in Ruhe arbeiten und genauso gut bekannt werden. Nach dem, was Anna mir gesagt hat« — jetzt brummte Brussilowskij zufrieden — »nehme ich doch an, daß es hier ein sehr gut entwickeltes intellektuelles Milieu gibt. Trefft euch oft, lest Gedichte, zeigt euch eure Werke gegenseitig, veranstaltet Ausstellungen in den Wohnungen… Was soll das also…« — Der Moskauer leerte sein Brause-Glas in einem Zug — »Nein, Kinder, Moskau kann schließlich nicht alle Welt aufnehmen, man kann Moskau nicht unbegrenzt ausdehnen!«
Dieser Hund mit seinem Vollbart! dachte der Dichter. Er hat es sich in seinem nicht-ausdehnbaren Moskau bequem gemacht. Er hat eine Moskauerin geheiratet. Und für uns gibt es keinen Platz? Er sagte schüchtern, mit leiser Stimme: »Ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, daß man, um gut Schach spielen zu lernen, mit Leuten spielen sollte, die besser sind als man selbst. Wenn man immer nur auf Spieler mit gleichem oder niedrigerem Niveau trifft, lernt man nichts.«
»Das ist weise!« sagte Brussilowskij. »Wie heißt es noch bei Ihnen? Die Hitze…
Die Hitze und der Sommer… Sind eingeladen
Anton und mein Onkel Iwan.
Ein gewisser Pawel und ein gewisser Rebro
Und mit ihnen ihr Neffe Kraska…
Da liegt was drin. In Ihrer Dichtung findet man Charkow und die Ukraine und gleichzeitig einen Raum von einer ewigen und buddhistischen Wärme… Na gut, das geht in Moskau…« erklärte Brussilowskij wie für sich selbst.
Ed wurde warm ums Herz, und er verzieh sofort dem Moskauer seine kurzen Finger, seine Freßsucht, seine Gier nach Fleischpasteten, und sogar sein Backenbart erschien ihm sympathisch.
»Tolik! Du erinnerst dich! Obwohl du es nur ein Mal gehört hast!« Anna trug aus Anlaß des Besuches ihres Jugendfreundes ein Kleid aus schwarzem Samt mit einem altmodischen Spitzenkragen, das sie sich von Zilja Jakowlewna geliehen hatte, ihre Haare hatte sie zu einem mächtigen Knoten aufgetürmt. Sie lächelte.
»Ich habe ein gutes Gedächtnis«, sagte Brussilowskij und zuckte mit den Schultern. »Trotzdem, Moskau ist eine harte Stadt«, fuhr er fort. »In Moskau überleben, in Moskau berühmt werden! Oh ja, dafür muß man sehr stark sein!« Der skeptische Brussilowskij warf einen Blick auf den mageren Dichter, der eine schwarze Hose, eine Weste und ein weißes Hemd trug, und in dieser Kleidung einen noch zerbrechlicheren Eindruck machte. Man muß dazu bemerken, daß der junge Arbeiter, als er Dichter wurde, viele Kilos seines Arbeitergewichtes abgebaut hatte. Sein Gesicht war über dem Umgang mit intelligenten Büchern und den nervösen Diskussionen mit den Dichtern, den Malern und den Intellektuellen deutlich magerer geworden. (So formen sich, wie man sagt, die Gesichter der weisen Chinesen, die ihr Leben dem Studium des Reiches der Lüfte widmen.)
Gemeine Geister behaupteten, daß man für das abgemagerte Gesicht woanders eine Erklärung suchen mußte, daß »Anna den Dichter aussaugte«. Und tatsächlich, die kräftige, elastische und dicke Anna, mit ihrem kleinen Jungen neben sich, erweckte bei einem unparteilichen Beobachter solche schweinischen Gedanken. Aber wir werden erst später auf ihr Sexualleben zu sprechen kommen. Ihr Sexualleben war nicht das Wesentliche. Ed Limonow machte gewiß nicht den Eindruck eines starken Mannes, wenn man ihn aber näher betrachtete, konnte man an ihm eine gewisse Eigensinnigkeit wahrnehmen. Der Eigensinn ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger für einen Provinzler, der in die Hauptstadt gehen will, als das Talent.
»Wie alt ist Gubanow?« erkundigte sich der Dichter, er wollte sich neidisch mit dem Moskauer Genie messen. So hatte er sich früher an Motritsch gemessen. Melechow hat ihm erst kürzlich gesagt, daß er, Ed, ein viel originellerer und interessanterer Dichter als Motritsch sei. Ed hat sich das gemerkt. Obschon, was Melechow gesagt hat, ihn nicht verwunderte. Insgeheim hatte er Motritsch längst vernichtet.
»Gubanow ist zwanzig… Nicht ich ertrinke in den Augen des Kremls, sondern der Kreml ertrinkt in meinen Augen«, heulte Brussilowskij etwas näselnd — er wollte den Autor nachahmen. »Gubanow liest seine Gedichte auf eine überraschende Art. Er weint sie. Habt ihr schon einmal die Gesänge der nordrussischen Klageweiber gehört? Lonka jedenfalls weint nicht schlechter…«
Brussilowskij verabschiedete sich. Er reiste am nächsten Morgen ab. Wenn man seiner Jugendfreundin glauben darf, verabscheute er Charkow und seine alten Freunde, die ihn vor zehn Jahren gequält hatten. Er war nur gekommen, weil sein Vater einen Infarkt erlitten hatte. In Moskau hatte Brussilowskij sogar seinen Namen gewechselt, er unterzeichnete seine Zeichnungen in der Zeitschrift »Wissen ist Macht« mit dem Namen Brussilow.
»Und Igor?« fragte Brussilow noch auf der Türschwelle. »Ist er in seinem Simferopol untergegangen?« Freude blitzte in den Augen des berühmten Moskauer Malers auf. Man hatte den Eindruck, daß ihm von all seinen früheren Freunden Annas Ex-Gatte ganz besonders verhaßt war.
»Igor? Ich habe ihn angerufen, als Ed und ich nach Aluschta gefahren sind. Seine Frau hat abgenommen, und ich habe ihr gesagt, daß Igor, wenn er weiter beim Fernsehen arbeiten will, mir fünfundzwanzig Rubel nach Aluschta schicken soll. Und er war so nett, sie mir zu schicken!«
Brussilowskij lachte lange und umarmte Anna sogar. Soweit Ed in dieser Sache auf dem Laufenden war, waren diese fünfundzwanzig Rubel das einzige Geld, das Anna ihrem früheren Gatten je abgeluchst hatte. Wenn man ihr aber zuhörte, konnte man den Eindruck gewinnen, daß Erpressungen und Schutzgeldforderungen zu ihrer Haupteinnahmequelle geworden waren. Sie hatten diese kümmerlichen fünfundzwanzig Rubel an einem einzigen Abend im winterlichen Aluschta vertrunken.
»Wenn ihr in Moskau seid, dann ruft mich an. Ich werde euch interessanten Leuten vorstellen«, versprach Brussilowskij und ging. Die Mieter auf dem Flur, die an alles gewöhnt waren, schwammen über ihren Kochtöpfen.
Vom Fenster aus sahen sie den kurzen und stämmigen Moskauer im langen Wildledermantel schnell am Gebäude des Institutes für Kältetechnik vorbeieilen, sie sahen, wie er die Masse der zukünftigen Kühltechnikspezialisten durchquerte, die gerade zur Pause auf die Straße strömten, sie sahen seinen breiten Gürtel über dem dicken Hintern um die Ecke der Sumskaja-Straße wischen und dort verschwinden.
»Woran denkst du, Bach?« fragte Anna und setzte sich wieder, um endlich auch eine Pirogge zu essen.
»Wir müssen hin«, sagte Wagritsch. »Sie werden etwas enger zusammenrücken, sie werden bestimmt noch Platz für zwei übrighaben.«
»Für drei«, sagte Anna beleidigt.
»Für drei«, berichtigte sich Wagritsch.
11
»Studenten! Hören Sie sofort auf! Studenten! Steigen Sie von den Kamelen! Sofort! Miliz!« Ein hinkender Wärter, seine Beine sind etwas kurz geraten, läuft — völlig außer sich — am Gitter entlang und bläst in seine Trillerpfeife, die ihm am Ende einer Kette um den Hals hängt, spuckt die Pfeife wieder aus und schreit von neuem: »Studenten!« Plötzlich fängt er vor Kränkung und Ohnmacht an zu weinen, er weint und pfeift hinkend nach der Miliz.
Die »Studenten« (Fima auf dem Kamel und Lonka Iwanow auf dem Dromedar, von dem er absteigt, ohne sich lange bitten zu lassen) haben sich auf die Kamele gesetzt, und sie stellen sich vor, Lawrence von Arabien oder die Tuaregs bei der Durchquerung der Sahara zu sein. Die Kamele, genauso über die Dreistigkeit der »Studenten« erstaunt wie der Wärter, schnauben und wehren sich.
Mit Hilfe der ganzen »SS«-Bande ist es ihnen gelungen, die Kamele zu dem schwarzen Eisengitter zu locken, und dann haben sich erst Fima und dann Lonka auf die räudigen und abgeschabten Rücken der Tiere fallen lassen. Der dicklippige Tuareg-Jude Fima ist genau zwischen die Höcker gefallen, und nachdem er während einiger schrecklicher Minuten dem erschrockenen Tier widerstanden hatte, das ihn, schnaubend und ausschlagend, sofort in die gegenüberliegende Ecke des Geheges getragen hatte, war es ihm gelungen, das Kamel zu zähmen, obschon es hin- und hergesprungen war und versucht hatte, ihn mit seinen langen gelben Zähnen zu beißen. Er schlägt mit seinen Absätzen in die Flanken des Tieres und zwingt es, vor der »SS«-Bande auf der anderen Seite des Gitters zu paradieren. Iwanow hatte nicht auf Anhieb Erfolg. Der frühere Sergeant hat sich mit spitzen Schreien auf das Tier gestürzt, das daraufhin zur Seite gesprungen war, und Iwanow ist auf dem Kies gelandet, der in der Vorstellung der
Zoologen von Charkow den Boden der heimatlichen Wüste für die Tiere ersetzt. Nachdem er sich wieder aufgerappelt und seine verletzte Ferse gerieben hatte, schöpfte Lonka von neuem Mut und lief innerhalb der Umzäunung seinem Kamel hinterher. Fast wäre er unter die Hufe von Fimas Kamel gekommen, auf dem Fima, hoch oben in der Luft, glücklich lachte. Er versuchte, sein Gelbzähniges auf Lonka zu hetzen, der nur mit Mühe laufen konnte. Mit Hilfe von Viktor und Paul, die auch über das Gitter geklettert waren und die das Dromedar in eine Ecke der Umzäunung, zwischen einen Karren voll Heu und Eisenbahnschienen der Umzäunung gedrängt hatten, ist es Lonka gelungen, sich auf das Tier zu setzen. Nun schüttelt sich das Dromedar und zeigt sich viel weniger gefügig als das Kamel von Fima, wodurch es Lonka überhaupt keine Gelegenheit gibt, den Schrei des Muezzins in seiner getragenen Vortragsart auszustoßen: »Es gibt keinen Gott als Allah und Mohammed ist sein Prophet…!« Das schlaue und bösartige Tier beugt sich zur Seite, springt wieder auf und geht schließlich zur Taktik über, sich am Zaun zu bürsten. Das Tier ist entschlossen, sich der Laus Lonka in seinem Pelz zu entledigen, und fast hätte es ihm das Bein gebrochen, das zwischen den Gitterstäben eingeklemmt war.
Anna hält Genkas Weste in der Hand, Genka hat sich entkleidet und trägt nur noch Badehose und Schuhe, Ed hat eine blutrote Dahlie in seinem Knopfloch befestigt, alle sind betrunken und lachen lauthals, die Stirn gegen das Gitter gepreßt.
»Lonka, das Kamel will nichts von Ihnen wissen! Steigen Sie ab, bevor es Sie zerfleischt!« schreit Genka.
»Lenk nicht ab…« beharrt Lonka. »Ich bin ein Mensch, das ist ein Tier. Der Mensch ist der Herr der Schöpfung. Das Tier muß sich unterordnen.«
Das Tier knickt seine Vorderbeine ein und läßt sich auf die Seite fallen. Lonka, den dieses niederträchtige Manöver überrascht, fliegt mit den Händen voran im hohen Bogen auf den Kies. »Sauerei! Rotznase! Fettwanst! Krüppel!« Lonka ärgert sich und beeilt sich nicht damit, wieder aufzustehen.
»Gehen wir, Leute, oder?« meint Ed. Und er entfernt sich vom Gitter. »Gleich kommt der Wärter mit den Bullen.«
»Du hast recht. Gehen wir. Gehen wir da lang, Kinder.« Anna ist nicht betrunken und unterstützt den Dichter.
»Haben Sie etwa Angst, Eduard Wenjaminowitsch?« bemerkt Genka voller Ironie, während er Anna seine Kleider wieder abnimmt. Genka hat im Tümpel der Nilpferde ein Bad genommen. Genka wollte sich im Nilpferdpool etwas erfrischen. Die Haut an Genkas linker Schulter ist ganz aufgekratzt, das grobe Nilpferd war zu nah an seinen Besucher herangeschwommen und hat ihn berührt. Genka behauptet, er habe dem Nilpferd, dessen Haut so rauh wie Schmirgelpapier sei, gut gefallen.
»Ich habe keine Angst«, verteidigt sich Ed und rückt die Dahlie in seinem Knopfloch zurecht — »aber Gott schützt die Vorsichtigen, wie meine Großmutter sagte. Du weißt ganz genau, daß ich es mir nicht erlauben kann, mich von den Bullen festnehmen zu lassen. Ich habe schon seit zwei Jahren keine feste Arbeit mehr. Und man fackelt heute nicht lange mit den Parasiten. Für dich ist das was ganz anderes, offiziell bist du noch Student am Polytechnikum…«
»Schon gut, dann gehen wir eben.« Genka gibt nach.— »Aber du machst dir grundlos Sorgen. Ehe dieses Hinkebein zu seinem Unterstand gekommen ist und mit der Miliz zurückkommt, haben wir bereits in aller Ruhe im ›Automaten‹ einen Kognak getrunken. Ich glaube nicht mal, daß er in seinem Häuschen ein Telephon hat.«
Viktor wirft lachend die Flasche weg, die sie gegenüber vom Kamelkäfig im Wolfszwinger getrunken haben. Sie fliegt über die Köpfe von zwei grauen Wölfen hinweg, was diese lautlos mit ihren weißen mondglänzenden Augen verfolgen, und zerschellt an einem künstlichen Felsen. Die Wölfe ziehen sich schnell zurück in die Nähe ihres Schlupflochs. Beim Laufen bewegen sie sehr ruhig den Schwanz hin und her. Ed macht eine Grimasse. Viktor ist scheußlich, wenn er betrunken ist. Bloß Genka bleibt immer der gleiche. Er bleibt von einer unerschütterlichen Höflichkeit. Bachtschanjan ist der schlimmste von allen, wenn er betrunken ist. Ein richtiger Kamikaze. Ein Wunder, daß er überhaupt noch lebt. Eines Tages, als er zwei Gläser Wein getrunken hatte, war er so betrunken, daß er seinen Freunden entwischt und im Galopp die Sumskaja-Straße hinuntergelaufen war und geschrien hatte: »Ihr Kommunistenhuren!« Man hatte ihn festgenommen. Zufällig hatte Motritsch die Festnahme beobachtet und war sogleich in den »Automaten« gekommen. »Sie haben Bach festgenommen!« Alle Dekadenzler, die sich im »Automaten« befanden, die Intellektuellen, die Dichter und die Maler, bestimmt fünfzig Leute zusammen, waren zum Hauptquartier der Miliz neben dem Spiegelbrunnen gestürzt, Bach wäre andernfalls wohl kaum dem Gefängnis entkommen. Der anerkannte Dichter Arkadij Filatow, der Vosnessenskij von Charkow, hatte seine Mitgliedskarte des Schriftstellerverbandes gezückt und es nicht ohne Schwierigkeiten geschafft, die Miliz zu überreden, Wagritsch freizulassen. Bach hatte Glück gehabt: das alles hatte sich um sechs Uhr dreißig abends abgespielt, nach Arbeitsschluß, und der »Automat« war voll mit seinen Freunden. Bach hätte ja schon um vier Uhr nachmittags betrunken sein können… Uff, man kann sich kaum vorstellen, was ihm dann widerfahren wäre.
Ein anderes Mal hatte dieser Kamikaze sich, als Genka, Ed und Fima dabei waren, an die Fahne neben dem Eingangstor zu einer Fabrik gehängt. Er hatte sie herabgerissen, einen kriegerischen Schrei ausgestoßen und war weggelaufen. Die anderen waren weniger betrunken und vor Schreck erstarrt, sie hatten nichts machen können und waren ihm schließlich hinterhergelaufen. Die Wärter waren aus dem Gebäude gesprungen, und wild schießend hatten sie die Verfolgung aufgenommen. Ob sie in die Luft schössen oder gezielt, war nicht auszumachen, niemand drehte sich um, und sie rannten wie Sprinter. Niemand holte sie ein oder verletzte sie. Wagritsch hatte die Fahne in das Wasser des Flusses Charkow geworfen, wo sie langsam und schwerfällig untergegangen war, nachdem sie sich mit dem schmutzigen Wasser vollgesogen hatte. Ein Armenier, ein Mann des Südens, sollte eigentlich eimerweise Wein trinken können, ohne betrunken zu werden… Nein, Bach durfte nicht trinken, er wurde dann völlig verrückt.
Genka zieht sich wieder an, und sie machen sich auf den Weg in die Schlucht. Wenn man einen Ort gut kennt, dann fällt es einem leicht, sich dort zu bewegen. Sie bleiben für einen Moment stehen, um die massige Anna über das Gitter zu heben.
»Ich schlage vor, das Gitter ein für alle Mal niederzureißen, damit wir endlich einen bequemen Eingang zum Zoo haben«, bemerkt Lonka.
»Diese Tunten werden es sofort wieder aufstellen«, brüllt Paul. »Sie kommen zu Dutzenden, diese Vertreter der herrschenden Klasse und stopfen dir dein Loch mit Schaufeln und Zement wieder zu.«
»Und obendrauf auf den noch feuchten Beton streuen sie Glassplitter«, lallt Viktor kichernd.
Beim Sprung über die Mauer in den Zoo hatte Anna sich einen Absatz abgebrochen, und nun geht sie barfuß. Wenn er von der Seite M'sieur Bigoudis Profil mit dem Doppelkinn, an dem eine Falte in die andere übergeht, und wenn er dessen dicke Nase ansieht — M'sieur Bigoudi geht gerade neben ihm —, erinnert sich Ed an Portraits von Pawel-Paul, die genauso schmierig und hängend wie sein Doppelkinn und in schreienden Farben gemalt sind. Der ehemalige Matrose benutzt in seinen Werken häufig das Gelb. An welche Krankheit erinnert das Gelb? fragt sich Ed. An die Paranoia?
Es wäre interessant zu erfahren, was der Doktor Wischnewetzkij über Paul sagen würde. Was er von Anna sagt, ist klar. Aber ist Paul normal oder nicht? Nach seinen Zeichnungen zu urteilen, nein, danach wäre er eher paranoid. Der Doktor Wischnewetzkij… Der Folterer von Eduard. Henker, Faschist und Wissenschaftler…
12
»Sie behaupten weiterhin, daß es Ihnen gut geht, Eduard?« Die blaßgrünen Augen des Doktors von der Farblosigkeit einer Mattscheibe ruhen ironisch prüfend auf dem Gesicht des ›Kranken‹. »Das wesentlichste Kennzeichen jedes Lebewesens von den primitivsten Wesen bis zum Menschen ist der Selbsterhaltungsinstinkt. Wenn Sie eine Pinzette in einen Wassertropfen tauchen, in dem sich Amöben tummeln, dann können Sie unter dem Mikroskop beobachten, wie diese primitiven Einzeller sich von der Pinzette entfernen, wie sie fliehen. Das ist die elementarste Darstellung des Selbsterhaltungsinstinktes. Sie, Eduard, verfügen nicht über diesen Instinkt. Sie haben versucht, sich umzubringen, indem Sie sich die Adern öffneten. Sie sind also krank…« Der Doktor wirft einen triumphierenden Blick auf den jungen Mann, der ihm in einem viel zu großen, verwaschenen Flanellkittel gegenübersitzt; die Beine seiner langen Unterhose schauen unter dem Kittel hervor, seine nackten Füße verlieren sich in riesengroßen Hausschuhen.
»In einer solchen Verkleidung würde jeder krank aussehen, Doktor. Wenn Sie solche Klamotten anhätten, dann würden auch Sie krank werden. Ich glaube nicht, daß ich krank bin.«
»Kein Geisteskranker gibt jemals zu, daß er krank ist.« Die feinen Lippen des Doktors deuten ein jesuitisches Lächeln an, und sein gestärkter Kittel knistert leicht, als er hinter seinem Schreibtisch aufsteht. »Fragen Sie Ihre Zimmernachbarn, ob sie krank sind. Jeder wird Ihnen antworten ›nein‹…« Der Doktor nähert sich dem Fenster und schaut in den herbstlichen Park. Hinter den Gittern zeigt sich ein trauriger, lauer und trüber Herbsttag ohne Sonne. Das Gebäude ist von einem großen Park umgeben, der Saburow-Datscha heißt. Einige Kranke in dunkelblauen wattierten Jacken harken das Laub vom Rasen.
»…Übrigens…« Der große und magere Doktor dreht sich um und schiebt anmutig mit einem Finger seine goldumrandete Brille die Nase hoch… »Übrigens haben Sie bisher noch nicht von den wahren Beweggründen Ihres Selbstmordversuches sprechen wollen.«
»Ich habe Ihnen doch gesagt, daß ich keinen Grund hatte. Nein…«
Letzten Endes glaubt Eduard, daß es besser ist, mit diesem Faschisten zu diskutieren, als mit den verblödeten Kranken auf dem Zimmer zu bleiben. Er ist jetzt schon zwei Monate in dieser Klinik. Vor einer Woche erst hat man ihn aus der Abteilung für gefährliche Verrückte entlassen, in die man ihn kurzerhand gesteckt hatte, in jener seltsamen Oktobernacht 1962. Einen Monat hat er inmitten der Paranoiker, Schizophrenen aller Art und schwer mitgenommenen Psychopathen aushalten müssen. Wegen »guter Führung« hat man ihn in die »ruhige« Hälfte verlegt. In der ruhigen Hälfte ist er auch von Schizophrenen, Paranoikern und Psychopathen umgeben, aber von stillen. Bei den stillen Verrückten hat außerdem jeder sein eigenes Bett. Bei den gefährlichen Verrückten mußte er die ersten zwei Wochen sein Bett mit einem viel jüngeren Jungen teilen, dessen Augen etwas wirr waren. Eines Nachts war Eduard aufgewacht, weil Wirrauge ihn am Schwanz kraulte. Er hatte ihm einen Kinnhaken versetzen müssen.
Bei den »ruhigen« Verrückten beschäftigte sich Doktor Wischnewetzkij mit Eduard. Jeden Abend ließ er Eduard zu einem Gespräch oder zu dämlichen Tests holen.
»Eben weil Sie die Gründe, die Sie zum Selbstmordversuch getrieben haben, nicht in ihrem Zusammenhang darstellen können, eben deshalb bleiben Sie hier, mein Kleiner!« Bloß die Augen des Doktors lächeln verhalten.
Seine Leidensgefährten (es gibt in Saburowa Leute mit Erfahrung, einige sind, bloß mit kurzen Unterbrechungen, schon seit zwanzig Jahren da) haben ihm erzählt, daß Doktor Wischnewetzkij aus ihm, Ed Sawenko, einen medizinischen Fall machen will und vielleicht sogar die Geschichte seiner Krankheit in einer Dissertation darstellen möchte. Die Stationsärztin von Doktor Wjatscheslaw Iwanowitsch Wischnewetzkij — Professor »Nina«, Nina Pawlowna — ist fast nie auf der Station, Wischnewetzkij kann daher machen, was er will.
Er ist machthungrig, diese Hure von Brillenschlange. Er will Stationsarzt werden, sagen die erfahrenen Kranken beim Nachtisch.
»Doktor, das ist mein Leben, nicht Ihres. Selbst wenn ich sterben wollte, wäre das doch bloß meine Angelegenheit! Und wenn ich Sie bitten darf, nennen Sie mich nicht mein Kleiner. Sie sind doch bloß sechs Jahre älter als ich. Lassen Sie mich hier raus, mein Verhalten ist einwandfrei. Kein einziger Pfleger kann behaupten, daß ich aufgeregt bin. Ich warte nun schon zwei Monate in aller Geduld. Nina Pawlowna hatte mir versprochen, mich zu den Festtagen im Oktober zu entlassen. Nun ist das Fest schon vorbei…«
»Wir werden Sie nicht entlassen können, solange wir nicht die Ursache oder die Ursachen für Ihr anomales Verhalten ergründet haben, Eduard. Wir können eine solche Verantwortung nicht auf uns nehmen. Wenn es Ihnen so leicht gefallen ist, Hand an Ihr Leben zu legen, dann können Sie schon morgen das Leben eines anderen gefährden, jemanden umbringen.« Doktor Wischnewetzkij betrachtet den »Kranken« mit dem ruhigen Lächeln eines Heiligen. Eine Locke seines hellen Haares ist über seine glatte und friedliche Stirn gefallen.
Der Kranke flechtet und entflechtet die Finger seiner Hände über seinen Knien. Doktor Wischnewetzkij gleicht jetzt einem Verbrecher — einem faschistischen Wissenschaftler aus Auschwitz, denkt der Kranke. Soll er ihm das sagen? Wenn ich ihm das sage, dann wird dieser Hurenbock mich möglicherweise nie aus diesem Gefängnis rauslassen. Dennoch überwindet das Rowdytum seinen Selbsterhaltungstrieb, der Kranke schlägt ein Bein über das andere, wodurch ein Stück des rosa Absatzes seiner großen Pantoffeln sichtbar wird, und er murmelt: »Wissen Sie, Doktor, Sie erinnern mich an die Nazi-Ärzte von Auschwitz. Ich habe solche wie Sie im Kino gesehen. Sie sind dazu bereit, tausende von Leuten für Ihre Experimente zu foltern, um die Richtigkeit ihrer Theorien zu beweisen.«
»Der Grund dafür, mein lieber Kleiner, ist bloß der Kittel. Das ist alles.« Kein Muskel regt sich auf dem Gesicht von Wischnewetzkij. »Der weiße Kittel ist das Symbol für meinen Beruf. Im weißen Kittel kann man genauso gut schaden wie retten. Der Kittel ist wie eine Militäruniform. Die Armeen erobern, unterjochen, aber können auch befreien. Bevor Sie zu uns gekommen sind, hatten wir in unserer Abteilung den Kranken Prijmatschenko. Ein Junge vom Land. Bei uns war er aus den gleichen Gründen wie Sie gelandet, ein Selbstmordversuch. Mit dem Strick. Bloß zufällig hat man ihn gerettet. Seine Schwester ist in die Scheune gekommen, um ein Gerät zu holen, eine Harke oder vielleicht einen Besen. Da hängt er. Man schneidet das Seil durch, man wiederbelebt ihn und bringt ihn zu uns. Er ist den ganzen Winter geblieben. Vorbildliches Verhalten. Im Frühling haben wir ihn entlassen und der Verantwortung seiner Eltern anvertraut…« Wischnewetzkij hält inne und wirft einen triumphierenden Blick auf den jungen Mann, der seinen Stuhl knarren läßt. »Zwei Wochen später erschlug er seine Schwester und seine Mutter mit der Axt… Da haben Sie es… Und nun kommen wir zurück zu unseren Tests… Wenn es Ihnen nichts ausmacht, gehen wir ins Labor…«
13
Eduard hat sich auf dem Bett ausgestreckt und betrachtet die Decke; wenn er sich der Stationsordnung unterworfen hätte, hätte er jetzt schlafen müssen. In der Vorstellung von Nina Pawlowna ist ihr Zimmer das »des Schlafs«, man behandelt sie mit Schlaf, alle vier. Statt dessen ergibt sich, den Kopf unter die Decke gesteckt, der riesige Georgier Awas der Selbstbefriedigung; der »Chronische«, Onkel Sascha, der schon seit achtzehn Jahren im »Hotel Saburka« lebt, wie er es liebevoll nennt, liest ein Buch; der Intellektuelle Michaijlow hingegen liest nicht und schläft, wie es das Reglement verlangt.
Saburka ist schlimmer als das Gefängnis, sagt sich Eduard. Im Gefängnis weiß man wenigstens, wo man dran ist, man verbüßt seine Strafe und kommt wieder raus. Hier weiß man nicht, wann man rauskommt. Und es gibt niemanden, bei dem man sich beschweren kann. Früher war es möglich, nach einer Unterschrift des Vaters, der Mutter oder eines anderen nahen Verwandten rauszukommen, sie übernahmen mit ihrer Unterschrift die Verantwortung für deine Entlassung, und sie verpflichteten sich, dich zu überwachen, damit du draußen nichts Illegales anstellst. Jetzt, seit Prijmatschenko, ist es unmöglich, ohne Erlaubnis rauszukommen. Eduard hat seinem Vater und seiner Mutter Angst machen wollen und ihnen all die schrecklichen Dinge erzählt, die er hier gesehen hat, sie waren einverstanden, ihn wieder mitzunehmen, aber die Verwaltung und sein persönlicher Arzt, Doktor Wischnewetzkij, haben es verweigert.
»Eh, Awas, hör auf, uns zu nerven! Ich ruf den Pfleger«, ruft Onkel Sascha, der sich von seinem Buch losgerissen hat. Unter dem mächtigen Körper von Awas geraten die Bettfedern immer stärker ins Schwingen.
»Laß ihn fertig werden, Onkelchen! Sonst wird er noch gewalttätig, langweilt sich, und das Sperma spritzt ihm aus den Ohren. Außerdem ist er ein Mann des Südens.« Eduard mag Onkel Sascha nicht, diesen Feigling. Awas, dieser enorme Riese, ist ein fröhlicher und rosiger Typ. Sein einziges Problem sind diese täglichen Onaniesitzungen, jeden Tag zur gleichen Zeit. In der Abteilung für gefährliche Kranke hatte Eduard viel schlimmere Sachen gesehen. Man sollte diesen Onkel Sascha, diesen Hund, einmal mit dem früheren Fliegerleutnant Igor Romanow zusammenlegen; der wichste vierundzwanzig Stunden am Tag und schrie dabei wie eine Katze, der man das Fell über die Ohren zieht. Und der Tatare Bulat, der nackt, mit den Federn aus seinem zerissenen Kopfkissen bedeckt, durch die Säle lief? Und die Katatoniker? Der fette Onkel Sascha ist ein Schuft…
Der Georgier stöhnt und beruhigt sich unter seinem Laken.
»Er ist fertig!« stellt Onkel Sascha verächtlich fest.
Es ist seltsam, sagt sich der junge Mann. Während er so schnell wie möglich hier raus will, erregt diese Idee bei Onkel Sascha bloß Schrecken. Nina Pawlowna behält ihn, weil sie ihn kennt, sie zieht es vor, »Chronische« zu behandeln, sie sind ruhig, und man hat weniger Ärger mit ihnen. Aber es gibt in der berühmten Klinik nicht genug Platz für alle Verrückten von Charkow, seiner Umgebung und aus der ganzen Ukraine, es sieht also ganz danach aus, daß man Onkelchen Sascha bald entlassen wird. Er hat Angst davor. Hier stopft er sich das Maul voll, wird gut und regelmäßig ernährt; abends schaut er sich im Gemeinschaftssaal das Fernsehprogramm an, er schläft gut, und, was die Hauptsache ist, er arbeitet nicht. Daß er seine Freiheit verloren hat, schert ihn nicht. Die Pfleger und die Ärzte lassen ihn übrigens den ganzen Tag allein spazieren gehen, wenn er Lust dazu hat, und zwar nicht nur im Hof, wie alle anderen normalen Verrückten, sondern er darf sogar in den Park, er kann zwischen den Gartenhäusern (auf dem Gelände von Saburka gibt es davon zehn bis fünfzehn) spazieren gehen, frische Luft atmen. Das ist kein Leben, das ist eine Himbeere.
»Onkel Sascha, laß mich an deiner Stelle in die Freiheit gehen, und du bleibst für mich hier.« »Unmöglich. Das ist nicht erlaubt.«
Altes Arschloch, denkt Eduard. Schlimmer als die Katatoniker. Die vegetieren wenigstens nicht aus freien Stücken, sie sind krank. Man flößt ihnen durch Schläuche irgendwelches Zeug in den Magen. Und die Katatoniker diskutieren nicht. Sie sind von der Krankheit ganz verblödet. Und dieses fette Arschloch, das nichts mehr vom Leben will. Er hat sich hingelegt, er liest ein Buch, und dann geht er Grießbrei mit Butter essen. Pff! Was für eine Scheiße! Und das ist nicht der einzige! In Saburka gibt es einen ganzen Haufen »Chronische«, aber nur sehr wenige wirken wirklich krank.
Oh, ja! Für ihn ist es unerträglich hier! Er verwünscht sich jeden Tag, sich die Adern geöffnet zu haben, um bei Walka Kurdjukowa Eindruck zu schinden. Rote Wangen hat sie, im Winter trägt sie eine Männer-Mütze auf dem Kopf, und seit sie neun ist, hat sie ihre Regel, die kleine Walka, bevor er in die Klinik kam, war sie seine Freundin…
Ihre Geschichte hat im Sommer am Kranich-Strand begonnen. Dieser sonnengebräunte Nichtsnutz von Ed und Walka, damals vierzehn Jahre alt, hingen dort, die Füße bis zu den Knöcheln im Sand, herum, oder legten sich auf den glühend heißen Strand, um sich am reißenden Wasser, das manchmal blutrot wurde, abzuknutschen. Der einzige Strand der Stadt lag neben der Gerberei, die ab und zu ihre giftigen Säfte in den Fluß leitete… Walka… Damals war gerade die Tereschkowa in den Kosmos geflogen, und der Vorname Walja war sehr in Mode. Bravo Walja/Bravo, bravo Walja/Bravo, bravo Walja/… sang ein polnisches Quartett oder Quintett aus den Lautsprechern, die den ganzen Strand entlang an den Masten hingen. Athletische Rettungsschwimmer ließen in den Booten ihre steinernen Muskeln spielen…
Sie kam oft, komisch, energisch und lustig wie sie war, unter sein Fenster, solange er in der Abteilung für gefährliche Verrückte war, sie unterhielten sich durch das Gitter. Walka rief ihm zu: »Sei nicht traurig, Ed, du kommst bald raus!« Die Verrückten gingen schnell wieder ins Bett, um sich, nach einem Blick auf sie, einen runterzuholen, Walka war kräftig und gut gebaut. In der ersten Zeit waren der psychopathische Jude Sorik, der in der Abteilung für gefährliche Verrückte Mafiachef war, (der angeschnittene Eduard wurde schnell und bereitwillig in die Mafia aufgenommen. Ja, lieber Leser, sogar in Irrenhäusern werden Mafias gebildet!) und seine Jungs den Wichsern hinterhergelaufen, um ihnen eine Abreibung zu verpassen, »weil sie das Bild des Mädchens, das unser Freund hebt, beschmutzt hatten«, wie Sorik es nannte. Dann hatte Ed aufgehört, auf diese Kindereien zu achten, und Walka kam nur noch dann und wann. Seit Ed in der Abteilung für »ruhige« Verrückte untergebracht ist, ist sie noch kein einziges Mal gekommen. Das ist traurig.
Man weiß übrigens nicht, ob er sich gerade wegen Walka die Adern aufgeschnitten hat. Schwer zu sagen, warum er es getan hat. Als er sie am Abend vor »dieser« Nacht verlassen hatte, hatte er auf ihr »Wir sehen uns morgen, ja?« geantwortet: »Wenn es ein morgen gibt…«. Und warum hatte er das gesagt? War Walka ihm womöglich gleichgültig geworden? Die Eltern von Walka versuchten damals, ihre Beziehung zu beenden. Der Vater und die Mutter von Walka waren zu seinen Eltern gekommen. Sie hatten geschrien, gedroht… Degenerierte… Raissa Fjodorowna hatte sie vulgär gefunden.
Hauptmann Silbermann hatte ihn zur Miliz vorgeladen, in die Abteilung für Minderjährige, und hatte ihn vor einer Beziehung zu einer Minderjährigen gewarnt. »Wenn Oberstleutnant Kurdjukow es will, läßt er dich ins Gefängnis stecken«, hatte Silbermann gesagt. »Ich warne dich im Namen unserer alten Freundschaft, Eduard. Weil ich dich schon seit acht Jahren kenne… Gibt es in Saltow nicht genug volljährige Mädchen?« hatte Silbermann interessiert gefragt.
»Walka ist erwachsener als die Volljährigen.« Eduard hatte sich aufgeregt. »Sie ist sogar viel erwachsener als ihre ältere Schwester Viktoria. Sie ist frühreif.«
»Du hast recht«, hatte Silbermann seltsamerweise gemeint. »Ich bin deiner Ansicht. Ich habe sie gesehen. Sie hat schon die Formen einer Frau. Aber Gesetz ist Gesetz. Sie ist vierzehn. Und das Gesetz bestraft eine Beziehung zu Minderjährigen sehr streng.«
»Aber ich bin doch auch minderjährig…«
»Leider bist du es nicht mehr, Dichter.« — Silbermann hatte gelächelt, und sein kleiner Schnurrbart unter seiner langen Nase hatte sich aufgerichtet.
»Wenn mich nicht alles täuscht, dann bist du im Februar achtzehn geworden. Du bist nicht mehr minderjährig. Du hast sogar nicht einmal mehr Anspruch darauf, in mein Büro vorgeladen zu werden. Für dich ist jetzt eigentlich die Abteilung für Erwachsene zuständig.« Silbermann lehnte sich zufrieden in seinem Sessel zurück. »Ich tu das nur wegen Walentina Kurdjukowa, ich habe mir die Angelegenheit auf Bitten ihrer Eltern vorgenommen, nicht wegen dir.« — Silbermann trommelte mit den Fingern auf den Tisch.— »Weißt du, daß man deinen Freund Kater begnadigt hat, daß er statt der Todesstrafe zwölf Jahre dafür bekommen hat?«
»Ich weiß. Ich dachte, er hätte fünfzehn Jahre bekommen…«
»Zwölf, das ist auch nicht schlecht. Außerdem wird er nicht damit rechnen können, wegen guter Führung vorzeitig rauszukommen. Er muß die Strafe ganz absitzen. Unter verschärften Bedingungen.« Silbermann schwieg. »Ich hoffe, daß ich dir damit Angst eingejagt habe.«
»Das ist ungerecht«, murmelte Ed. »Kater ist nicht einmal ein Krimineller, er ist ein Romantiker…«
»Da haben wir es. Ein ›Romantiker‹. Gesetz ist Gesetz. Da macht man keinen Unterschied…« Silbermann seufzte und begann offenbar, seinen eigenen Gedanken nachzuhängen. »Gut. Dann hau endlich ab. Hier will ich dich nicht mehr wiedersehen. Vergiß, wo Walentina Kurdjukowa wohnt!«
Eduard stand auf und ging zur Tür.
»Schreibst du noch Gedichte?« Die Frage von Silbermann erreichte ihn an der Tür.
»Manchmal…«
»Schreib weiter, hör nicht auf damit, du bist begabt. Und erinner dich an Kater. Es ist sehr einfach, sein Leben zu zerstören…«
Von den Erwachsenen abgeschreckt, sahen sie sich seltener. »Meine Eltern müssen sich erst wieder beruhigen«, sagte Walka. »Wenn du noch ein einziges Mal betrunken nach Hause kommst, dann leg ich ihn um, deinen Nichtsnutz!« hatte Walkas Vater gesagt und seither seine Tochter jeden Abend von der Schule abgeholt.
Walka war nur einmal betrunken nach Hause gekommen, und Ed hatte nicht einmal was damit zu tun gehabt. Sie waren zusammen auf die Geburtstagsfeier von Sascha Ljachowitsch gegangen. Ed hatte nicht einmal bemerkt, daß Walka sich betrank. Sie war nur wegen der Kognak-Champagner-Mischung zusammengeklappt. Selbst wenn Ed sich vorgenommen hätte, auf sie aufzupassen, wäre das bei der Menge von fünfzig Gästen, die sich auf die drei Zimmer von Sascha verteilten, unmöglich gewesen. Er hatte die weiche, schläfrige und lallende Walka nach Hause tragen müssen. Sie nicht nach Hause zu begleiten, sie allein zu lassen, wäre undenkbar gewesen. Sie wäre noch im Hausflur zusammengebrochen. Er hatte sie mit Müh und Not bis zur zweiten Etage getragen und neben der Tür zu ihrer Wohnung hingesetzt. Er wollte klingeln und dann weglaufen, er sah den Skandal schon kommen, aber Walka hatte sich vornübergebeugt und war auf dem Boden ausgeglitten, sie lief Gefahr, sich auf den Steinstufen zu verletzen. Ed hatte seine Freundin wieder aufgerichtet, und in diesem Augenblick war die ganze Familie aus der Wohnung gekommen: die Mutter, die ältere Schwester Viktoria und der untersetzte Oberstleutnant Kurdjukow mit seinem igligen Bürstenhaarschnitt in Unterhemd, blauer Armeehose und Pantoffeln.
»Dreckskerl!« Der Oberstleutnant hatte seine Fäuste erhoben. Die Mutter und die Schwester klammerten sich an seine Arme. »Was hast du mit meiner Tochter gemacht, du Dreckskerl?«
»Vater! Vater! Papa! Grischa, nicht! Grischa!«
»Du hast sie betrunken gemacht, Sauerei!« Der Oberstleutnant schleppte an seinen Frauen, wie ein verletztes Wildschwein eine Hundemeute hinter sich herzieht, und hatte sich auf Eduard gestürzt, der noch immer Walka festhielt.
»Komm nur her, komm nur!« hatte der junge Verbrecher geschrien und seine Hand in die Tasche gesteckt. In seiner Tasche hatte er ein Rasiermesser. Das Gesindel von Charkow, unter dem er aufgewachsen war, hatte noch nie vor den Alten Achtung gehabt.
Die Frauen im Schlepptau war der Oberstleutnant zurück in die Wohnung gegangen.
»Hau ab!« hatte Viktoria geschrien, Eduard am Arm gefaßt und versucht, ihn zur Treppe zu drängen. »Lauf, du Schwachkopf, was wartest du noch! Lauf, bevor mein Vater dich umbringt!«
»Das ist noch nicht entschieden, wer hier wen umbringt…« hatte der junge Mann gemurmelt.
»Ich… ich will, daß er bei mir bleibt…«, hatte Walka gesagt, die für einen Augenblick in die reale Welt zurückgekehrt und von neuem auf dem Boden ausgeglitten war. »Er soll mit mir schlafen!«
»Ich werde dich töööten!« hatte der Oberstleutnant gebrüllt und war mit einem Jagdgewehr aus der Wohnung gekommen.
»Vater! Grischa!« Die Frauen klammerten sich von neuem an ihren Mann.
»Meine Tochter… Dreckskerl!« Der Oberstleutnant hatte mit dem Gewehr angelegt. Eduard hatte Walka fallengelassen und rannte bereits die Treppe runter. »Paff!« war der Schuß an ihm vorbeigezischt und hatte das Glas in der Haustür zertrümmert.
»Was für ein Arschloch! Altes Arschloch!« fluchte der junge Mann und rettete sich aus dem Hauseingang in die Saltower Sommernacht. »Er hat absichtlich daneben geschossen!«
*
Hatte er etwa die immer deutlicher werdende Abkühlung aufhalten wollen, die ihn von Walka zu trennen drohte? Sich die Adern aufzuschneiden, um von neuem ihre Aufmerksamkeit zu erregen? Als er Walka geantwortet hatte »Wenn es ein Morgen gibt«, hatte Walka die Ohren gespitzt. »Was willst du damit sagen?« hatte sie gefragt.— »Daß es vielleicht nicht für jeden ein Morgen geben wird.« — »Hör auf, solche Dummheiten zu sagen«, hatte Walka gesagt. Die Leute denken immer, daß du Dummheiten sagst, bis du ihnen durch dein Handeln das Gegenteil beweist, hatte er sich gesagt, als er Walkas Hof verließ, um den herum noch ein Dutzend anderer Häuser stand, darunter auch das, in dem Boris Tschurilow wohnte. Als er den Hof verließ, hatte er Tolik Tolmatschew getroffen.
Tolik war schon mit der Zigeunerin Nastja zusammen, die er einige Jahre später heiraten sollte. Tolik lud ihn zu den Zigeunern ein. Im »Gastronom«, der gerade schloß, kauften sie einige Flaschen und zogen los. Die Zigeuner wohnten in dem Hof von Walka! Das Haus, in dem sie lebten, war ein alter Schuppen, den ein langer Korridor durchschnitt, von dem aus Türen zu den einzelnen Zimmern führten. Im Zimmer standen nur zwei Gitterbetten. Zu dieser Zeit zog der Stamm im Süden der Ukraine herum, und Nastja und ihre jüngere Schwester lebten allein in einem Zimmer. Im Winter, erzählte ihm Tolik, wohnten mindestens fünfzehn Zigeuner in diesem Zimmer. Nastja und ihre Schwester schliefen auf Matratzen, die sie direkt auf den Boden gelegt hatten, sie hatten sie von den Betten genommen. Eine Gewohnheit, erklärte Tolik.
Sie tranken Porto mit ihnen, knutschten herum und lachten die lange Nacht lang. Nastja sang und begleitete sich auf der Gitarre, und als die Nachbarn an die Wand klopften, begann sie, noch lauter zu singen. Sie lachten wie die Verrückten.
»Nimm Mascha«, hatte ihm Tolik gesagt, als er ihn auf den Hof begleitete. »Sie ist ein gutes Mädchen. Wenn eine Zigeunerin liebt, dann liebt sie… Das ist etwas anderes als deine Oberstleutnantstochter. Meiner Meinung nach hast du Mascha gefallen.« Tolik kehrte zu seinen Zigeunern zurück, und Eduard ging unter dem Blätterdach der vielen Bäume von Saltow durch die ihm vertrauten Straßen nach Hause zurück.
Er lebte damals wieder bei seinen Eltern. Oder, um es genauer zu sagen, er schlief einige Nächte in der Woche unter dem gleichen Dach wie sie.
Sein Vater war auf Dienstreise. Seine Mutter schlief. Er setzte sich zwischen seinen Tisch und den Fernseher, beschloß, einige Abenteuer von Julien Sorel zu lesen und zog »Rot und Schwarz« aus dem Regal. Seine Mutter seufzte im Schlaf und murmelte: »Bist du da? Geh ins Bett.« Und sie schlief wieder ein. Eduard begleitete Julien in das Zimmer von Madame de Renal und hatte zitternd vor Angst an seiner Seite den knarrenden französischen Parkettboden betreten.
Und dann geschah, was dieser karrieregeile Doktor Wischnewetzkij mit mangelndem Selbsterhaltungstrieb erklärte, einem Instinkt, über den selbst niedere Tiere verfügen. »Die Amöben weichen aus, wenn man eine Pinzette in ihren Wassertropfen taucht.« Eduard jedoch verließ weder sein Buch noch änderte er seinen Geisteszustand. Im Gegenteil, dieses starke und durchdringende Gefühl, das ihm die ganze Tragödie des Lebens, ihren Wahnsinn, ihre Verwirrungen auszumachen schien, gefiel ihm außerordentlich. Zu behaupten, daß er sterben wollte, wäre falsch. Vielmehr wollte er irgend etwas machen, auf die eine oder andere Art seine Existenz unterstreichen, sich davon überzeugen, daß er lebte…
Er entdeckte, daß eine Sicherheitsrasierklinge die Venen nicht durchschneiden kann. Die Klinge durchschnitt mit Leichtigkeit die Haut, glitt aber an dem dichten Gewebe der Vene im Ellbogen des linken Armes ab. In der klaffenden Haut war die Vene — blau, glitschig und elastisch — gut zu sehen, aber sie wollte nicht nachgeben, obschon Eduard sehr präzise ihr mehrere Hiebe mit der Rasierklinge versetzte. Also zog er sein gefährliches Rasiermesser aus der Tasche… »Rot und Schwarz« war auf der Seite geöffnet geblieben, wo Julien das Zimmer von Madame de Renal betritt. Man vernahm das Knarren der morschen Bretter des alten gewachsten französischen Parkettbodens. Eduard legte seine Hand auf das Buch, setzte die Klinge seines Rasiermessers an die Vene, und nachdem er sich abgewendet hatte, zog er sie zu sich. Eine Fontäne heißen Blutes leckte ihm das Kinn und ergoß sich zugleich über das Buch, den Tisch und den Fußboden. Mit dem Gefühl der Erleichterung desjenigen, der seine Arbeit getan hat, lehnte der junge Mann sich an den Tisch und wartete nun darauf, sich vollkommen seines Blutes zu entleeren. Wem hatte er versprochen, das zu tun? Es ist kaum wahrscheinlich, daß er es Walka versprochen hatte. Die Tochter des Oberstleutnants gefiel ihm. Es gefiel ihm, daß dieses rundliche und moderne Wesen von vierzehn Jahren auf seinen Pfennigabsätzen, die sich in den glühenden Asphalt bohrten, neben ihm ging und den Neid der anderen Jungs weckte. »Ein schönes Mädchen!« hatte einer gesagt. Trotzdem war es nicht die Existenz von Walka, die ihn dazu gebracht hatte, in dieser Oktobernacht zum Rasiermesser zu greifen, sondern es war eher die Abwesenheit einer namenlosen Frau, die Abwesenheit einer Seele…
Als schon viel Blut geflossen war, fiel er vom Stuhl mit dem Gesicht auf den Boden; er hatte es noch geschafft, sich mit seinen Händen abzustützen und verspürte nun eine seltsame Empfindung: Er schämte sich, seine Mutter zu wecken, die ihn dann in diesem Zustand sehen würde, und gleichzeitig sehnte er sich danach, sie aufzuwecken. Auf dem Boden ausgestreckt fühlte er, wie seine Arme und Beine eiskalt wurden, während sich in seiner Brust eine angenehme, sanfte und behagliche Wärme ausdehnte, und er verstand, daß er in dieser Wärme ganz verschwinden würde… Dann hörte er seltsame Geräusche, als wenn jemand mit durchlöcherten Gummistiefeln durch das Wasser und den Schlamm des Herbstes lief. »Flok, flok, flok«, schlug es in seinem Herzen. Der Boden vibrierte, zweifellos lief man hin und her. Und dann verlor er das Bewußtsein. Viele Jahre später erzählte ihm ein Arzt, daß man am Blutverlust nicht sterben kann, wenn man nur ein paar Venen an einem Arm aufschneidet. Sondern daß man, um dieses Ziel zu erreichen, zumindest die Venen an beiden Armen aufschneiden muß. Gut möglich.
Seine Mutter, Raissa Fjodorowna, war von dem Geräusch seines auf den Boden fallenden Körpers aufgewacht und hatte ihn mit dem Gesicht in einer Blutlache gefunden. Der Nachbar hatte eine Hose übergezogen und war zur Erste-Hilfe-Station gerannt, die, ein paar Häuser weiter, sich in der Nähe befand. 1962 gab es in Charkow nur wenig Telephone, das war eine Katastrophe. Die Sanitäter kamen einige Minuten später mit dem noch schlaftrunkenen Nachbarn zurück, hatten den Blutfluß gestoppt, dem jungen Selbstmörder eine Spritze gegeben und ihn auf einer Trage mitgenommen. Zuerst in die Chirurgie einer Klinik, wo man ihm eine Bluttransfusion gegeben und die Vene wieder zugenäht hatte, und dann mit besonderem Vergnügen nach Saburka.
14
Zehn Uhr abends. Man hört aus der Tiefe des Parks den Signalschrei von Kadik. Er kann nicht pfeifen. »Hu! Hu! Hu!« In Saburka gibt es keine Wölfe. Es ist albern.
Eduard wirft die Decke zurück. Er springt auf. Er ist bekleidet, zur Überraschung des fetten Onkels Sascha trägt er nicht seinen Anstaltskittel, sondern Zivil. Er trägt eine Hose und ein Hemd von Kadik. Unter dem Kopfkissen zieht er seine Schuhe hervor, streift sie über, unter der Matratze hat er noch seine Lederjacke. »Awas! Es ist soweit! Awas!« Er rüttelt den Georgier an der Schulter.
Awas steht auf und gähnt. Er schläft immer sofort ein, wenn er sich einen gewichst hat. Riesig, wie er ist, im Pyjama, der Pyjama ist sein eigener und gehört nicht der Klinik, nähert er sich auf nackten Füßen dem Fenster, ergreift mit der Hand eine Strebe des Fensterkreuzes und reißt es mit aller Kraft aus der Wand. Onkel Sascha beobachtet die Szene mit Schrecken. Er ist nicht eingeweiht worden. Er weiß nicht, daß das Fensterkreuz schon einmal entfernt und dann wieder eingesetzt worden ist. Awas lehnt mit Eduards Hilfe das herausgerissene Fensterkreuz an die Wand. Dann packt er eine bereits angesägte Stange des Gitters und biegt sie zur Seite… Dann eine zweite. Der junge Mann hat das Gitter mit einer Feile angesägt. In der Dunkelheit, durch die Scheibe eines weiteren Fensterkreuzes, erblickt Eduard das fratzenhafte und fröhliche Gesicht von Kadik. Eduard öffnet ohne Schwierigkeit das äußere Fenster, dessen Verankerungen bereits herausgerissen oder angesägt worden sind, und stößt es in Richtung zu Kadik auf. Der Wind und der aufregende Geruch des herbstlichen Parkes dringen in daß Zimmer. Onkel Sascha versteckt den Kopf unter der Bettdecke.
»Hallo, Alter!« Kadik steht auf einer Leiter. Die Leiter gehört nicht zum Programm. Allein Kadiks Kommen war vorgesehen. »Und nun trink, Alter!« Kadik reicht eine Flasche durch die Öffnung. Kognak. Ed nimmt einen tiefen Schluck und reicht die Flasche dem Georgier weiter, der sich mit Vergnügen bedient.
»Mach's gut, Awas! Danke!« Ed schüttelt kräftig die Hand des Georgiers.
»Ist doch nicht der Rede wert… Ich wäre auch gern abgehauen, aber Nina hat mir versprochen, daß sie mich diese Woche freiläßt. Das hätte also keinen Sinn, abzuhauen. Bleib gesund! Ich kann mir schon die Fresse vorstellen, die dieser Päderast von Wischnewetzkij morgen machen wird…«
Der junge Mann schlängelt sich durch das Loch und springt nach unten, weil er die Leiter nicht benutzen will. Es ist nicht hoch, bloß zwei Stockwerke. Kadik ist bereits runtergestiegen, zieht die Leiter von der Mauer und versteckt sie im Gebüsch. Je später sie entdecken, daß der Kranke Sawenko geflohen ist, um so besser. Awas hat versprochen, die Gitterstangen in ihre ursprüngliche Position zurückzubiegen und das Fensterkreuz wieder in die Wand einzusetzen.
Durch den Park wehen die Düfte des verhaltenen und schönen Herbstes von Charkow, der Pflanzen, die allmählich beim Herannahen des Winters sterben. Der starke und aufregende Geruch des Lebens.
»Gratuliere, Alter!« Kadik klopft ihm auf die Schulter. »Folge mir. Meine Kleine erwartet uns auf der anderen Seite der Mauer.« Kadik hält eine Lampe in der Hand. Eduard folgt ihm gehorsam auf den unsichtbaren Wegen durch die Nacht, wobei sie die Gebäude vermeiden, die an ein Gefängnis erinnern und hier und da zwischen den Bäumen hervorspringen. Wieder leben. Das war ein wunderbarer Ausbruch. Wirklich professionell. Normalerweise flohen die »ruhigen« Verrückten, die das Recht hatten, im Park von Saburka spazieren zu gehen, und nicht etwa die aus den Höfen, die perfekt durch drei Meter hohe Mauern gesichert waren. Ein Pfleger, der seit dreiunddreißig Jahren in Saburka arbeitete, bestätigte, das sei der schönste Ausbruch gewesen, den er in seiner Laufbahn erlebt habe.
Man nahm ihn aber schon am Vormittag wieder fest. Es stimmt, daß er einen groben Fehler begangen hatte, einen Fehler, den viele begehen, die aus dem Gefängnis oder aus einer anderen Zwangsanstalt ausbrechen; es stimmt, daß er nach geglückter Flucht zu seinen Freunden gegangen war. Er hatte mit Kadik und seinem Mädchen getrunken und war dann zu Tolik Tolmatschew schlafen gegangen. Es war unmöglich, sich im neun Quadratmeter großen Verschlag von Kadik bequem einzurichten. Außerdem hätte man ihn dort noch früher festgenommen. Dem Flüchtling war es gelungen, seinen Rausch auszuschlafen, als gegen neun Uhr morgens die Pfleger und die Miliz sich um das große Bett versammelten, in dem Tolik und er, jeder in seiner Ecke, schnarchten.
Seine Mutter hatte sie dorthin geführt. Tolik Tolmatschew war nicht der beste Freund von Eduard, sie waren daher erst zu ihm gekommen, nachdem sie schon ein Dutzend seiner Schulkameraden, sowie dann Kadik und sogar Walka Kurdjukowa aufgesucht hatten, was bei ihrem Vater einen denkwürdigen Wutanfall ausgelöst hatte.
»Sie! Sie haben Ihren Sohn verraten«, hatte der untersetzte Tolik, mit der Adlernase eines Banditen, vorwurfsvoll gesagt; er schielte zum Boden, zögerte und machte Raissa Fjodorowna Vorwürfe. Tolik hatte mit den Schultern gezuckt, wobei er boshaft grinste, er konnte nicht verstehen, daß eine Mutter ihren Sohn an die Bullen auslieferte. So stand er also da, an die Mauer gelehnt, nur mit einem Slip bekleidet, und strafte Raissa Fjodorowna mit Verachtung. Eduard zog sich währenddessen an.
»Schweigen Sie, Tolmatschew«, sagte der Leutnant, »oder wir nehmen Sie auch mit, weil Sie einen Kriminellen versteckt haben.«
»Was soll das heißen, einen Kriminellen…« brüllte Tolik. »Sie sollten besser die Richtigen einsperren als die kleinen Jungs zu verfolgen. Fünf gegen einen… Wie find ich denn das…« Sie gingen die breite Treppe hinunter. Das Haus, in dem Tolik wohnte, war groß und neu, sein Vater war Invalide, seine Familie hatte daher eine Wohnung in dem schönsten Gebäude von Saltow bekommen. Die Mutter hatte ihren Sohn an den Arm gefaßt und sich verteidigt.
»Ich habe dich nicht verraten, wie dein Freund sagt. Man wird dich noch heute freilassen, Endik. Nina Pawlowna hat es mir versprochen… Aber erst mußt du zurück, nur um einige Papiere auszufüllen… Eine bloße Formalität. Sie sind verantwortlich… Sie haben Angst. Nach diesem Prijmatschenko, der seine Mutter und seine Schwester umgebracht hat…«
Der Sohn hörte sich die Rechtfertigungen seiner Mutter an und dachte, daß es, wenn er jetzt die Treppe runterrannte, mit dem Teufel zugehen müßte, wenn sie ihn fangen würden. Er würde um die Ecke wetzen, über die Straße laufen und durch ein Loch in der Schulmauer schlüpfen. Auf dem Schulhof würde er sich gut verstecken können, er stand voller Bäume, und auf der anderen Seite des Hofes, hinter der Mauer, konnte man sich ohne Schwierigkeiten zwischen den Schuppen und Werkstätten davon machen…
Er floh nicht. Er glaubte seiner Mutter. Und bezahlte dafür sehr teuer. In Saburka steckte man ihn wieder in die Abteilung für gefährliche Verrückte. Die ganze Pflegerbrigade, der er in der vergangenen Nacht entkommen war, überwachte ihn nun. Sie begannen damit, ihn mit Handtüchern an sein Bett zu fesseln. »Wenn es die Professorin nicht gäbe, würde es mir ein Vergnügen sein, dir die Leber kaputt zu hauen, du dreckiger kleiner Scheißhaufen!« hatte der Oberpfleger Wassilij, ein glatzköpfiges Arschloch, geknurrt, wobei er sich über den gefesselten Flüchtling gebeugt hatte. Man bestrafte die Pfleger jedes Mal, wenn ein Kranker geflohen war, man strich ihnen ihre Prämie.
Man verordnete ihm eine Insulinbehandlung. Nina Pawlowna und Wischnewetzkij kamen nicht einmal mehr, um ihn zu sehen. Eine Schwester kam, die Pfleger fesselten ihn, damit er keinen Zucker aß, und sie spritzten ihn ab. Selbstverständlich brauchte er überhaupt kein Insulin, sie taten es nur aus Rache. Das medizinische Personal von Saburka rächte sich dafür, daß er es gewagt hatte, aus der Klinik zu fliehen. Man verordnete ihm jeden Tag eine höhere Dosis Insulin. Während es Eduard nach den ersten Spritzen noch gelang, das Gedicht »Der schwarze Mann« von Jessenin zu Ende zu lesen, konnte er später, am Rande des Komas, kaum noch eine Zeile aus dem Gedächtnis aufsagen.
Nach dem ersten Koma, als er völlig blöde eine Tafel Schokolade mit roter Grütze verschlang, sagte sich der unglückliche Flüchtling, daß diese faschistischen Ärzte ihn wohl kleinkriegen würden, wenn es ihm nicht gelang, so schnell wie möglich dort rauszukommen. Der Wahnsinn des Komas, den er bei den anderen bemerkt hatte und der sich jetzt auf ihn legte, hinterließ in den Hirnzellen, denen es an Zucker fehlte, nicht mehr rückgängig zu machende Spuren. Er hatte schon Leute gesehen, die eine Insulinbehandlung hinter sich hatten. Schwerfällig, schlaff, aufgedunsen und fett, ohne irgendeine Gefühlsregung zu zeigen, gingen diese Homunkuli immer zu zweit auf den Wegen des Parks spazieren. Sehr ruhig.
Am Sonntag sah er seine Mutter im Sprechzimmer; bis dahin hatte er sich geweigert, sie zu sehen, er beschuldigte sie des Verrats. »Geh zu Tolmatschew und bitte ihn, das nächste Mal mit dir zu kommen.«
»Zu diesem Banditen?« sagte seine Mutter. »Nein!«
»Geh hin. Du bist es mir schuldig. Du hast mich hier schließlich reingebracht.«
»Ich wußte nicht, daß sie dir Insulinspritzen geben würden…«
»Geh zu Tolmatschew und bring ihn mit!« Er stand auf und verließ das Sprechzimmer.
15
Tolik, bekleidet mit einer Schirmmütze und Regenmantel, einem weißem Hemd und Krawatte, die im Ausschnitt des Regenmantels zu sehen war, hörte ihn an. »Das ist schlecht«, bestätigte er. »Du sagst, daß sie dich jede Nacht kontrollieren kommen?«
»Ja. Jede Nacht mehrmals. Sie kommen bis zum Bett.«
Tolik überlegte. »Um in diese Abteilung zu gelangen, muß man erst vier Türen überwinden… Das sind ein Paar Türen zu viel…«
»Und nicht gerade irgendwelche! Außerdem überprüfen sie auch die Fenster. Von hier zu fliehen, ist etwas anderes, als aus dem Schlafhaus abzuhauen. Da gibt's nicht einmal Türen. Alles ist offen. Und hier sind immer mindestens zwei Pfleger auf dem Hur.«
»Die einzige Lösung wird sein, ihnen Angst zu machen. Wirklich Angst… Psychischen Druck auszuüben… Ich werde darüber mit den Freunden sprechen…« Tolik stand auf.
»Machst du es auch wirklich, Tolik?« flehte der Gefangene. »Ich bin am Ende. Sonst drehe ich bald vollkommen durch mit dieser Insulin-Sauerei. Ich habe schon daran gedacht, die Pfleger zu erwürgen. Ich stifte Grischa, den Psycho an, es zu tun.«
»Wir werden versuchen, dich rauszuholen«, sagte Tolik ernst. Er gehörte zu den zuverlässigen Leuten. Wofür er sich später eine lange Strafe einhandelte.
Sie kamen einige Tage später, in der Nacht. Sie entzündeten Feuer rund um das Gebäude und warfen Steine gegen die Fenster. »Ed!« schrien sie. »Laßt ihn frei!« und wieder »Ed! Ed!«
Er hatte den Kopf unter das Kopfkissen gesteckt und weinte. Sie waren gekommen! Das Gesindel ist gekommen! Das Gesindel von Saltow und vielleicht auch aus Tjura. Man hörte viele Stimmen, das Flackern des Feuers erhellte in der Abteilung für gefährliche Verrückte die Fenster. Es gab welche, die er nicht liebte, mit denen er sich sogar geprügelt hatte, andere, mit denen er befreundet war, mit denen er Coups gelandet, gestohlen und getrunken hatte, und noch andere, denen er täglich beim Tanzen, im »Gastronom« oder auf den Straßen begegnet war, und schließlich diejenigen, mit denen er zusammen zur Schule gegangen war. Was für Prachtkerle! dachte er im Dunkeln unter seiner Bettdecke und horchte auf die Schreie. Sie kamen ihm zu Hilfe. Sie waren wie zum Sturm auf das Winterpalais gekommen. »Ed! Ed!« Die Kranken schrien verstört. Die Pfleger und die Schwestern rannten hin und her. Mehrere hielten, für ihn unsichtbar, neben seinem Bett.
»Er schläft«, bemerkte eine Stimme.
»Er tut bloß so«, meinte eine andere. »Jegor hat die Miliz angerufen und den Arzt vom Nachtdienst geweckt.«
»Warum den Arzt vom Nachtdienst?« mischte sich eine aufgeregte Frauenstimme ein. »Alarmieren Sie die Miliz! Rufen Sie das neunte und das fünfzehnte Kommissariat an. Sie sollen sich beeilen. Sagen Sie, daß eine Bande von Rowdies uns angreift. Eine große Bande…«
»Öffne du bloß ein Auge«, flüsterte eine Stimme, die sich ihm näherte. »Und wir zerbrechen dir die Knochen, du Bastard!« Trotz der Drohung klang die Stimme beunruhigt.
Das Gesindel verschwand beim Eintreffen der Miliz, es zerstreute sich, es verschwand in den Büschen, den Gräben und den Ruinen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die auf dem weiten Gelände von Saburka übrig geblieben waren. Die zwei Milizwagen kurvten eine halbe Stunde lang um das Gebäude herum, wobei sie die Finsternis mit ihren Scheinwerfern erhellten, dann fuhren sie wieder weg.
Eduard, der sein Bett nicht verlassen hatte, schlief ein.
In der folgenden Nacht kamen sie wieder. Es gab wieder Feuer, Schreie, sogar ein Megaphon (zweifellos das Werk von Kadik), und sie zerschmissen alle Fenster der Abteilung. Am nächsten Morgen hatte der Kranke Sawenko die Ehre, zu Nina Pawlowna selbst gerufen zu werden.
»Eduard, wir werden Sie der Miliz übergeben, Sie werden wegen Anstiftung zu Meuterei verurteilt werden!«
Der Kranke setzte sich ohne Erlaubnis auf einen Sessel und betrachtete die Professorin arrogant. Zum ersten Mal seit seinem Koma fühlte er sich stark und selbstsicher. »Frau Professor, Sie sprechen wie ein Polizist vor der Revolution. Ich schlage Ihnen vor, in Ihr Lexikon das Wort ›Aufruhr‹ aufzunehmen. Wovon sprechen Sie übrigens?«
»Als ob Sie das nicht wüßten, spielen Sie nicht den Unschuldigen!« Nina Pawlowna wurde nervös; sie stand auf und lehnte sich auf ihren großen Schreibtisch. Mit ihrer Brille und den grauen rechteckig geschnittenen Haaren sah sie aus wie ein Komsomol aus den dreißiger Jahren. »Hier, sehen Sie sich das Ultimatum an, das Ihre Banditenfreunde gestern hereingeworfen haben!« Nina Pawlowna reichte ihm ein großes Stück rotes Papier, das man vielleicht ungeschickt von einem Plakat zum fünfundvierzigsten Jahrestag der Revolution abgerissen hatte. »Wenn ihr unseren Freund nicht freilaßt, ihr Wanzengezücht, dann kommen wir wieder und legen euer medizinisches Nest in Schutt und Asche! Und keine Miliz wird euch helfen können, ihr Mörder im weißen Kittel!«
Der Kranke zuckte mit den Schultern.
»Ich habe sie nicht darum gebeten. Sie machen es von allein.«
»Eduard, sagen Sie Ihren Banditen, sie sollen sofort ihre Streifzüge beenden. Das wird alles nur noch verschlimmern für Sie und Ihre Freunde. Die Miliz macht in der nächsten Nacht eine Razzia…«
»Wäre es nicht einfacher, mich freizulassen, wenn Sie Ruhe haben wollen?« bemerkte der Kranke unschuldig.
»Du glaubst doch nicht etwa, daß wir dich hier brauchen? Wir haben nicht genug Betten, die Leute stehen seit Monaten Schlange.«
»Dann lassen Sie mich doch raus, ein Bett wird frei und jeder ist zufrieden.«
Nina Pawlowna seufzte. »Und wer übernimmt die Verantwortung, wenn du rauskommst und jemanden umbringst? Man bringt dich zurück, in ein anderes Gebäude, und ich werde entlassen.« Nina Pawlowna nahm ihre Brille ab und sagte, während sie ihn von der Seite betrachtete: »Morgen kommt der alte Professor Archipow aus Moskau, ein Spezialist von internationalem Ansehen. Um einen besonderen Fall zu untersuchen, einen Mörder. Er ist damit einverstanden, auch dich bei dieser Gelegenheit zu untersuchen. Wenn er entscheidet, daß du für die Gesellschaft nicht gefährlich bist, dann werden wir dich entlassen… Und jetzt tu mir den Gefallen und befiehl deiner Bande, uns in Ruhe zu lassen. Die Kranken sind bereits vollkommen hysterisch, und ich spreche nicht einmal von den zerbrochenen Fensterscheiben.«
Ed bat darum, telephonieren zu dürfen. Er wählte die Nummer der Werkstatt, in der Kadik elektrische Küchengeräte reparierte. »Cadillac, ich bin's. Sag den anderen, alles ist in Ordnung. Hört auf mit den Operationen… Vielleicht morgen. .. Hoffentlich. Bis bald.«
Nina Pawlowna setzte ihre Brille wieder auf und sagte mit überzeugter Stimme: »Du wirst noch im Gefängnis enden.«
Professor Archipow, ein erschöpfter runzliger Alter mit dem einfachen Gesicht eines bäuerlichen Großvaters, hatte im Arbeitszimmer von Nina Pawlowna hinter dem Schreibtisch gesessen. Er hatte keine Krawatte umgebunden und trug ein dunkles kariertes Hemd und eine dicke Wolljacke.
Zu seiner linken Seite saß eine Chinesin in weißem Kittel und zu seiner rechten ein grinsender Neger, der sich deutlich von seinem weißen Kittel abhob.
»Guten Tag, Herr Dichter Eduard Sawenko!« Der Professor-Bauer erhob sich und streckte dem jungen Mann die Hand entgegen. Verwirrt ergriff der kranke Sawenko die Hand. »Das sind meine Assistenten.« Der Professor stellte die Chinesin und den Schwarzen vor. Die Chinesin und der Schwarze schüttelten dem Kranken die Hand. »Nehmen Sie Platz, machen Sie es sich bequem!«
Der junge Mann setzte sich und schlug ein Bein über das andere. Er fühlte sich wegen seiner häßlichen Krankenkleidung der Chinesin und dem Schwarzen gegenüber unwohl. Obschon die Pfleger ihm einen neuen Kittel, eine neue Unterhose und neue Pantoffeln gegeben hatten. Diese Scheinheiligen!
Der Professor Archipow betrachtete den Kranken, wobei ein sanftes Lächeln seine Runzeln überzog. »Ich habe deinen Krankenbericht gelesen, Dichter«, sagte er und ging plötzlich zum »Du« über.
»Und? Was haben Sie entschieden?« Der Kranke warf einen aggressiven Blick auf den Professor.
»Du bist ein Abenteurer«, sagte der Professor ruhig. »Aber das ist keine Krankheit, du hältst also unnütz ein Bett in den Mauern dieser ehrenwerten Einrichtung besetzt.« Der Schwarze und die Chinesin lachten, als ob sie Russisch verstünden. »Man wird dich heute entlassen.«
Der Kranke sah verblüfft den Professor an. Er hatte zwar erwartet, daß man ihn entlassen würde, aber doch nicht so… Der Alte betrachtete den Kranken zufrieden und erschöpft.
»Aber ich habe… ich habe einen Selbstmord versucht…«
»Das sind Dummheiten. Ich glaube nicht, daß du wirklich sterben wolltest. Zeig doch mal deinen Arm.«
Der Kranke krempelte den weiten Ärmel seines Kittels hoch und zeigte seine Narben. Der Professor berührte den Arm und lud mit einer Handbewegung die Chinesin und den Schwarzen ein, es ihm nachzutun. Er sagte ihnen etwas auf Englisch. Die Chinesin und der Schwarze stimmten zu und lachten. »Wer wirklich sterben will, kümmert sich nicht um die Eleganz seiner Wunden, mein Freund», meinte der Professor. »Sieh her, du hast nicht einmal die Vene richtig durchgetrennt, du hast sie bloß angeritzt. Du hattest Angst, zu weit zu gehen. Du wolltest leben und nicht sterben. Es ist möglich, daß du dich nicht erinnerst, aber glaube mir, es stimmt. Und du hast dich absichtlich vom Stuhl fallen lassen, damit deine Mutter aufwachte und dich ›rettete‹. Du wolltest die Aufmerksamkeit der Welt auf dich lenken, Dichter. Offenbar hatte man dir nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet…« Der Kranke schwieg und hörte dem seltsamen Professor zu. »Aber um die Aufmerksamkeit der Welt muß man kämpfen. Sich die Venen durchzuschneiden, ist bei weitem nicht das beste Mittel…« Der Professor lehnte sich in seinem Sessel zurück und schien, den Kopf zur Seite gewandt, Eduard zu bewundern. Sein Gesicht drückte Zufriedenheit aus. »Abenteurer… Abenteurer«, wiederholte er. »Ich liebe diese Menschen. Ich bin selbst ein Abenteurer«, schloß er. Und er stand auf. »Geh und mach nicht noch einmal solche Dummheiten. Man entläßt dich auf meine persönliche Verantwortung. Lebe, geh spazieren und erinnere dich an das, was ich dir gesagt habe…«
»Danke«, murmelte der Kranke, drehte sich um und ging. Was für ein erstaunlicher Alter, sagte er sich. Er hat schnell und genau alles erraten. Es stimmt, ich wollte nicht sterben. Ich hatte überhaupt keinen Grund, sterben zu wollen. Das Leben ist bloß langweilig… Übrigens war es in diesem Jahr sogar langweilig geworden, in den Läden klauen zu gehen… Abends kam sein Vater, er trug eine Militärmütze, und die zwei gingen im Schnee, der zu fallen begann, zurück nach Hause. Sein Vater blieb schweigsam. Vielleicht hatte der alte Archipow mit ihm gesprochen oder aber er hatte einfach beschlossen, daß es besser wäre, zu schweigen und nicht über Saburka zu sprechen.
16
Genka, Paul und Fima gehen zum »Automaten« und sind Lonka Iwanow dabei behilflich, sich zu waschen. Ed und Viktor begleiten Anna bis zum Parkausgang. Anna läuft barfuß, die Schuhe in der Hand.
Anna hat auch den zweiten Absatz abbrechen wollen, um nicht nach Hause gehen zu müssen. Sie hat Angst, daß Ed ohne sie wieder weggeht zu seinen Freunden, und daß sie eine Gelegenheit, sich zu unterhalten, verpaßt. Aber aus dem kaputten Schuh ragt ein riesiger Nagel, der sich nicht entfernen läßt, sie muß daher nach Hause und andere Schuhe holen.
Am Ausgang des Parks halten Ed und Viktor in einer Querstraße der Rymarskaja-Straße unter einer Akazie. »So. Geh du allein weiter. Ich muß mit Viktor reden. Wir treffen uns in einer halben Stunde im ›Automaten‹.« Ed, der den Arm um den Akazienstamm gelegt hat, dreht sich schnell um den Baum herum.
»Du kleiner Dreckskerl, willst du mich nicht die hundert Meter bis nach Hause begleiten?« Anna Moissejewna, ohne ihre Schuhe klein, rund, würdig und mißmutig, reibt ihren Hintern an einem Granitsockel, der am Eingang zum Park steht.
»Anna, nur keine Angst!« Viktor, glücklich und betrunken, erweist sich Anna gegenüber gefällig.— »Ich paß auf ihn auf.«
»Geht ihr wirklich zum ›Automaten‹?«
»Ja, wirklich. Genka ist übrigens schon da.«
»Natürlich. Wie könntest du auch deinen Freund Genka mehr als eine Viertelstunde allein lassen! Bei Anna dagegen macht es dir nichts aus, sie alleinzulassen! Anna die Märtyrerin!«
Die Märtyrerin dreht sich um und trabt in Richtung Rymarskaja-Straße. Ed sieht seiner Freundin nach, wie sie ihre Schuhe und ihre Tasche hin- und herschwingt und kommt zu dem Ergebnis, daß sie doch einen fetten Arsch hat. Er lächelt spöttisch. Der tapfere Ed.
»Soll ich dir sagen, wie man deine Anna nennt?« fragt Viktor lachend.
»Sag's.«
»Und du bist dann nicht böse?«
»Warum…«
Viktor zögert und streicht sich leicht über seine schmißnarbige deutsche Backe. »Zarenarsch«, sagt der Hitlerlehrer erleichtert und wird wieder unverschämt. Er lächelt boshaft.
Zarenarsch… Das ist nicht sehr schmeichelhaft, aber gerecht, denkt Ed. Und genauer betrachtet vielleicht doch schmeichelhaft. Zarenarsch.
»Vielleicht eher Zarinnenarsch«, erwidert Ed lachend. Anna vermutet, daß sie einen derartigen Hintern ihrer schlechten Verdauung verdankt. Ihr übriger Körper ist normal gebaut. Und die schlechte Verdauung kommt womöglich daher, daß sie Schizo ist…
»Anna ist ein Fräulein, wie es sich gehört«, bemerkt Viktor, wieder ernst geworden. »Sie ist schön. Auch ihr Gesicht. Ich brauchte auch so eine !«
»Mit Anna könntest du nicht zusammenleben. Sie mischt sich überall ein. Ich kenne dich gut, Viktor, du hebst es, wenn eine Frau an ihrem Platz bleibt.«
»Du hast recht«, stimmt Viktor freimütig zu. »Die intelligenten Fräulein regen mich auf.«
Ist Anna intelligent, fragt sich Ed. Weiß der Teufel! Manchmal, ja. Daß Anna gnadenlos schlau sein kann, ist unbestreitbar. Manchmal ist sie teuflisch sarkastisch, sei also mißtrauisch! Ed bekommt es weniger als die anderen zu spüren, sie liebt ihn, trotzdem hat sie ihm schon einmal gesagt, er habe einen Mund wie einen Hühnerarsch und seine Augen sähen aus, als hätte seine Mutter mit Streichhölzern zwei Löcher eingebrannt. Ohne sich um irgendwelche Regeln zu kümmern, kann Anna einem Sachen ins Gesicht sagen, die andere zu verbergen versuchen. In der Gesellschaft der Leute, mit denen sie verkehren, gibt es viele, die sie fürchten und verabscheuen. Sie ist eine harte Frau.
Ein leichter Augustwind kommt auf, unmerklich geht der Tag in den Abend über, Ed und Viktor laufen, ohne sich zu beeilen, die Sumskaja hinauf.
»Nebenbei, mein Lieber, du schuldest mir noch fünf Rubel für die letzte Französischstunde…«
»Nimm, solange ich es noch habe.« Ed zieht aus seiner Tasche die fünfzehn Rubel, die er bis jetzt nicht angerührt hat, und reicht Viktor einen Fünfrubelschein. Genka läßt es nie zu, daß Ed sein Geld ausgibt, solange er selbst noch was hat. Genka könnte gut ein Mäzen, ein Beschützer der Künstler sein.
»Gehen wir zum Imbiß? Ich möchte was essen. Wir nehmen eine Fleischpirogge. Ich lade dich ein«, schlägt Viktor vor. Sie laufen quer durch den Taras-Schewtschenko-Park.
Viktor hat nicht viel Geld. Er trägt Sandalen, die Ed um nichts auf der Welt je anziehen würde. Ed hat ihm eine Khaki-Hose genäht, um damit seine Französischstunden zu bezahlen. Tatsächlich weiß Ed nur sehr wenig über Viktor, er hat ihn nie in Tjura besucht. Wenn man jemanden nie besucht und nicht einmal seine Sachen gesehen hat, kann man kaum was über ihn sagen. Genauso wie die Persönlichkeit von M'sieur Bigoudi thront die von Viktor auf einem linguistischen Sockel, auf dem Deutschen. Viktor ist über dieser Sprache aufgeblüht, der untersetzte, trockene, unermüdliche Lehrer von kleinen sportlichen Hitlerjungen zieht mit dem Mantel über den Schultern in den Kreuzzug. An der Spitze, mit einem Strohhut auf dem Schädel, erklärt Viktor den nacktbeinigen Hitlerjungen die Landschaft: »Das, meine Jungen, ist das Schloß von Teplitz… Der rechte Flügel ist zerstört. Als unser tapferer König Friedrich usw…« Viktor von Tjura. Ed hat ein Dutzend Jahre in der Nähe von Tjura gelebt und kannte seine Einwohner… Viktor ist etwas provinziell, auch wenn er es nicht will, er ist ein bißchen beschränkt.
Als sie wieder aus dem Labyrinth der großblättrigen Bäume des Parks herauskommen, der Park ist glühendheiß und staubig wie immer im August — es hat seit mehr als einem Monat nicht geregnet —, kommen sie am Taras-Denkmal vorbei. Der Mann mit dem herabhängenden Schnurrbart überragt die Bäume des Parks und schaut in einer dunklen Stimmung hinter sich. Mißfällt es ihm vielleicht, daß die Moskauer ihn nicht aus seiner heimatlichen Ukraine rauskommen ließen, daß sie ihn hier abgestellt und festgemauert haben? Sicherlich hatte dieser ehemalige Leibeigene, den man mit Gewalt in die Armee gepreßt hatte, einen schlechten Charakter gehabt. Unter ihm kann man seine Helden sehen, Katerina und die Banditen (heute würde man sie freedom-fighters nennen), und weiter unten verschwindet der Granitsockel unter den Herbstblumen, die gerade neu gepflanzt worden sind, den Chrysanthemen und Astern. Die Gärtner von Charkow sind außerordentliche Künstler. In aller Ruhe pflanzen sie mit ihren Blumen die Porträts der Führer. Sie pflanzen dir, wen du willst, Lenin, Stalin, Marx… Zu den Füßen von Taras könnte man eine Strophe pflanzen, irgendwas sehr Bekanntes, etwa von der Art
Der Kirschgarten neben dem Haus,
Die Totengräber brummen über den Kirschen…
Chruschtschow brummt nicht mehr über den Kirschen der Ukraine und Rußlands. Er wurde in dem Jahr gestürzt, in dem Ed bei Anna und ihrer Mutter eingezogen ist und als einziger Mann in einer jüdischen Familie zu leben begann.
Viktor und Ed laufen prahlerisch über den rissigen Asphalt. Viktors Ledersandalen und die Schnürschuhe des Dichters klacken energisch auf den Boden, als wenn sie zu wichtigen Geschäften gingen, während ihr Ziel doch bloß ein Imbiß ist. Sie steigen einige große Granitstufen zur Sumskaja hinunter, sehen nach links… nach rechts und überqueren die trotz ihrer Enge berühmteste Verkehrsader der Stadt. Vor sich sehen sie den alten zentralen Gastronom; zu ihrer Linken, gegenüber vom Gastronom, auf der anderen Seite einer kleinen Straße, die in die Sumskaja mündet, befindet sich in einem Souterrain der Imbiß. Er ist ganz neu, mit einem hellen Tresen aus Pinienholz. An der Wand sieht man ein Fresko, auf dem ein Ukrainer und eine Ukrainerin mit Schnüren und Bändern behängt, beide in Stiefeln, dabei sind zu tanzen. Man zahlt die Maler gut für solche Fresken. Es gibt keine Stühle, damit man seine Piroggen ißt und wieder geht, sonst würde man ja bleiben. Die Leute in Charkow lieben es sehr, festzukleben, es genügt, ihnen eine Gelegenheit zu geben. Ed und Viktor gehen nach unten ins Souterrain. Es ist so, als wenn man einen Imbiß aus Riga genommen und hierher transportiert hätte. 1964 war Ed in Riga, er weiß, daß es dort viele solcher Imbisse gibt.
Mit einem Dutzend anderer Konsumenten hängen sie über dem Tresen aus hellem Pinienholz.
»Guten Tag Viktor! Guten Tag Ed!« Der Besitzer eines nakkenlosen Schädels begrüßt sie unterwürfig und läßt für einen Augenblick seine Piroggen im Stich. Er heißt Viktor Suchomlinow. Er ist höflich, er hat eine lange Nase, er ist schüchtern und kichert in seine Faust hinein. Der Zeichner der Zeitung »Lenins Nachfolge« (der Sitz der Redaktion befindet sich etwa fünfzig Meter weiter oben in der Sumskaja-Straße) erinnert an einen Tschechow-Helden, den ein zweites Leben in die sowjetische Epoche verschlagen hat. Für Bach ist Suchomlinow trotz seiner modernistischen Einstellung kraftlos. Er ahmt ganz offen die polnischen Modernisten nach, die auch schon nicht mehr ganz taufrisch sind und die ihrerseits selbst andere nachahmen.
Suchomlinow kommt manchmal mit Milka, einem von Motritschs Mädchen, zum Tewelew-Platz 19; Milka und Vera waren in dieser Schneenacht im Park mit dabei, als Ed zum ersten Mal »einen lebenden Dichter« vernommen hatte. Mittlerweile hat sich Milka in eine gute Stute verwandelt: diese gute Frau, sie hat schwarze Haare und ist ein Meter achtzig groß, will sich verheiraten. Der Künstler bei »Lenins Nachfolge« hat gute Aussichten, eines Tages bei irgendeiner wichtigeren Organisation fest angestellt zu werden, er ist eine gute Partie, sagt sich Milka, aber sie langweilt sich mit Suchomlinow und würde lieber mit Motritsch trinken gehen.
Suchomlinow schiebt höflich seinen Teller zurück, auf dem noch einige Reste von Fleischpiroggen liegen, um ihnen Platz für ihre Teller auf dem Tresen zu schaffen. »Wie geht es Ihnen, Viktor?« fragt er zurückhaltend. Suchomlinow ist zurückhaltend gegenüber allem Fremden und Ausländischen, ob es sich um eine Zeitung, eine Hose, ein Paar Schuhe, ein Gemälde oder einen Stich handelt, aber auch gegenüber Paul und Viktor, die fremde Sprachen vollkommen beherrschen.
»Uns geht es good. Und Ihnen, Herr Suchomlinow?« fragt Viktor, verzieht das Gesicht dabei und schiebt Ed zwei Piroggen zu.
»Danke. Nicht schlecht.« — Der zartbesaitete Suchomlinow wischt mit einer Serviette sorgfältig die Winkel seines feinen lippenlosen Mundes ab. »Ich muß jetzt gehen, meine Herren.«
Er verfügt noch über die Manieren aus der Zeit vor der Revolution, denkt Ed. Vielleicht drückt sich darin der unsichtbare, aber machtvolle Einfluß seiner vorsintflutlichen Familie aus. Hieß nicht ein Minister der Provisorischen Regierung Suchomlinow? Oder war das noch ein Minister des Zaren? Es wäre interessant, in Erfahrung zu bringen, ob ein Familienname das Verhalten eines Mannes beeinflußt.
»Wohin verschwinden Sie so schnell, Herr Suchomlinow?« Ohne weitere Umstände verschlingt Viktor gierig eine Pastete, die er in beide Hände genommen hat. »Sie könnten Ihren Freunden doch noch ein Glas Porto anbieten.«
»Unglücklicherweise erwartet mich die Arbeit, meine Herren.« Suchomlinow lächelt zerknirscht. Und man weiß wirklich nicht, ob er nun sehr enttäuscht darüber ist, kein Glas Porto anbieten zu können, oder ob er zufrieden darüber ist, den beiden Freunden zu entkommen, die er für zu unternehmungslustig hält.
Als er sieht, wie der steife Viktor mit seinen kurzgeschnittenen Haaren, ohne Nacken, mit grauer Hose, einem Hemd und einem Pullover bekleidet, den Imbiß über die Treppe verläßt, die sich wie das typographische Zeichen für einen amerikanischen Dollar nach oben windet, schreit Viktor laut genug, damit Suchomlinow es noch hört: »Ich sage dir, Ed, mein Herz, dieser wortkarge Geizhals hätte uns gut eine Flasche Porto anbieten können. Wie oft ist er schon zu dir und Anna gekommen, um euch eure Zeit zu stehlen und euren Wein zu trinken?«
»Willst du einen Porto?« fragt eine Stimme von hinten. Die Jungen drehen sich um und erblicken einen betrunkenen Mann in weißem Hemd. Er hat das breite Gesicht eines vom Alkohol aufgedunsenen Blonden ohne Rasse. Sein Bürstenschnitt wirkt genauso altmodisch wie seine sackförmige Hose. Seine nackten Füße stecken in den gleichen Sandalen wie die von Viktor. Die Nägel seiner großen Zehen sind vollkommen schwarz, als wenn dem Säufer erst vor kurzem ein Panzerschrank auf die Füße gefallen wäre. Der Mann zieht eine Flasche aus seinem über der Brust offenen Hemd.
»Ah! Der dritte große ukrainische Dichter Kornijtschuk!« jubelt Viktor. »Da sagen wir nicht nein. Und woraus trinken wir?«
»Was is'n der für'n Etepeteter? Trink aus der Flasche!« Der sogenannte dritte große ukrainische Dichter drückt Viktor die Flasche in die Hand. Der Wein hat durch das Schütteln schon zu schäumen begonnen, vielleicht ist es aber auch bloß Sabber. Vom großen Dritten.
Warum spricht er dieses Kauderwelsch, das weder Ukrainisch noch Russisch ist? fragt sich Ed, der nichts versteht. Was für ein Trottel!
»Nein, Herr Kornijtschuk, warum sollen wir auf diese Wohltat der Zivilisation — das Glas — verzichten, wenn es nichts kostet, das Personal dieses Etablissements darum zu bitten?« Ohne die Flasche zurückzugeben, geht Viktor kühn zum Tresen, richtet einige magische Worte an eine junge Frau mit rosigen Wangen, auf der einen hat sie einen Pickel, und einem weißen Häubchen über, den Haaren, die gleich darauf mit drei Gläsern zurückkommt. Es ist verboten, in einem Imbiß alkoholische Getränke zu trinken. Aber weil man aus den neuen Fenstern des Imbiß direkt auf die gegenüberliegenden alten Fenster des »Gastronom« blickt, hat sich ein ständiges Hin und Her zwischen diesen beiden Orten entwickelt. Das Personal des Imbiß schließt beide Augen. Die Trinker essen Pasteten und lassen die Flaschen da, für jede Flasche gibt es zwölf Kopeken Pfand. Die Miliz schließt die Augen nicht.
»Im Feld, da verstehe ich es, Herr Kornijtschuk«, fährt Viktor fort, »wenn in einem Umkreis von Kilometern kein Glas zu finden ist, weil diese deutschen Hurensöhne alles mitgehen ließen und außerdem noch den Bruder Mikola umgebracht haben, da kann man aus der Flasche trinken…«
Die Jungen trinken das lauwarme Getränk. Ed läuft es kalt den Rücken runter, wenn er an den Schaum und Sabber in der Flasche denkt.
»Ihr spinnt doch, ihr seid wohl schwachsinnig geworden«, knirscht Kornijtschuk, »das ist alles der Einfluß der Moskauer und der Juden…«
Na, das ist mir einer! sagt sich Ed. Wo kommt der denn her? Kornijtschuk gehört weder zu den Dekadenzlern noch zu den Intellektuellen, und auch nicht zu den Mystikern, Physikern, Surrealisten, nicht einmal zu den Schwarzhändlern. Er gehört zur Bande um die Zeitschrift »Lenins Nachfolge«. Diese Komsomol-Zeitung erscheint in ukrainischer Sprache. Es gibt einen ganzen Kreis von Leuten, der sich um diese Zeitung gebildet hat. »Alles Wanzen«, wie sie Motritsch verächtlich nennt. Dennoch legt Motritsch gelegentlich die zweihundert Meter zwischen dem »Automaten« und »Lenins Nachfolge« zurück, um diesen Wanzen einige Rubel abzuluchsen. (Sogar der nakkenlose Suchomlinow und der andere Künstler bei »Lenins Nachfolge« — Krynskij —, die nach dem Standard des »Automaten« Langweiler sind, wirken neben diesen »Wanzen« wie Avantgardisten.) Die Wanzen gehen mit dicken Aktentaschen zur Arbeit, sie tragen staubige, weite Anzüge, die doppelt so weit wie nötig geschnitten sind. Sie erinnern an Vogelscheuchen. Und sie sprechen unter sich Ukrainisch, um die Sprache nicht zu vergessen. Um für den Fall, daß die Sowjetunion in verschiedene Republiken zerfällt, in den Wolkenkratzer des Gebietsparteikomitees, etwas weiter oben in der Sumskaja-Straße, zu ziehen und sich von dort in der ukrainischen Sprache, die sie bewahrt haben, an das Volk wenden zu können. Der Säufer Kornijtschuk gehört zu dieser Bande… Ed erinnert sich daran, daß Motritsch ihm einige Sachen über Kornijtschuk erzählt hat. Gewiß! Ein Band mit Gedichten von diesem rotgesichtigen Kornijtschuk ist in Kanada veröffentlicht worden. Und in Kanada, wo angeblich viele Ukrainer leben, hat eine nationalistische ukrainische Zeitschrift Kornijtschuk ›den dritten Dichter der Ukraine‹ genannt. Der erste war der Dichter aus Kiew, Viktor Korotitsch. Ed hatte die Gedichte von Korotitsch gelesen, sie waren ihm wie eine Übersetzung der Gedichte Jewtuschenkos ins Ukrainische vorgekommen. Kornijtschuk ist also der Dritte. Trinkt er vielleicht deswegen und sabbert in die Raschen?
Der Drittwichtigste nimmt ein Stück Pirogge von Viktor, zerkaut sie auf ekelerregende Weise und schlägt vor: »Nun Jungs, trinken wir weiter?«
»Nein«, antwortet Ed, der den fragenden Gesichtsausdruck bei Viktor bemerkt hat. »Wir müssen jetzt gehen. Man erwartet uns.«
»Ah, man spielt den Stolzen. Man erwartet uns«, äfft ihn der Drittwichtigste nach. »Die Jungs von der ›Lennach‹ ha'm mir gesteckt, daß du mit 'ner Jüdin lebst. Und du schämst dich nicht, eh? Du heißt doch Sawenko, ich weiß, daß du Sawenko heißt, wieso lebst du mit 'ner Jüdin. Du gehörst doch zu uns…«
»Du bist wohl verrückt geworden, mein Lieber?« meint Viktor sanft, wobei er Kornijtschuk leicht an die Schulter faßt. Als der sich daraufhin zu ihm umdreht, packt ihn Viktor mit seiner Rechten an der Kehle und rammt ihm mit einem Lächeln auf den Lippen die linke Faust in den Wanst.
Der Drittwichtigste fliegt quer zu einem Sonnenstrahl, der gerade durch das Fenster fällt, gegen die Wand. Staub tanzt nach dem Gleitflug des ukrainischen Dichters in dem Sonnenstrahl. Er bringt eine junge Studentin zu Fall, schwankt etwas, bleibt aber stehen, reibt seinen Adamsapfel und schreit: »Bringt mich um, aber ich werde nicht schweigen! Ihr hurt mit Jüdinnen rum und leckt ihnen den Arsch! Deine dreckige Jüdin hat dich mit ihrem Ausfluß berauscht, deshalb hast du vergessen, daß du Sawenko heißt, nennst dich Limonow und dienst den Juden!«
Und du bist ein dreckiges Schwein! Ein verfluchtes Schwein!« meint Ed wegwerfend. »Komm Viktor, er soll sich zum Teufel scheren!«
Viktor, der schon seinen Strohhut abgesetzt hatte, um ihn bei der Schlägerei nicht zu beschädigen, setzt ihn wieder auf; zur Erleichterung aller übrigen Kunden gehen sie die Treppe hoch. Der ukrainische Dichter stolpert ihnen nach.
Oben angekommen, neben dem Eingang zum Imbiß, brüllt Kornijtschuk, sein Hemd ist nun offen bis zum Bauchnabel und enthüllt seinen weißen Wanst: »Wach auf, Sawenko, wach auf! Du hast noch Zeit. Aber der Tag wird kommen, wo ich dich wie Taras Bulba (Kornijtschuk zeigt mit dem Finger auf das Denkmal des anderen Taras) richten komme! Und dann werde ich fragen: Haben deine Juden dir geholfen? Wach auf, Sawenko, beeile dich!«
Die Jungen lachen. Sie drehen sich um und gehen zum »Automaten«.
»Was hat er mit seinem Gerede über den Ausfluß gemeint, Viktor?«
»Die unwissenden Bauern glauben, daß man einen Mann verhexen kann, wenn man ihm Menstruationsblut zu trinken gibt. Sie sagen, daß die Zigeunerinnen und die Jüdinnen das tun…«
»Was für ein Langweiler! Aus welchem Loch kommt der her, dieser Kornijtschuk?«
»Vergiß es, Ed. Anna ist das zuverlässigste und verständnisvollste Fräulein, das ich je kennengelernt habe.«
»Anna hat keine Nationalität!« Ed ärgert sich plötzlich über diese Wanze, die neben dem Eingang zum Imbiß weiter ihren Porto säuft. Und auch über sich selbst, weil er nicht reagiert hat, um diese Wanze zu zerdrücken. Viktor hat reagiert, nicht aber er. Er hätte sich für Anna schlagen müssen. Genka und Bach haben recht, Ed Limonow ist vorsichtig geworden. Er hat Angst, den Bullen in die Hände zu fallen, das ist klar; er ist nicht nur ein Parasit, sondern er spielt auch noch den Schneider, ohne Steuern zu zahlen. Denken seine Freunde vielleicht, er sei ein Angsthase? »Anna ist degeneriert! Anna ist Schizo! Schizos kennen keine Nationalität. Anna haßt ihren Akademikeronkel, diese selbstzufriedene Nutte, und nennt ihn ihren ›Juden‹. Aber dieses Dreckstück!… Ich schwöre bei Gott, wenn ich den noch mal zwischen die Finger kriege…« Ed bleibt stehen und wirft einen Blick zurück zum Imbiß.
»Reg dich ab, Parteigenosse… Was du jetzt machst, heißt bei den Franzosen, in deren Sprache ich dich für fünf Rubel in der Woche unterrichte, Unterhaltungen auf dem Treppenabsatz‹. Bei uns heißt das ›Säbelrasseln nach der Schlachte Das nächste Mal schlag zu. Denk nicht nach. Das ist alles.«
Viktor hat recht. Er ist sechs Jahre älter als Ed, aber er ist naturverbundener geblieben. Unser junger Mann ist zu weit gegangen, vielleicht ist er zu intelligent geworden. Er hat die einfachen Gesetze von Saltow und Tjura vergessen. Schreiben und Lesen fördern das Zögern und verlangsamen die Muskelreaktionen, die eigentlich augenblicklich einsetzen müssen. »Schlagen oder nicht schlagen« — an die Stelle des bloßen animalischen Reflexes die Frage zu setzen, gehört bereits zur Philosophie.
»Hör auf, dich zu quälen, Parteigenosse.« Viktor tröstet ihn von neuem. »Ob du ihn nun geschlagen hast oder ob ich ihn geschlagen habe, was macht das schon aus? Wichtig ist allein, daß er was abgekriegt hat. Bach hat Tscherewtschenko auch nicht schlagen können. Dein neuer Freund ist, wie du weißt, anderthalb Köpfe größer als Bach und ein kräftiger Kerl, nur zusammen haben wir, die ›SS‹, ihn schlagen können.«
»Soviel ich weiß, ist er euch entkommen.«
»Nachher ist er uns entkommen, aber wir haben ihm eine Abreibung verpassen können. Fima hatte ihn zu Boden geworfen und M'sieur Bigoudi ihm mit seinen Beatles-Stiefeln in die Seite getreten und geschrien: ›Schreib keine Gedichte mehr, schreib keine Gedichte mehr!‹« Viktor lacht. »Erst nach seiner Ration Stiefeltritte in die Seite konnte unser Matrose sich befreien und ist in den Park geflohen. Er läuft schnell, dein Freund…«
»Wie soll ich das verstehen, Viktor? Bach und Sascha haben sich längst wieder versöhnt.«
»Das stimmt«, gibt Viktor zu und spuckt aus. »Scheiß drauf. Der Typ hat was drauf, aber bloß als Dichter. Er hat für die Irka von Bach ein Gedicht über die Hutgasse geschrieben. Bach hat es mir gezeigt. Er hat sich vorgestellt, Jessenin würde sich seine Hüte in der Hutgasse kaufen. Wegen der Hüte von Jessenin hat der Kleine Paul ihn mit den Stiefeln getreten.« Und Viktor ist neben dem Eingang zum »Automaten« stehen geblieben, um M'sieur Bigoudi zu beschreiben, wie er Sascha Tscherewtschenko in die Seiten tritt. »Schreib keine Gedichte mehr… Schreib keine Gedichte mehr…«
17
Im Frühling 1967 hatte Sascha Tscherewtschenko Ed auf eine Dienstreise mitgenommen. Warum? Aus purer Laune. Sascha hatte gerade den Literaturpreis des leninschen Komsomol bekommen und war nun für eine Zeitung aus Kiew, die »Prawda der Ukraine«, Sonderkorrespondent in Charkow. Um die Bedeutung dieses Postens verständlich zu machen, muß man wissen, daß die »Prawda der Ukraine« auf dem Territorium der SSR der Ukraine die gleiche Bedeutung hat wie die Prawda auf dem Territorium der UdSSR. Sascha war gerade sechsundzwanzig geworden.
Welche Verbindungen gab es zwischen dem superinoffiziellen Ed Limonow und dem superoffiziellen Sascha Tscherewtschenko, der seinen letzten Gedichtband der Besatzung des Kreuzers »Dserschinskij« gewidmet hatte, auf dem er nach dem Besuch der Hochschule der Kriegsmarine seinen Dienst versehen hatte, aus dem er aus gesundheitlichen Gründen entlassen worden war? Eine große Frage. Was verbindet die Leute miteinander? Gegenseitige Sympathie?
Ed erschuf sich ständig Idole. Wenn das Idol später seinen Hoffnungen nicht gerecht wurde, wenn er sich enttäuscht sah, dann wurde das Idol gnadenlos niedergerissen und durch ein neues ersetzt. Sascha übernahm den leeren Sockel, auf dem der Kroate Motritsch lange Zeit geherrscht hatte. Motritsch hatte sich unter den Augen von Ed leider aufgelöst, er hatte sich in einen versoffenen Penner verwandelt, der Rubel schnorrte und seinen Bekannten sogar Zwanzigkopekenmünzen aus der Tasche zog. Seine Gedichte dienten ihm jetzt als Mittel, sich Alkohol zu beschaffen. Alle menschlichen Wesen haben, ohne jede Ausnahme, wie die Pflanzen, ihre Jahre des Wachstums, der Blüte, und dann vertrocknen oder verfaulen sie, wenn der Boden zu feucht oder fett ist. Im Jahr 1967, als Motritsch der Liebling sowohl der Dekadenzler als auch der Kulturfunktionäre war, begann er sein Tageswerk mit einem Gang durch die Sumskaja-Straße auf der Suche nach etwas zu trinken. Später traf Sawenko-Limonow auch in Moskau — der Hauptstadt unserer Heimat — lokale Motritschs, und er wunderte sich nicht darüber, da das Leben ihm diese Varianten des Dichterschicksals bereits vorgeführt hatte.
Wie der menschlichen Pflanze Motritsch, so war auch Sascha Tscherewtschenko seine Zeit des Blühens und des Welkens vorherbestimmt. 1967 war Sascha gerade dabei, sich zu entfalten. Er war groß, die Länge seiner Beine übertraf bei weitem die der anderen Kunden von Ed, er hatte breite Schultern und einen breiten Mund, seine hellen kastanienfarbigen Lokken bildeten eine Kappe auf seinem Kopf, Sascha warf sich freiwillig in die Höhle des Löwen und akzeptierte es, dem jungen Mann als Idol zu dienen. Eduard Limonow konnte nicht ohne Idol leben. So wurde Sascha sein neuer großer Bruder.
Ein feiner, für Ed bereits sichtbarer Sprung machte das Standbild seines neuen Idols von Anfang an zerbrechlich. Obschon die Gedichte von Sascha nicht ohne Talent waren, gefielen sie ihm nicht. Sie schienen ihm gewöhnlich. Gedichte über das Meer, na und? Im Grunde sind solche Gedichte im ländlichen Charkow viel romantischer als in einer Küstenstadt. Unter den Gedichten von Sascha gab es sehr lyrische, traurige Gedichte. Aber wenn man sich das Ganze ansah! Tausende von Leuten schreiben solche hübschen Banalitäten, sagte sich Ed, wenn er seinen zeitweiligen Helden für einen Augenblick beobachtete. Und er erriet schnell, daß der da nicht lange ein Held bleiben würde.
Hier nun ein Beispiel für die Kunst des jungen Preisträgers des leninschen Komsomol:
Wenn die Strände sich leeren
Weil der Wind auffrischt
Wenn die einzige Boje tanzt
Nahe dem Kap…
Dann bemanne ich die Yacht
Werfe mein Ölzeug in das Cockpit
Und erreiche Jalta
Und gehe über den Strand,
Diese bewegliche Wüste
Republik der Medusen
Und der Plastikabfälle…
Was soll das, die öden Strände und die Abfälle und das alles? Wie großartig! Was soll das heißen, daß der Held von Sascha seine Yacht am Strand von Jalta verläßt, während er für Ed bloß ein einfacher, ordentlicher, handwerklich begabter Sowjetbürger ist und eben nicht ein schrecklicher malaiischer Pirat, geschweige denn ein romantischer Held… etwa von Bagritzkij.
Auf Annas Rat hin begleitete Ed Sascha auf seiner Dienstreise. Anna Moissejewna wollte, daß der kleine Dreckskerl eines Tages, und dabei kam es ihr nicht darauf an, wie nahe dieser Tag sei, aber eben immerhin eines Tages, zur offiziellen Kunst gehören sollte. »Tu dich mit Tscherewtschenko zusammen, Ed. Das ist ein guter Kumpel.«
»Guter Kumpel, das ist kein Beruf«, hatte er bissig bemerkt, aber »alles in allem« (ein Lieblingsausdruck von Anna) war er schließlich zu der Ansicht gelangt, daß Tscherewtschenko ein guter und sympathischer Typ war.
Anna hatte Sascha im »Poesie«-Laden kennengelernt. Die Dichter von Charkow waren der Meinung, daß sie mindestens einmal täglich in der Buchhandlung vorbeizukommen hatten. Die Offiziellen ebenso wie die Nichtoffiziellen. Im »Poesie«-Laden konnte man Motritsch und Arkadij Filatow sehen, oder auch Onkel Wassilij Bondar, den Autor der Gedichte »Partisanen auf dem Draht« (er hatte Auschwitz überlebt und starb betrunken unter einer Straßenbahn) und Boris Iwanowitsch Kotljarow — den Vorstandssekretär der Charkower Abteilung des Schriftstellerverbandes. Nein, nein, nicht nur die neuen Bücher lockten die Dichter. Vier junge Frauen, vier Musen arbeiteten im »Poesie«-Laden. Und jeder wurde von mehreren Dichtern der Hof gemacht. Tatsächlich dienten aber bloß drei Frauen der Libido der Charkower Troubadoure. Die vierte, die Brillenschlange Ljuda (auf ihr ruhte die ganze Arbeit, sie war ein richtiges Arbeitspferd, diese Muse!) war verheiratet, und jeden Abend kam ihr eifersüchtiger Jude mit ihren beiden Kindern sie abholen.
Der Sekretär Boris Iwanowitsch Kotljarow kam die Direktorin Sweta besuchen, sie war etwas nachlässig, hatte eine Stupsnase, war klein, und ihre Haare waren von einer nicht näher bestimmbaren Farbe. Der alte rote Säuferkopf von Boris ragte aus einem gepflegten Anzug, Boris trug eine Krawatte. Böse Zungen behaupteten, daß Sweta mit Boris Iwanytsch nur zum Wohle des Ladens ins Bett ging. Bis der ehemalige Gießereiarbeiter auftauchte, waren schon mehrere Dichter aus Charkow mit der Muse Anna Moissejewna Rubinstein gegangen. Oh Gott, im Frühjahr 1965 wurde die Muse Anna aus dem »Poesie«-Laden rausgeschmissen. Sascha Tscherewtschenko ging eine Zeit mit Walja, einer schönen fleischigen Ukrainerin mit Kirschaugen und mächtigen Schenkeln. Walja war die jüngste Muse, sie war zwanzig. Aber Tscherewtschenko ging nicht lange mit Walja, er überließ seinen Platz sehr bald einer ganzen Reihe von Schwarzhändlern. Die weitaus mutigeren, frecheren und reicheren Schwarzhändler teilten mit den Dichtern und den Dekadenzlern nicht bloß den »Automaten«, sondern auch die Schönheiten von Charkow. Die Schwarzhändler errangen leichte Siege über die Dichter. Die Schönheiten ließen die Dichter im Stich und liefen zu jenen über. Nähere Einzelheiten über die Schwarzhändler wird der Leser später noch erfahren. (Niemals hatte Anna Moissejewna Rubinstein sich soweit erniedrigt, daß sie mit den Schwarzhändlern eine Beziehung eingegangen wäre.) Manchmal, wenn er schlechte Laune hatte, verdächtigt Ed Anna, daß sie ausnahmslos zu allen Dichtern Charkows sexuelle Beziehungen unterhalten hatte, sogar mit Boris Iwanowitsch Kotljarow und Sascha Tscherewtschenko. (Nebenbei erinnert sich unser Held erst nach einem halben Jahr tagtäglicher Begegnungen mit Kotljarow im »Poesie«-Laden an ihn. Dieser Kotljarow hatte dem fünfzehnjährigen Sawenko irgendwann mal die Sieger-Urkunde in einem Dichter-Wettbewerb überreicht…) Als Anna seinerzeit Ed Tscherewtschenko vorstellte, hatte sie bemerkt: »Sascha ist der vielversprechendste junge Dichter von Charkow… Er hat mir den Hof gemacht…« Ed war ihr böse deshalb, und damit sie nicht anmaßend würde, hatte er sie später am Abend im Hinterzimmer des Ladens genagelt. Anna war hinterher sehr befriedigt, obschon Ed aus Furcht vor den Schritten der Käufer auf der anderen Seite des Vorhangs und vor der Direktorin Sweta, die von einer Minute zur nächsten hereinkommen konnte, sehr schnell abgespritzt hatte. Tscherewtschenko, den Ed zum ersten Mal am Arm der schönen Walja gesehen hatte, und Ed waren lange Zeit aneinander vorbeigelaufen. Sie wechselten manchmal ein paar Worte im »Automaten« oder bei den Dichtersoireen und warfen sich freundliche Blicke zu. Daß Ed zu den »SS« gehörte, schien Sascha nicht zu stören. Der Überfall der »SS« auf Tscherewtschenko hatte sich übrigens ereignet, bevor Sawenko in der Charkower Szene aufgetaucht war. Die Beziehungen zwischen Bach und Tscherewtschenko waren schon lange geregelt, umso mehr als 1966 Wagritsch und Irina Mann und Frau wurden. (Die Hochzeitsnacht verbrachten die Jungvermählten im Zimmer am Tewelew-Platz 19 auf dem Fußboden, wo sie sich mit dem zweckentfremdeten Mantel von Eds Vater zudeckten.) Im Februar hatte das Schicksal Ed und Tscherewtschenko auf einen Schlag einander näher gebracht. Arkadij Filatow hatte Tscherewtschenko mit zu Eds Geburtstag gebracht. Tscherewtschenko war nicht eingeladen gewesen. Einundvierzig Gäste hatten zwischen Weinflaschen und Schaschliktellern auf dem Teppich gesessen. Der Schneider Limonow hatte am Vorabend auf dem Mariä-Verkündigungs-Markt ein halbes Lamm gekauft. Nachdem sie eine gewisse Zahl von Gläsern geleert hatten, schienen Limonows Gäste schlicht und einfach vergessen zu haben, wessen Geburtstag sie feierten, und hatten begonnen, das Modell der menschlichen Gesellschaft in verkleinertem Maßstab zu reproduzieren. Nach Mitternacht hatten sich im Viertel- und Halbfinale zwei Leader behaupten können: Jurij Miloslawskij, ein Dichter, der etwas jünger war als Ed, ein kräftiger schöner Jude, auf der Bühne und bei Rezitationen klang seine Stimme tief und wirkungsvoll, sowie der Vosnessenskij von Charkow, der Dichter Arkadij Filatow. Der Leser kennt aus eigener Erfahrung das Wesen des menschlichen Männchens. Der Wettbewerb und der Streit mit den anderen Männchen verschaffen ihm das größte Vergnügen in seiner Existenz. Die beiden Dichter bemühten sich, einander geistreich zu verspotten und das Eisen ihrer intellektuellen Lanzen zu schmieden, die mühelos die Steinäxte ersetzten.
Genka, ein Held des Halbschattens, beteiligte sich nie an öffentlichen Wettbewerben. Sascha Tscherewtschenko, der sich leise mit einer Freundin von Anna, der runden und blonden Tamara unterhielt, betrachtete von Zeit zu Zeit die beiden Streithähne und lächelte ironisch. Der Neugeborene war in Vergessenheit geraten und hatte sich in die letzte Reihe der Zuhörer verdrückt, gleich neben dem Schrank, und träumte heimlich von dem Moment, wo alle gingen. Er würde damit beginnen, Teller, Servietten und Schaschlik-Reste einzusammeln und die Zigarettenkippen zusammenzufegen. Er machte die Entdeckung, daß er nicht das geringste Interesse an seinem eigenen Geburtstag empfand. Er verspürte im Laufe dieses Abends überhaupt kein Bedürfnis, öffentlich den Geistreichen zu spielen. Letzten Endes hatten die beiden Streitenden sich doch bloß an das weibliche Publikum, an die freien und schönen Frauen gewandt. Der Gewinner des Schlagabtauschs würde mit dem Körper der Schönsten belohnt werden und mit ihr im dichten Februarnebel verschwinden. Ed mußte ohnehin bei Anna bleiben.
Tscherewtschenko war schon früh am Abend allein gegangen und hatte an der Tür Ed ein Zeichen geheimen Einverständnisses gemacht. »Ich würde gerne einmal kommen und deine Gedichte hören, Ed. Natürlich ohne diesen Haufen…« Er hatte auf die gezeigt, die blieben. Sie waren sich einig.
Einige Tage später kam er mit Filatow. Sie waren so häufig zusammen, daß man sie für enge Freunde hielt, was aber nicht der Wirklichkeit entsprach. Ed hatte ihnen sein Gedicht »Der Vogelfänger« vorgelesen. Dieses Gedicht, ein äußerst seltsames Werk, das den Kampf der Helden Alexander und Pawel mit dem Vogel »Vögelchen M.« erzählt, verblüffte die ohnehin nicht gerade übermäßig entwickelte Einbildungskraft der total normalen Genossen Tscherewtschenko und Filatow.
»So darf man nicht schreiben», sagte Filatow finster.
»Und warum?« fragte der Autor.
»Das sind keine Verse.«
»Warum sind das keine Verse? Es gibt einen Rhythmus und sogar richtige Reime.«
»Der Versbau ist ein Spiel, das seine Regeln hat. Du weigerst dich, die Regeln zu befolgen. Was du geschrieben hast, ist interessant, aber das ist keine Dichtung…«
Tscherewtschenko bedankte sich und sagte, daß er erstaunt sei. Sie hörten noch einige Gedichte von Limonow, und dann verdrückten sie sich finster unter dem Vorwand irgendeines Geschäftermins. Ed war bereit gewesen, weiter zu lesen.
Aber schon im Frühjahr lud Tscherewtschenko Ed ein, ihn auf einer Reise auf Kosten der »Prawda der Ukraine« zu begleiten. Sascha ist doch in Ordnung, dachte Ed daher. Dem Autor, der — zynischer als unser Held — sich daran gewöhnt hat, die Boshaftigkeit aufzudecken, die sich in jedem sympathischen Typen verbirgt, kommt es heute so vor, als ob die Einladung einen anderen Grund besessen hatte. Man könnte zum Beispiel vermuten, daß die beiden Dichter zwar verschieden auf das Gedicht, das sie beunruhigte, reagiert hatten, ihr Ziel aber das gleiche war: sich dieser sperrigen Verse zu entledigen, diese beunruhigenden Verse zu eliminieren. Arkadij Filatow hatte seine Sicherheit dadurch zurückgewonnen, daß er sie einfach der Nicht-Dichtung zurechnete. Tscherewtschenko aber hatte beschlossen, sich an ihren Autor ranzumachen. Den Autor zu »verschlingen« — und genau dadurch sich dieser fremdartigen Werke zu entledigen, um von neuem an sich selbst glauben zu können und weiter mittelmäßige Verse über die Republik der Medusen zu schreiben.
Der privilegierte Tscherewtschenko hatte selbst die Route seiner Dienstreise festgelegt. Charkow — Berdjansk — Feodosja — Aluschta — Jalta — Sewastopol. Eine kleine malerische Route, sehr angenehm und sonnig. Die Sonne und der Wind begleiteten sie auf der ganzen Reise. In Berdjansk gingen sie also bei sonnigem und windigem Wetter direkt zum Gebäude des Gebietsparteikomitees, das sie hinter einem General mit roten Seitenstreifen an der Hose betraten, der in einem blitzenden Auto vorgefahren war. Der unverschämte Sascha war dem General auf den Fersen gefolgt und hatte ihm Angst eingejagt. Der Photograph Ed trug vorsichtig einen vollgestopften Sack an seiner Seite, der allerdings kein Photomaterial, sondern seine persönlichen Sachen enthielt: seine Zahnbürste, eine Tube Zahnpasta, ein Handtuch, einige saubere Taschentücher, Unterhosen und natürlich einen Notizblock, auf dem der Dichter sich bemühte, seine Reiseimpressionen festzuhalten. Der Sekretär des Gebietsparteikomitees (der Erste persönlich) empfing den Sonderkorrespondenten der wichtigsten ukrainischen Zeitung und seinen Photographen, der einen sumpfgrünen Pullover trug, der ihm bis zu den Knien ging… Unglaublich, aber wahr, der Reisende trug auf seiner Nase eine neue Brille ohne Fassung, deren Gläser oben von einer goldenen Klemme gehalten wurden. Der Dichter wollte die Städte, in denen sie sich aufhalten würden, genau betrachten. Die Reise versprach, ein bedeutender Augenblick im Leben von Eduard Limonow zu sein, da er in sich die Kraft entdeckte, seine Brille auch in der Öffentlichkeit nicht abzusetzen.
Der Sekretär des Gebietsparteikomitees bedeutete ihnen mit einem sehr bitteren Lächeln, daß sie leider nicht das Boot nehmen könnten, um auf seinem teuren bewegten Meer Kaulköpfe zu angeln, da in diesem Jahr die Kaulköpfe nicht bis zu den Ufern des Asowschen Meeres gekommen seien und die unglücklichen Fischer sich nun mit anderen Fischarten begnügen müßten. Denn das Ziel von Saschas Reise waren die Kaulköpfe. Es war etwas Außergewöhnliches mit den Kaulköpfen passiert. Sie waren im Begriff auszusterben wie die wenigen Indianerstämme Amerikas. Dem Sekretär des Gebietsparteikomitees zufolge waren dafür der Plan, der den Fischern zu hohe Quoten abverlangte, sodann das Meer, das immer salziger wurde und schließlich die Fischer selbst verantwortlich, die, weil sie zu feinmaschige Netze verwendeten, lange Zeit viel zu junge Fische gefangen hatten. Sascha notierte die bitteren Klagen des Sekretärs, dann gingen sie in die Kantine, wo sie frittierte Kaulköpfe mit schön gelbem Kartoffelpüree aßen; sie nahmen ein Hotelzimmer und kauften sich Fahrkarten für das Schiff, das den nächsten Vormittag von Berdjansk nach Feodosija fuhr.
Das Asowsche Meer ist klein, und wenn es einen Sturm gibt, schaukelt ein Boot dort wie eine Plastikente, die ein Kind mit in die Badewanne genommen hat. Eine Stunde nachdem sie den Hafen verlassen hatten, brüllte und tobte das aufgewühlte Asowsche Meer unter dem Boot. Der frühere Matrose freute sich über den Seegang und ging ins Restaurant ein Gläschen trinken, während er Ed in der Kabine allein ließ. Leicht beunruhigt entdeckte der Avantgarde-Dichter, daß er nicht anfällig für die Seekrankheit war, daß er sich bewegen und nachdenken konnte und daß er überhaupt nicht kotzen mußte, wie er anfänglich befürchtet hatte. Ed ging also hinaus in das verlassene Restaurant, das Meer toste und stürmte gegen die gläserne Kabinenwand. Der Kellner sagte ihm, daß sein Freund gegangen sei, um in der Kabine des Kapitäns einen Kognak zu trinken. »Der Genosse Kapitänausbilder hat Ihren Freund eingeladen«, bemerkte der Kellner. In seiner Stimme schwang Respekt mit.
Der Dichter klopfte an die Tür der Kapitänskabine und fand dort einen rotgesichtigen Kapitän und Sascha, die dabei waren, Kognak mit einer Zitronenscheibe zu trinken. Die Seewölfe luden den jungen Rimbaud ein, mit ihnen auf den Sturm Windstärke sieben zu trinken, der vor den Bullaugen heulte. Es war plötzlich so finster geworden, daß man Licht anmachen mußte. Es war angenehm, Cognac zu trinken und auf der anderen Seite des Bullauges die Gischt spritzen zu sehen. Außer den Geräuschen der Wellen und dem Glucksen des Wassers hörte man die Türen und die Luken hart schlagen und das Boot in seinen Schotten ächzen und knarren.
Der Kapitän war ein Kapitän auf großer Fahrt, er hatte als Kapitänausbilder angeheuert (sein Überseeschiff wurde gerade überholt) und war mit der Ausbildung des Ersten Offiziers betraut, der das erste Mal das Asowsche Meer befuhr. Der Erste Offizier befand sich irgendwo auf der Kommandobrücke oder beim Steuer und war verängstigt. Der Kapitänausbilder dagegen hatte überhaupt keine Angst, trank Kognak und unterhielt sich mit Sascha über Port Said, wo sie beide gewesen waren, über die Azoren und andere wunderbare Orte; schon bei den bloßen Namen gluckerte der Kognak sanft in den Magen des Avantgardedichters. Die Seewölfe diskutierten gelassen, ermattet und snobistisch über alles, was sie in ihrem Seewolfleben gesehen hatten, und kommentierten die Vorzüge der Häfen und Bordelle der Welt. Das blütenweiße Hemd des Kapitäns, seine Krawatte und sein schwarzer Rock ließen das ganze festlich erscheinen und verliehen der Sauferei einen würdigen Anstrich. Und obschon der Avantgardist bereits die Krim, den Kaukasus und die asiatischen Republiken bereist hatte, erfüllten die Reiselust und die Sehnsucht nach anderen Orten von neuem seine Seele. Ich kehre zurück nach Charkow, und ich ziehe nach Moskau, dachte er. Bach wartet. Er ist schon in Moskau…
Feodosija roch nach Fisch, und staubige Akazien mit knorrigen Stämmen wuchsen in den steinigen Straßen. Im Restaurant servierte man ihnen eine Chartschosuppe, in der schwarze Oliven schwammen. Als er die Oliven und von der pikanten Suppe kostete, erinnerte sich der Dichter der Nähe zu Griechenland, das auf der anderen Seite des Schwarzen Meers lag, und an die geköpften Marmorstatuen, und er sagte sich, daß vielleicht auch Odysseus diese Suppe gegessen hatte. In Feodosija zogen die Einheimischen mit ihrer von der Sonne gegerbten Haut die Stühle auf die Straße, setzten sich vor ihre Haustür und betrachteten die Passanten. Die Steine waren wirklich Steine in Feodosija und nicht solche Pflastersteine, mit denen die Straßen Charkows gepflastert sind… Ein Pfau promenierte durch den Hof des Hauses, in dem sie übernachteten, und Ed entdeckte unter den Büchern in der Bibliothek ihres Gastgebers Romane von Hamsun und Freud-Übersetzungen.
In Aluschta betrank sich Sascha und geriet in einer Disco in eine Prügelei. Er kroch am frühen Morgen durch das Fenster, das Gesicht war blau und zerschlagen, und er schlief sofort ein, ohne sich vorher auszuziehen. Ed, der sich am Vorabend geweigert hatte, in die Disco zu gehen, hatte mißbilligend den Kopf geschüttelt, als er seinen alten Freund so übel zugerichtet sah, und hatte verächtlich geseufzt. Ein neuer feiner Riß war an der Statue seines Idoles zum Vorschein gekommen. Sascha wachte erst mittags wieder auf. »Woher hast du diese vernünftige Seite, Ed?« fragte Sascha, der auf dem Rücken lag, mit einem leisen Lachen. »Von deinem Vater? Von deiner Mutter? Von Anna Moissejewna? Warum habe ich nicht auf dich gehört gestern? Was machen wir jetzt?«
Die örtliche Jugend hatte ihn nicht nur verprügelt, sondern sich auch ein Vergnügen daraus gemacht, ihm die Taschen zu leeren. Das ganze Geld für die Dienstreise war weg. »Bewahre nie dein ganzes Geld an einem Ort auf…« hatte der erfahrene Ed bemerkt.
Wie gut auch, daß Anna, die erfahrene, ihm geraten hatte, »für alle Fälle« etwas Geld mitzunehmen. In Jalta schliefen sie in einem Zimmer mit sechs Betten, wo schon vier andere Kerle schnarchten.
Sie blieben einige Tage in Sewastopol. Der Avantgardist, der bis dahin kein besonderes Verlangen danach bekundet hatte, wollte die Ruinen von Chersones besuchen gehen.
In Chersones betrat der Dichter alte Grabgewölbe, entdeckte dort aber bloß einen frischen Scheißhaufen. Sascha hatte sich für ein Nickerchen hinter einer warmen Mauer, die ihn vor dem Wind schützte, hingelegt, während Ed zwischen den freigelegten Ruinen herumlief und versuchte, sich die Stadt voller Soldaten, Händler, Gladiatoren und Frauen vorzustellen. Frühjahrswolken zogen unaufhörlich am Himmel entlang und leerten sich gelegentlich in plötzlichen Regengüssen. Die Jahre, was ist das? überlegte der junge Avantgardist, während er über die rutschigen und glatten Steine der alten Festungsmauern kletterte und die großen trüben Salwasserpfützen betrachtete, die Chersones umgeben. Ziegen liefen in der Nähe herum, zwei schwarze und eine weiße, mit groben Stricken waren sie an einem vielleicht antiken Ring festgebunden, der in einen Stein eingelassen war. Was ist die Zeit? dachte der Dichter und betrachtete abwechselnd die Ziegen und die Wolken. Sascha stöhnte im Schlaf und zog, nachdem er sich umgedreht hatte, seinen Schal über die Nase. Warum gibt es ein »damals« und ein »jetzt«? Und warum kann das »damals« nicht noch einmal auftauchen, auch nicht für einen Augenblick? Soldaten in glänzenden Rüstungen kämen in Kolonnen durch die Festungstore zurück, Händler würden schreien, Gladiatoren sich in einen Kampf auf Leben und Tod stürzen… Warum ist das »damals« tot und zerfallen, warum ist es aus dem Lebendigen verschwunden? Kann man sagen, daß Zeit und Raum bloß ein und dieselbe Sache sind? Und daß die Zeit, wenn sie zerstört, was dem Raum unterliegt, sich selbst zerstört?
Sascha wachte auf. Sein alter Kamerad an der Hochschule der Kriegsmarine, jetzt U-Boot-Leutnant, der sie nach Chersones geführt hatte, war zurückgekommen, um sie abzuholen; er gab ihnen ein Zeichen mit der Hupe. Die beiden Dichter kletterten von den kahlen antiken Erhebungen zur Straße hinunter.
Zusammen mit einigen Atom-U-Boot-Offizieren tranken sie abends in der leeren Wohnung eines Offiziers Kognak. Die Elite der russischen Kriegsflotte, fünf Leutnants, die ihre Uniformjacken abgelegt hatten, zwei Frauen — ihre Ehefrauen — und die beiden Dichter ließen sich vollaufen, während sie Saschas Gedichte anhörten. Ed, der weniger betrunken als alle anderen war, entdeckte, daß hier, in der Gesellschaft von Leutnants, Saschas Gedichte besser klangen als seine. Die Leutnants schrien, prahlten herum, sprachen über die Strahlung, übertrieben sichtlich die Gefahren, denen sie sich aussetzten, um tapferer zu erscheinen als sie waren. Aber sie waren tapfer, und die goldenen Tressen ihrer Uniformen, das Futteral ihrer Degen, ihre sonnengebräunten Hälse, das paßte zu ihnen. Nach den Gedichten von Sascha gefiel es ihnen, Gumiljow zu lesen. Bei der Strophe »Der Leutnant steuerte das Kanonenboot unter dem Feuer der feindlichen Batterien…« brach eine Frau in Schluchzen aus, und Sascha, der nervös mit den Augen zwinkerte, erhob sich und schrie: »Einen Toast auf den Sieg der russischen Kriegsmarine, meine Herren!« Und alle schrien: »Hurra!« und tranken, irgendeiner erhob die Hand zum Schwur und sagte: »Meinen Arsch darauf, wenn uns je einer schlägt!«
Es wäre dumm und unrichtig zu behaupten, daß der Avantgardist an diesem Aufflammen des Nationalstolzes der Kriegsmarine nicht Anteil nahm. Den Eindruck zu erwecken, daß er skeptisch lächelte, während er diese Verrückten beobachtete, die bereit waren, sich verstrahlen oder lebendig verbrennen zu lassen, oder für den Ruhm Rußlands (der angeblich nicht ganz unbefleckt ist, wie Journalisten, Präsidenten und ganze Nationen bestätigen können) in ihren schönen Uniformen zu ertrinken, auch das hieße, gegen die Wahrheit zu verstoßen und der Mode nachzugeben. Solche Sachen können sogar träumerische Individualisten bewegen. Dem Avantgardisten brannten die Augen, und er blieb den größten Teil des Abends in dieser Wohnung ohne Möbel, obschon er von Zeit zu Zeit sich in seinen Gedanken in Chersones, bei den Ziegen und den stehenden Gewässern mit ihrer metallischen Farbe, bei den schändlich kahlen antiken Gemäuern wiederfand, wo unter den nassen Wolken Raum und Zeit sich selbst auflösten.
Denke ich vielleicht daran wegen des Steins in meiner Tasche, den ich in einem Grab aufgehoben habe, fragte sich Ed. Vielleicht setzt der Stein Strahlen frei, die mich an den Ort denken lassen, an dem ich ihn aufgelesen habe?
Am frühen Morgen brachen die Dichter nach Sewastopol auf, nachdem sie die Nacht auf dem mit Zeitungen bedeckten, versiegelten Parkettboden verbracht hatten. In Sewastopol regnete es. Auch auf die alte Schule von Sascha regnete es herab. Etwas zurückversetzt hinter hohen Gittern erhob sich das strenge Gebäude wie eine Art Tempel. Ein Mann in schwarzem Mantel kam heraus und ging zu einer Bushaltestelle, wobei er laut seine Stiefel auf dem Pflaster des Bürgersteiges knallen ließ. »Mein Bootsmann! Ed, wenn du wüßtest, was für ein Dreckskerl das war!«
Sascha dachte aufgeregt einen Moment über das Dilemma nach: sollte er sich auf den Bootsmann stürzen oder nicht. Während er langsam hinter seinem Bootsmann herging, wobei er Ed hinter sich zurückließ, fragte Sascha: »Machen wir ihn einen Kopf kürzer, Ed?« als ob er die Entscheidung darüber seinem kleinen Bruder überlassen wollte.
Der kleine Bruder Diplomat murmelte ein undeutliches »Hmjain« das ebenso als ein ja wie als ein nein durchgehen konnte.
Sascha entschied sich dagegen. Er erklärte es später damit, daß der Bootsmann einen Dolch in seinem Gürtel stecken hatte, wogegen weder er noch Ed bewaffnet waren. Außerdem wären die beiden Wachposten vor dem Tor zur Schule mit ihren Bajonetten ihm zu Hilfe gekommen.
Sie nahmen den Zug in Sewastopol, und der Zug brachte sie zurück nach Charkow, wobei er an vielen überflüssigen Bahnhöfen hielt. In Charkow vergaß Ed, die Brille abzunehmen und kam mit der Brille auf der Nase in das Haus am Tewelew-Platz Nr. 19, wodurch er Verlegenheit und Verwirrung im ganzen Flur verbreitete. Der Stein aus dem Grab eines Alten bei Chersones brannte ihm durch die Tasche auf dem Bein. Die Strahlen der alten Welt verzehrten ihn.
18
»Nutte! Was willst du von ihm?« Das brennende und fruchtbare Heisch von Anna Moissejewna fliegt wie eine Kanonenkugel hinter dem Zeitungskiosk hervor, streift Ed und den Weißen Bob, die zurückweichen, trifft auf die unschuldige Irma und klammert sich an ihren Hals. Anna hat die Schuhe und auch ihr Kleid gewechselt; ein rosa-lila Sackkleid, das Ed ihr genäht hat, bedeckt nun ihren Körper.
»Anna! Du bist verrückt! Was machst du da?« Ed packt Anna von hinten und versucht, sie von Irmas Haaren und Schultern wegzuziehen. Die Passanten, die die Sumskaja-Straße entlanglaufen, bleiben stehen. Die Schwarzhändler Sam und Schamil kommen grinsend und vergnügt aus dem »Automaten«, verschränken die Arme vor der Brust und beobachten genüßlich die Szene.
»Schlampe! Du hast mit ihm gefickt! Nutte!« schreit Anna und dreht die langen hellen Haare von Irma um ihre Hand.
»Verrückt! Sie ist verrückt!« kreischt Irma, ihr Kopf folgt der Hand Anna Moissejewnas, um sich nicht weh zu tun, senkt sie den Kopf.
Ed packt die Furie von hinten und versucht, ihr den Arm auf den Rücken zu drehen.
»Anna, beruhig dich… Was hast du? Bist du bekloppt? Anna…« Der Weiße Bob läuft um Anna Moissejewna, Ed und Irma herum, die aneinander geklebt wie die Laokoon-Gruppe dastehen, und weiß nicht, was er machen soll.
Die Freundin von Irma, Ed kennt ihren Namen nicht, hat sich verschreckt an die Mauer des Kiosk gedrückt und beobachtet die Szene, die sie nicht versteht. Sie hat die Hände auf die Brust gepreßt. »Aaaaaa«, schreit sie plötzlich hysterisch. »Miliz!«
»Ich werde dir beibringen, was es heißt, sich meinen Kerl zu krallen!« Anna schafft es, eine helle Locke um ihre Hand zu drehen. Tränen schießen Irma aus den Augen, sie hat ihren Kopf bis zu Annas Taille gesenkt.
»Bob! Trenn sie voneinander!« befiehlt Ed. »Ehe die Bullen kommen!«
Der gehorsame Weiße Bob führt einen nicht zu festen Schlag gegen Annas Bauch und ohrfeigt sie dann viermal. Anna läßt Irmas Haare los. Und die Haare gehören wieder ihrer Besitzerin.
»Das reicht, Bob! Anna!« Ed schüttelt seine Freundin. Schluchzend rennen Irma und die junge Unbekannte davon.
»Ihr Faschisten! Ihr habt mich geschlagen! Du Dreckskerl, du hast deinem Söldner befohlen, mich zu schlagen!« Anna weint. Die Krise beginnt abzuebben.
Ed schüttelt von neuem seine Freundin. »Was soll das, bist du verrückt geworden, Mädchen? Was hast du? Wir unterhalten uns ruhig, da kommst du und stürzt dich auf dieses unbekannte junge Mädchen… Was hat sie dir getan?«
»Anna«, beginnt der Weiße Bob, »du mußt weggetreten gewesen sein. Das sind meine Nachbarinnen. Ed kennt sie nicht einmal, nicht wahr, Ed?«
»Ich habe sie zum ersten Mal in meinem Leben gesehen.«
»Du hast mit ihr gefickt«, kreischt Anna und nimmt die Hände aus ihrem Gesicht.
»Hör zu, mach daß du wegkommst. Beruhig dich, wir werden später darüber reden«, zischt der Dichter wütend. »Komm, Bob!« Sie lassen Anna beim Kiosk zurück und erklimmen schnell die Treppe zum »Automaten«. Die frechen Schwarzhändler bewegen sich träge zur Seite, um sie durchzulassen.
»Ich habe immer gesagt, mit einer Frau zusammenzuleben, die älter als man selbst ist, wäre das letzte, was ich tun würde«, sagt Sam mit der großen Nase ziemlich laut zu Schamil.
»Es sei denn, sie hält dich aus«, bemerkt Schamil.
Den Schwarzhändlern stinken die Dichter, die Dichter verachten sie. Unglücklicherweise ist der »Automat« einzigartig in der Stadt, die »Erfinder« und die »Käufer« — in diese beiden Kategorien unterteilt Welemir Chlebnikow die menschliche Gattung — müssen miteinander koexistieren. Gelegentlich ereignen sich kleine Zwischenfälle.
»Da hat sich diese Frau in mir aber verrechnet«, sagt Ed entrüstet zum Weißen Bob — sie laufen durch den »Automaten«, grüßen und schütteln Hände.
»Und das für nichts! OK, wenn ich wirklich schuldig wäre, Bob. Aber sie macht einen Skandal für nichts. Es ist das zweite Mal, daß ich Irma sehe…«
»Das vierte Mal…«, korrigiert Bob.
»Gut, das vierte… Aber ich ficke nicht mit ihr, das weißt du genau, Bob.«
»Du gefällst ihr. Wenn du willst, kannst du mit ihr ficken. Die Frauen riechen so was. Deine Anna hat ihre Blicke bemerkt…«
Ed wirft einen Blick zurück und sieht einen fetten rosa Heck in ihre Richtung kommen. »Paß auf, sie sucht uns! Schnell, Bob, ehe sie hier aufkreuzt…«
Schnell gehen sie zur Tür Nummer Zwei des »Automaten«.
Neben dem Ausgang sitzt Viktor, der seinen Hut abgenommen hat, an einem Tisch mit einer Platte aus imitiertem Marmor und trinkt einen Kaffee. »Wo gehen Sie hin, Gentlemen?«
»Anna kommt…« Ed deutet mit dem Daumen hinter sich. »Wir verduften in den Park, komm, wenn du willst, zum Denkmal.«
»Fräulein Rubinstein hat schlechte Laune?« Viktor belebt sich. »Ich halte sie auf. Immer bereit, mich auszustrecken in der Tür eines Blockhauses.«
Wo waren Genka und die »SS« bloß verschwunden? Ein Rätsel. Sicher waren sie irgendwo in der Nähe der Sumskaja-Straße, beim Springbrunnen, im Gastronom, in der Pfannkuchenbude oder im Park, aber man sah sie nirgends. Er mußte sich also mit der Gesellschaft des Weißen Bob begnügen. Die Burschen laufen über die Sumskaja-Straße, betreten den Park und setzen sich auf eine große Bank, die die Form eines Kanapees hat. Hier stehen zehn solcher Bänke, und die Kunden des »Automaten« pendeln dauernd zwischen dem »Automaten« und den Bänken unter den dichtbelaubten Kastanien hin und her. Die Bänke sind verlassen, bloß der Onkel Wassja Tschapajewetz sitzt weiter weg mit seinen Orden, und trotz der Hitze trägt er eine Pelzmütze und seine Stiefel, er spielt Akkordeon, sein Ohr hat er über das Instrument geneigt.
»Deine Freundin ist aufgebracht«, bemerkt der Weiße Bob und beobachtet die Türen des »Automaten«, die man von den Bänken gut sehen kann. »Ist sie häufig so?«
»Nein. Früher war sie ruhiger, obwohl ich viel mehr trank und mindestens zweimal in der Woche volltrunken nach Hause kam.«
»Du hältst dich gut. Wenn ich betrunken bin, dann bin ich grob. Wütend… Und ich glaube, daß deine Freundin Anna älter wird. Sind das vielleicht ihre Wechseljahre? Wie alt ist sie jetzt, Ed?«
»Im März ist sie dreißig geworden.«
»Da hast du's, sie ist dreißig und du bist dreiundzwanzig?«
»Hm, na und?«
»Eben, ihr paßt von eurem Alter her nicht zusammen. Ich verstehe natürlich gut, daß es für dich praktisch ist mit Anna…« Der Weiße Bob sucht nach Worten, die Züge seines Tatarengesichtes, das seine hellen Haare und die violetten Tintenflecken seiner Augen eines Blonden beleben, ziehen sich verlegen zusammen…
»Du wohnst im Stadtzentrum, die Wohnung ist nicht schlecht, ihr Zimmer, aber…« Das Gesicht von Bob zieht sich noch mehr zusammen… »Ed, ich glaube nicht, daß du sie liebst, wie man eine Frau liebt.«
Bob hält sich zurück. Ed betrachtet seinen Freund und denkt, daß aus Bob jetzt das »Automaten«-Wesen spricht, jene Mischung aus Schwarzhändler und Intellektuellem, daß nun das »Automaten«-Volk durch Bob seine Meinung über seine Beziehung zu Anna sagt. Du lebst für dich, aber die anderen überwachen dich, geben ihr Urteil ab, ob du es willst oder nicht. So ist es nun mal, außerdem ist das so viel interessanter.
»Ich liebe diese Frau, Bob, obwohl ihr Hintern einen Umfang von 128 Zentimetern hat und ihre Hüften bei weitem breiter sind als bei all meinen Kunden…« Offenbar hat die Fauna des »Automaten« Schwierigkeiten, das zu verstehen: daß ein junger Mann aus der Vorstadt, der eines schönen Tages daherkommt, die Bekanntschaft einer Frau macht, die den Ruf hat, ein leichtes Mädchen zu sein, und beginnt, mit ihr zusammenzuleben, und daß das zur allgemeinen Überraschung nun schon mehrere Jahre so geht…
»Ja«, stimmt Bob zu, glücklich, »alle wundern sich darüber, daß Anna auch treu sein kann.«
»Was wundert sie außerdem, Bob? Los, erzähl mir, was geklatscht wird…«
»Nichts Besonderes… Man quatscht allen möglichen Unsinn… Manche behaupten, du seist ein Zuhälter, daß Zilja Jakowlewna und Anna dich aushalten, andere behaupten das Gegenteil, daß du sie aushältst und daß sie dich Hosen nähen lassen, immer mehr Hosen…« Bob lacht.
»Zunächst einmal nennt man einen Mann, der einer Frau auf der Tasche liegt, einen Alfons. Ein Zuhälter ist jemand, der eine Frau auf den Strich schickt. Und dann hält niemand niemanden aus, sondern alle legen alles zusammen, Zilja Jakowlewna bekommt ihre Rente, ich nähe Hosen und Anna arbeitet in dem einen oder anderen Buchladen, und genau das können die Leute nicht verstehen. Ein so banales Leben. Sie verlangen nach Leidenschaft, nach Verbrechen…«
»Das ist es nicht allein, Ed. Ihr seid sehr verschieden. Anna mit ihren schon ergrauten Haaren und ihrem 128 Zentimeter-Hintern wirkt älter als ihre dreißig Jahre, und du siehst jünger aus als du bist. Man könnte von einer Mutter mit ihrem Sohn sprechen, da siehst du, welchen Eindruck ihr macht. Sie paßt auf dich auf wie eine Mutter! Und genau deshalb gibt es ständig Klatsch über euch.«
»Sie sind wohl unzufrieden, was? Was bin ich ihnen schuldig, warum soll ich ihnen einen Gefallen tun? Soll ich mir ein Hühnchen von zwanzig Jahren suchen, ohne Grips, mager, wie es die Mode verlangt, schön und dumm wie die Mädchen der Schwarzhändler? Anna ist intelligent, sie hat Humor, ihr habe ich es zu verdanken, daß aus mir — einem Proll — ein Dichter geworden ist. Vielleicht liebe ich Anna nicht mit aller Leidenschaft, die man in den ägyptischen und indischen Filmen sieht, vielleicht gibt es in unserer Liebe mehr Kameradschaft, Anerkennung und Dankbarkeit als Sex, na und? Sollen sie sich doch einen runterholen! Eine Scheißgesellschaft! Was glaubst du — Ach, Charkow… Von der Sorte gibt es mindestens zehn weitere Städte in der Sowjetunion. Ich hau ab nach Moskau!«
»Was regst du dich so auf… Beruhige dich, Ed! Du hast doch recht. Es ist deine Angelegenheit, mit wem du lebst. Ich sage dir bloß ehrlich, was ich denke, du wirst nicht mehr lange mit Anna zusammenbleiben…«
»Warte es nur ab, wir wollen im September zusammen nach Moskau gehen.«
»Ehrlich? Das wäre idiotisch. Allein würdest du eine kleine Moskauerin kennenlernen, sie heiraten und dort deinen Wohnsitz anmelden. Zusammen, und beide ohne Anmeldung, werdet ihr euch in die Scheiße reiten oder zurückkehren.«
»Es wird uns nichts passieren. Anna hat Freunde in Moskau…«
»Ed! Du Dreckskerl!« Anna Moissejewna Rubinstein — wenn man vom Teufel spricht… taucht hinter der Bank auf, sie ist immer noch schlecht gelaunt. Wie hat sie es geschafft, ihnen in den Rücken zu fallen? Ein böses kleines Lächeln auf den Lippen, die Tasche in der Hand, nähert sich Anna, man sieht die Schweißflecken unter den Achseln ihres rosa Kleides. Sie hat sich nicht beruhigt. Die Bösartige hat die Sumskaja-Straße außerhalb ihres Blickfeldes überquert und nähert sich jetzt drohend. Onkel Wassja Tschapajewetz ändert plötzlich die Melodie und stimmt einen Kriegsmarsch an…
»Los!« zischt Ed zu Bob. Sie springen auf und laufen so schnell sie können die Allee parallel zur Sumskaja-Straße hinunter. Beim Paradiesapfelbaum, an dem kleine rote Äpfel hängen und der im Begriff ist einzugehen, biegen sie ab und verschwinden in den Tiefen des Parks.
»Ed! Halt an! Halt an! Du Dreckskerl…« Anna läuft ihnen etwas hinterher, bleibt aber schnell stehen. In hügeligem Gelände zu rennen ist schwer, wenn man Schuhe mit hohen Absätzen trägt und ein Schwergewicht ist. »Miststück, kleiner Dreckskerl! Miststück! Wenn du nach Hause kommst, ist die Tür abgeschlossen… Miststück…« brummt Anna, die sich auf einer Bank unter dem Paradiesapfelbaum hinsetzt, sie öffnet ihre Handtasche, holt einen Spiegel und einen Lippenstift heraus und rötet ihre Lippen. Dann bringt sie mit einigen Kammbewegungen ihre Haare wieder in Ordnung. Reibt sich die Nase. Das gebräunte Gesicht von Anna über dem Rand ihres rosa Kleides ist frisch, ihre aquamarinfarbenen Augen kneifen sich im Spiegel zusammen, den das Sonnenlicht überflutet. »Sei gegrüßt, Anna! Märtyrerin!« Anna spricht mit sich selbst und lächelt. Alles in allem geht es ihr gar nicht so schlecht. Und außerdem fickt der kleine Dreckskerl nicht mit dieser Kuh von Irma. Er ist ein Nachtschwärmer wie sein Freund Genka, aber nicht so einer. Er ist kein Weiberheld. Er ist ein Experte für Gedichte und ein Nachtschwärmer. In der ganzen Zeit ihres gemeinsamen Lebens hat Anna kein einziges Mal den kleinen Dreckskerl dabei ertappt, daß er sie betrog. Gut möglich, daß er sie überhaupt nicht betrügt. Oder wenn er sie betrügt, dann jedenfalls nicht häufig. Anna pudert leicht ihre Nase und lächelt von neuem. »Da hast du es, Anna, er hat sich wie eine Schlange in dein Leben geschlichen. Du lebtest für dich, du kanntest nicht den Kummer, du warst fröhlich. Und kaum ist dieser Fabrikarbeiter da, ein Tölpel, wie Tante Ginda solche Typen nennt, kurzgeschoren wie ein Soldat, den Nacken glattrasiert, hat er in einer Ecke gehockt und ohne was zu sagen seine Blicke auf dir lasten lassen. Dann hast du entdeckt, daß er vollkommen kurzsichtig war, daß er dich nicht einmal sah.« »Ed, setz deine Brille auf und schau mich an, vielleicht bin ich nicht so schön, wie du ohne Brille glaubst«, hatte sie zu ihm gesagt. »Er hat sie nicht aufgesetzt…«
Anna steht auf und zupft ihr Kleid zurecht. Sie bemerkt den Apfelbaum hinter sich und betrachtet ihn mit Interesse. Sie stellt sich auf ihre Zehenspitzen, pflückt einige Äpfel. Setzt sich wieder. Beißt in einen Apfel. »Ääh, so eine Sauerei!« Sie spuckt das Stück aus. »Der kleine Dreckskerl hat dich vergewaltigt, Anna. Du wolltest nicht mit ihm zusammenleben, du warst zufrieden mit deinem Leben einer unabhängigen Frau, du schliefst, mit wem du wolltest. Und er hat dir nicht einmal sofort gefallen. Er hatte so eine militärische Art. Das war zwar nicht sein Fehler, sein Papa ist Offizier. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm…« Anna hebt den Kopf und betrachtet den Apfelbaum. »Ein ukrainischer Strolch aus der Vorstadt. Und er ist nicht mal schön. Seine Augen — da hat seine Mutter ihm mit Streichhölzern zwei Löcher eingebrannt. Sein Mund sieht aus wie ein Hühnerarsch. Die Nase von Marlene Dietrich… Aber wie hartnäckig er ist! Er hat sie alle überwunden und sie alle verdrängt. Auch Tolik Kuligin. Und er hat diesen armen abstrakten Maler Tolik Schulik geschlagen…« Annas Gesicht wird weich. »Armer schöner Tolik, schon grau mit neunzehn Jahren… Ed hat ihn geschlagen und rausgeschmissen, um selbst bei mir zu bleiben…« Anna lehnt sich tiefbewegt an die Bank, der Schatten eines Apfelbaumzweiges bedeckt ihr Gesicht.
»Eh, Anna, schläfst du oder träumst du?«
»Hannah Mussijewna träumt, wenn ich es richtig sehe.«
Anna öffnet die Augen. Mit dicken Lippen, zusammengekniffenen Augen, immer voller Spott für die Welt, ein großes russisches Gesicht, steht ihre beste Freundin Wika Kuligina vor ihr, sie trägt einen weißen Rock und eine cremefarbene Seidenbluse wie eine frisch Verheiratete. An ihrer Seite ihr Liebhaber und Freund ihres Exgatten, der schöne Lonka Bruk. Genauer gesagt, einer ihrer Liebhaber, denn Wika hat immer jede Menge Liebhaber. Mit seinem weißen Hemd, den schwarzen Augenbrauen und seiner dunklen Hose sieht Lonka aus, als sei er gerade von einer Kinoleinwand, auf der ein arabischer Film läuft, heruntergestiegen.
»Oh, Wika! Wie schön, dich zu treffen!« Anna steht fröhlich auf. »Wo geht ihr hin?«
»Ich führe deine Freundin aus. Schau doch, wie bleich sie ist. Sie verläßt nicht ihr Bett. Sie fickt, schreibt Gedichte und geht nicht in die Sonne.«
»Ein brauner Frauenkörper ist nicht sexy. Ein weißer Körper ist viel sinnlicher.« Wika zieht an ihrer Zigarette. »Lonka ist wieder ganz Feuer und Ramme für mich, Anna. Er hat mir ein Nachthemd geschenkt. Und auf das Nachthemd hat er — stell dir vor, Anna, wie talentiert er ist, hat er von Hand eine hübsche kleine Maus gestickt.«
Als Zeichen der Ermutigung hat Wika die dunkle Wange Lonkas getätschelt. »Kleines Händchen, Lonka… Und jetzt will er ein Kind von mir. ›Du hast ein Kind von Kuligin, hat er mir gesagt, ›und von mir nicht‹! Er kann schließlich nicht schlechter sein als sein Freund Kuligin!«
»Übrigens haben wir gerade deinen Freund getroffen, Anna.« Lonka Bruk lacht mit allen seinen Zähnen. »Er rannte mit einem hübschen Rowdy, ich weiß nicht wohin. Ihr amüsiert euch jeder auf eigene Faust?«
»Der kleine Dreckskerl und der Weiße Bob sind abgehauen, als ich gekommen bin… Das Miststück, dieser kleine Dreckskerl! Aber heute nacht wird er nach Hause kommen. Und ich werde den Riegel vorschieben!«
»Ja, Anna, du wirst den Riegel vorschieben.« Bruk stimmt ihr ernst zu. »Und dann drehst du dich in deinem Bett um, und fünf Minuten später stehst du auf und wirst ihm öffnen.«
»Aber was hat er gemacht, Anna?« Wika lacht. »Abgehauen ist er? Und du läufst ihm hinterher?«
»Ich brauch ihn nicht… Warum lauf ich ihm auch nach… Nehmt ihr mich mit? Führst du mich auch aus, Lonka? Wenn ihr nichts vorhabt… Ich hab nichts zu tun.«
»Wir haben gerade gefickt. Gehen wir in den ›Pinguin‹ ein Gläschen trinken, einverstanden? Und warum bist du nicht im Kiosk, Anna?« Wika nimmt ihre Freundin bei dem Arm.
»Mama vertritt mich. Dieser Kiosk steht mir bis da.« Anna deutet mit ihren Fingern an ihren Hals. »Ab nach Moskau.«
»Ach du Scheiße! Warum? Paßt dir Charkow nicht?«
»Der kleine Dreckskerl möchte nach Moskau. Er sagt, daß Charkow nicht mehr interessant für ihn ist, daß er hier schon alle hinter sich gelassen hat. Er findet, daß er in Charkow besser als alle anderen schreibt. Deshalb möchte er nach Moskau. Er glaubt, daß man, um gut Schach zu spielen, mit stärkeren und nicht mit schwächeren Spielern spielen muß.«
»Hast du aus ihm einen Schachspieler gemacht?« Lonka lächelt.
Wika bleibt stehen, läuft ihnen voraus, dreht sich um, preßt ihre Hände vor die Brust und deklamiert mit einer gespielt tragischen Stimme das NACH MOSKAU! NACH MOSKAU! NACH MOSKAU! der »Drei Schwestern« von Tschechow. Wika und Bruk haben im »Haus der Kultur« an einer Studiobühne gespielt. Wika spielte Ophelia und Bruk Hamlet.
»Darf ich die Damen zu einem Glas Porto einladen?« fragt Bruk galant.
»Die Damen schätzen sich glücklich, von Ihnen eingeladen zu werden.« Wika macht eine Verbeugung.
19
»Wer arbeitet überhaupt noch in dieser Stadt, Ed?« fragt der Weiße Bob mit pathetischer Stimme. »Wer? Nicht mal die Jungen arbeiten mehr.«
»Ich arbeite.« Die braunhaarige Nina senkt die Augen. »Ich habe gerade meine Pause.«
Nina ist inzwischen Nina Iwanowa geworden, früher hieß sie bloß Nina; in Zilja Jakowlewnas Abwesenheit (sie war für sechs Monate nach Kiew zu ihrer ältesten Tochter und ihrem Schwiegersohn Theodor gezogen, um sich von Anna und Ed zu erholen) hatte sie mit der kleinen Oha das große Zimmer der Rubinsteins gemietet und schlief unter einer Flickendecke. Nachdem sie die Medizinhochschule absolviert hatte, vergiftete die Nina von früher wie die von heute in einem wissenschaftlichen Institut Mäuse, denen sie Viren injizierte. Damit sie, abgesehen von den nützlichen Viren, nicht auch unnütze Viren ins Institut brachte, gab man und gibt man Nina reinen Alkohol in kleinen bauchigen Flaschen. Um die Spritzen zu desinfizieren. Ein beträchtlicher Teil des Alkohols desinfiziert die Mägen von Ed, Genka und Fima.
»Ja, du arbeitest ganz in der Nähe…«, bemerkt Ed.
»Hinter dem GOSPROM… Du hast nicht zufällig meinen Mann gesehen? Ich sollte ihn hier in der Nähe treffen, wir wollten zusammen zu Mittag essen. Ich verstehe nicht, warum er nicht gekommen ist…«
»Ich habe ihn gesehen. Er ritt ein Kamel.«
»Ein Kamel?«
»Hm. Ein Kamel mit einem Höcker. Und dann ist er vom Kamel gefallen und hat auf den Knien die Wüste durchquert.« »Machst du Witze, Ed?«
»Überhaupt nicht. Wir waren im Zoo. Fima und dein Lonka haben einen Ausflug auf den Wüstenschiffen unternommen. Die ganze Bande muß wohl irgendwo in der Nähe sein, vielleicht beim Denkmal. Lonka, Genka, Fima, M'sieur Bigoudi…«
»Und so was nennt sich Ehemann«, Nina seufzt. »Daß man so einen geheiratet hat. Seine Frau arbeitet, während er auf einem Kamel ausreitet. Wollt ihr Alkohol, Jungs?« Nina öffnet ihre Handtasche und zeigt eine kleine durchsichtige und bauchige Flasche. »Zwei Deziliter. Ich habe sie meinem Mann mitgebracht, aber wenn er auf einem Kamel ausreitet, dann kann er das auch ohne Alkohol.«
»Klar wollen wir.« Bob schaut in die Tasche, vielleicht um den Alkohol besser sehen zu können.
»Und wie trinken wir ihn? Gehen wir zum Imbiß?«
»Warum zum Imbiß? Bist du kein Mann, Bob? Siehst du den Sprudelautomaten? Wir haben alles, was wir brauchen. Gehen wir?«
»Ich würde gern ein Sandwich essen.« Nina gibt Ed die Flasche.
»Wir kommen mit, wir gehen nur rüber, um ein Glas zu holen. Das haben wir in einer Minute.«
Mit den Absätzen klappernd geht Nina mit ihnen. Neben dem wackligen Sprudelautomaten nimmt Ed das leere Glas, spült es aus, entfernt den paraffingetränkten Korken aus der Flasche und gießt den Alkohol in das Glas. »Du mußt lernen, die neue Technologie zu gebrauchen, Bob!« Er hält das Glas unter den Hahn des Automaten, schiebt ein Geldstück in den Schlitz, und Sprudelwasser spritzt aus dem Hahn. Ed zieht das volle Glas zurück, hält den Atem an und trinkt. Eine harte Sache, Alkoholsprudel zu trinken! Vor allem bei 27 Grad im Schatten. Aber er trinkt tapfer die letzten Kubikzentimeter Sprudelfeuer. Und raucht, nachdem er sich eine Zigarette aus Ninas Päckchen genommen hat.
»Ex!« staunt Bob. »Schrecklich! Wieviel Prozent hat der?«
»Wenn er nicht verdünnt ist, mehr als 90, bestimmt 92, mit dem Sprudel um die 69…« erklärt Nina stolz, als wären sie und Ed auf der gleichen Seite, auf der Seite derjenigen, die herrschen, und als wäre Bob auf der anderen, auf der Seite derjenigen, die nur das Recht auf Nachsicht geltend machen können.
Trotzdem ist Bob keine schwache Persönlichkeit. Er ist gute ein Meter achtzig groß, er ist jünger als Ed, er ist einundzwanzig und hat nie ein Glas abgelehnt. Er gießt mit einem entschlossenen Gesichtsausdruck den restlichen Alkohol in das Glas und beginnt in seinen Taschen zu wühlen, er sucht Kleingeld. Hinter ihnen hat sich bereits eine kleine Schlange gebildet, den Gesichtern nach Provinzler, die an der Universität ihr Examen ablegen wollen. Sie warten darauf, daß Bob sein Kleingeld findet. Nina gibt ihm eine Kopeke. Bob nimmt sein Glas und stürzt das Teufelswasser hinunter; seine violetten Augen treten aus ihren Höhlen. Als er das Glas ausgetrunken hat, atmet er mit offenem Mund tief durch wie ein erstickender Fisch, den eine Angelbewegung ans Ufer geschleudert hat. »Puuuu!«
»Du bist glänzend, Nina«, bemerkt Ed zu seiner früheren Mitbewohnerin. Er kann keine Komplimente machen und weiß das. Deshalb beschränkt er sich gewöhnlich auf Parodien von Komplimenten. »Du bist glänzend.« Er verzieht sein Gesicht. Er hätte hinzufügen müssen: »Du riechst gut.«
Nina dreht sich verwirrt um. Als sie noch im Zimmer nebenan wohnte, hatte Ed für einen Moment einmal den Eindruck gehabt, daß er ihr gefiel. Eines Tages, kurz vor ihrer Heirat, hatte Nina getrunken und eine hysterische Krise gehabt. Gewöhnlich schweigsam und mürrisch, war das junge Mädchen in Schluchzen ausgebrochen und hatte unter Tränen gestanden, daß sie Lonka nicht liebe, daß er sie langweile und daß ihr seine Liebe und sein Lispeln und sein »Ninotschka« nach jedem Satz verhaßt waren. Die Krise hatte sich am kalten Kranich-Strand ereignet, wo Ed, Genka, Nina und Fima mit einem Taxi hingefahren waren; das Auto war, mit den Reifen im Sand, in der Nähe geparkt, und der reichlich bezahlte Chauffeur hatte auf sie gewartet. Trotz des feinen und trockenen Schnees, der vom Himmel fiel, hatten sie im Fluß gebadet, nachdem jeder etwa zwei Deziliter Alkohol runtergestürzt hatte. Nina hatte auch gebadet. Nach dem Bad waren sie herumgesprungen, hatten kaltes Fleisch gegessen, hatten sich abgetrocknet, hatten gesungen und geschrien. Dann hatte Nina geweint, war Ed um den Hals gefallen und hatte ihn umarmt.
Ed und Genka hatten sie, betrunken und tränenüberströmt, abends zur Haustür Tewelew-Platz Nummer 19 gebracht, und Ed hatte sie, nachdem er sie umarmt hatte, in den Eingang gestoßen. »Geh!!« Lonka war da, er sprach mit Anna und wartete auf seine Ninotschka. Später erfuhr man, daß er an diesem Tag gekommen war, um offiziell um ihre Hand anzuhalten. Ed war wieder ins Taxi gestiegen und mit Genka weggefahren. Nina mußte heiraten, um in Charkow bleiben zu können und nicht in ihre kleine südukrainische Heimatstadt zurückzukehren. Nina hatte Lonka geheiratet. Ed war ihr Trauzeuge. Nina lebt mit ihrem Gatten zusammen. Lonka hebt seine »Ninotschka« sehr. Lonka ist ein zuverlässiger Bursche. Naja, irgendwie ist er aber bloß zweite Wahl. Obschon er nicht dumm ist und die Literatur nicht schlechter kennt als Melechow, obschon er sich lebendig und energisch zu unterhalten versteht, wobei er seinen Mund etwas verzieht, ist er trotzdem »eine Kraft, die sich verschwendet«. Ed hatte diesen Ausdruck von einem fortschrittlichen und kaum bekannten russischen Kritiker aus dem neunzehnten Jahrhundert übernommen. Vielleicht Belinskij. Er will damit sagen, daß Lonka Kraft besitzt, er zeichnet, er schreibt nicht schlecht, aber daß ihm diese Kraft zugleich auch fehlt, ganz so »als wenn er sein Talent begrabe«. Selbst in Charkow, wo es leicht ist, als begabter Mann zu gelten, betrachtet man Lonka weder als Maler noch als Schriftsteller. Er ist Lonka Iwanow, punktum. Und nichts mehr.
Ed begräbt sein Talent nicht. Er schreibt Gedichte und versteht nicht, wie es anders sein kann. Kaum ist er in seinem Zimmer, schon beugt er sich über seinen Spieltisch, um zu schreiben. Die Gedichte kommen leicht, zu seiner großen Verwunderung wie auf natürliche Weise. Alles um ihn herum verwandelt sich in Gedichte. Die asiatische Sommerhitze im kontinentalen Charkow wurde im Gedicht »Die Hitze und der Sommer… Sind eingeladen…« festgehalten. Das einfache Aquarium und sein goldener Fisch, den er im Haus von Wladik Semernin gesehen hatte, verfremden sich nach der Methode Schklowskijs und der Mitglieder der Opojas-Gruppe und ergeben dann:
Im Bezirk Nummer 15
Lebte ein großes Geschöpf
Es lebte in einer Apotheke
Und der Apotheker begoß es.
Es war keine Pflanze
Es hatte einen Mund und drei Finger
Es lebte in einem durchsichtigen Topf
Es lebte auf dem Fußboden…
Ed geht in den Straßen von Charkow spazieren, trinkt mit Motritsch, mit Genka und anderen Freunden, aber macht trotzdem Hosen und Gedichte. Lonka, so scheint es, produziert nichts. Schwer verständlich, was er aus seinem Tag macht. Gelegentlich schafft er es zu arbeiten. Er ist Heizer, wie Melechow früher. Oder Nachtwächter. Um tagsüber frei zu haben. Aber warum will er tagsüber freihaben? Letzten Endes ist das sein Problem…
20
Lonka, der die Blumenbeete überquert hat, schmiegt sich an die Statuen der Kosaken und Söldner und der berühmten Katerina zu Füßen des Taras aus Granit. Neben ihm grinst der Ingenieur Fima wie ein Affe. Sie haben eine Pose eingenommen, als wären auch sie Helden aus den Gedichten von Taras. »Siehst du deinen Gatten, Nina?«
»Mein Gott, Ed, warum ist Lonka so verrückt? Kannst du mir das erklären. Du lümmelst dich doch auch nicht in den Beeten herum…«
»In den Beeten lümmelt Ed sich nicht rum, aber ich selbst bin Zeuge gewesen, wie er einem kräftigen Mann auf den Rücken sprang, ihn umwarf und ihn getreten hat…« sagt Bob. »Es gibt da einen gewissen Schdanow. Ähnelt einem Nashorn. Genauso kräftig, mit dem gleichen Verstand… Ed, der ist vorsichtig, aber unberechenbar. Weshalb bist du über Schdanow hergefallen, Ed?«
»Weiß ich nicht. Ich war blau. Schdanow war blau. Wir gingen durch den Park — ich, Genka, Irka, Bach und Bob. Das Nashorn nahm Irka bei der Hand und fing an, sie mit schmutzigen Wörtern zu überschütten…«
Genka und M'sieur Bigoudi begrüßen sie von der Bank aus, auf der sie alle eng nebeneinander sitzen. Man sieht den Strohhut von Viktor. Motritsch, der eine sehr enge Hose trägt, wendet ihnen den Rücken zu und hüpft herum. Er mag nicht gerne sitzen. Er liebt es, sich die Füße zu vertreten und vor den anderen hin- und herzulaufen. Motritsch hat eine Hasche in der Hand. Lonka sieht seine Ninotschka, überquert das Beet und läuft zu ihr. Fima, der auf die geteerte Allee gesprungen ist, spielt einen Affen, springt auf allen Vieren, wirft die Arme weit nach vorn und streckt die Beine nach hinten. Fima ist älter als die anderen, er ist achtundzwanzig, nur Motritsch ist noch älter als er, obschon er sich immer so verhält, als wäre er erst sechzehn. Und Fima lacht immer mit seinen dicken roten Negerlippen in seinem Affengesicht. Seine kurzen und schwarzen Haare haben einen Bürstenschnitt. Jefim ist total geil. »Eine Nummer zu schieben« ist seine Lieblingsbeschäftigung. Seine Geilheit reitet ihn in die ebenso erstaunlichsten wie dümmsten Geschichten. Etwa die letzte: Fima hat mit einer Frau »eine Nummer geschoben«. Sie wohnte allein in einem Gartenhaus in der Zwei-Juden-Straße, wie die Charkower die Moskalewka-Straße nennen (die Straße der Moska und der Lewka). Sie waren glücklich, aber sie sollte in ihre Ferien aufbrechen. Sie ging frühmorgens. Müde von all den Nummern, die er geschoben hatte, wollte Fima noch schlafen, und bat deshalb seine Freundin, ihm den Schlüssel dazulassen, er werde das Haus abschließen. Sie ging, Fima schlief wieder ein. Als er aufwachte, fand er den Schlüssel nicht. Die stabile, eisenbeschlagene Tür war abgeschlossen, die metallenen Fensterläden waren von außen mit Stahlschienen und mit großen Vorhängeschlössern verriegelt. Er versuchte, Türen und Fenster aufzubrechen. Ohne Erfolg. Er brüllte und schrie durch die Fenster, und erst drei Tage später gelang es ihm, einen Passanten anzuhalten (es gibt nur wenige Leute, die an dieser Ecke der Moskalewkastraße vorbeikommen); er überredete ihn, Genka anzurufen und ihm die Adresse des Gefängnis-Hauses zu geben, in dem er schmorte. Genka kam in einem Taxi, knackte mit Hilfe des Chauffeurs eines der Vorhängeschlösser und befreite Fima. Fima brüllte vor Hunger. Weil sie für einen Monat verreiste, hatte seine Freundin den Kühlschrank abgetaut; im ganzen Haus hatte er bloß einen Kräcker finden können.
»Was für einen lustigen Juden du spielst, Fima!« hatte Genka gespottet. »Wie hast du es denn sonst angestellt, deine Haut zu retten, mit deinem Trick siebzehn?«
»Was schon, ich bin abgehauen…« hatte Fima schuldbewußt gelacht.
Genka hatte ihn in die Pfannkuchenbude eingeladen. Er erinnert sich noch mit Entsetzen daran, was Fima alles verschlungen hatte.
*
»Ed, Anna sucht dich.« Genka macht etwas Platz, und Ed setzt sich neben ihn; er hat einen Händedruck mit Motritsch und dem jungen Sokolow gewechselt. Der junge Sokolow ist ein Stutzer. Trotz der Hitze trägt er eine gepunktete Fliege. Und Hosenträger über seinem kurzärmeligen Hemd.
»Soll sie mich doch suchen… Sie ist vollkommen durchgedreht. Sie hat sich, weiß der Henker warum, auf diese fette Kuh Irma gestürzt. Wir waren beim ›Automaten‹… Plötzlich schlägt Anna wie eine Bombe ein und zerrt Irma an den Haaren…«
»Hannah Mussijewna durchläuft eine Periode intensiver Aktivität. Der Einfluß des Mondes. Bald ist Vollmond. Vielleicht sogar heute«, bemerkt Motritsch lallend. Er ist betrunken, aber nicht zu sehr. Deshalb ist er auch noch nicht Motritsch der Abscheuliche, Motritsch der Pisser, Motritsch der Sabberer, Motritsch, der Sauereien sagt, sondern der vollkommen zurückhaltende, ein wenig gekrümmte Kroate, den das Schicksal in eine ukrainische Stadt verschlagen hat, wo er Dichter geworden ist.
»Fräulein Anna ist beleidigt, weil Sie vielversprechender Dichter den ganzen heiligen Tag in Gesellschaft von brillanten, schönen, intelligenten und begabten Gentlemen in der Stadt Spazierengehen, während sie an Schüler der Militärakademie die Zeitung Sozialistisches Charkow‹ und an die Ärztinnen des Großen Krankenhauses nebenan die Zeitschriften ›Die Arbeiterin‹ und ›Gesundheit‹ verkaufen muß.« Viktor plärrt wie ein Radioapparat.
»Was tun?« Ed zuckt mit den Schultern. »Ich kann Hosen nähen, deshalb arbeite ich zu Hause und organisiere meine Zeit, wie ich es will. Anna versteht es nicht, Zeitungen und Zeitschriften zu verkaufen, genausowenig wie sie im ›Poesie‹-Laden oder in der Wissenschaftlichen Buchhandlung‹ Bücher oder Möbel in einem Möbelgeschäft verkaufen kann, doch ist das das einzige Mittel, Geld zu verdienen. Unglücklicherweise habe ich nicht genug Aufträge.«
»Ich brauche eine Hose, Ed.« Sokolow schiebt seine helle Haarlocke aus der Stirn.
»Ich auch, ich brauche auch eine Hose, Ed!« Motritsch schaut ironisch an seiner engen und abgenutzten Hose nach unten. Seit zwei Jahren schon sagt Motritsch, daß er eine Hose braucht, aber er hat nie genug Geld, um den Stoff zu kaufen. Ed ist manchmal schon bereit, ihm den aus seiner Tasche zu bezahlen, aber ihre guten Beziehungen sind nie dauerhaft genug. Sokolow hat beschlossen, sich eine Hose machen zu lassen. Sokolow ist ein junger ernster Mann, ein bißchen romantisch. Seine Stimme hat noch nicht ihre Tonlage gefunden, sie steigt manchmal bis zu einem kreischenden Tenor und geht plötzlich wieder runter in den Baß.
Lonka hat Ninotschka umarmt und sich ganz links von der Bande hingesetzt, die auf den im Halbkreis aufgestellten Bänken sitzt. Lonka murmelt etwas zu seiner verdrossenen und selbständigen Frau, vielleicht rechtfertigt er sich. Nina hat, gelangweilt von der Zärtlichkeit Lonkas, die Augen zusammengekniffen. Sie verzieht das Gesicht, denkt Ed, aber Tatsache ist Tatsache, sie lebt mit dem Plattfuß Lonka zusammen, sie verläßt ihn nicht. Sie hätte, als sie erst einmal in Charkow angemeldet war, sich von ihm trennen und ihn sitzen lassen können. Aber man läßt einen treuen und ergebenen Jungen nicht einfach fallen. Was wird wohl aus ihnen werden, aus Nina und Lonka? Es wäre gut, in der Zukunft lesen zu können. Und Motritsch? Motritsch ist erst vor kurzem seine Krücken losgeworden, er hatte sich eines Tages, als er besoffen war, das Bein gebrochen. Der Kroate trinkt unaufhörlich, es gibt kaum Hoffnung, daß er das einmal aufhört. Aber vielleicht hört er doch auf.
Und Genka? Schwer zu sagen. Was ist, wenn Sergej Sergejewitsch stirbt, wovon wird er dann leben, wie sein Geld verdienen? Trotzdem wird er eines Tages sterben… Es ist schwerer, sich die Zukunft von Genka vorzustellen als die Zukunft von Motritsch… Und M'sieur Bigoudi? Paul verachtet das Leben etwas zu sehr. Paul liebt Frankreich, darüber weiß er alles. Vor kurzem hat er der Bande seine neue Serie von Aquarellen gezeigt. Von der gleichen Farbe wie auf seinen verrückten Portraits sieht man da die Straßen von Paris und auf einmal keine Portraits. Etwas in der Art von Utrillo. Was soll das, zum tausendsten Mal die Straßen von Paris auf Aquarellen abzubilden? hat sich Ed gefragt, als er die Bilder betrachtete, trotzdem hat er mit tiefer Stimme gelogen, hat gesagt, daß ihm die Bilder gefielen. »Schönes Farbenspiel«, hat Ed bemerkt. M'sieur Bigoudi hat auf seine Bemerkung hin geschnaubt und geknurrt. Vielleicht verachtet er Ed und die anderen und haßt sie sogar, wie er die ganze Bevölkerung von Charkow haßt, dieses »Trampelpack«? Sehr gut möglich. M'sieur Bigoudi weigert sich sogar, mit der Bevölkerung zu reden, und wenn ihn irgendeiner auf der Straße etwas fragt, antwortet er bissig: »Ich spreche nicht Russisch!« Es fällt schwer, sich seine Zukunft vorzustellen. Er fühlt sich eingesperrt in Charkow. Aber auch in Moskau, wo Paul hin will, um eine Möglichkeit, nach Frankreich zu kommen, ausfindig zu machen, wird das dasselbe Trampelpack sein, vielleicht weniger vulgär als in Charkow, trotzdem aber Trampelpack. Ed hat sich davon überzeugt, als er dort war.
Nach Frankreich gehen… Schwer, aber nicht unmöglich. Ein Typ aus Charkow hat es geschafft, nach Brasilien zu gelangen, und ist dort Chef eines Nachtlokals geworden. Ginda, Annas Tante, lebt in demselben Haus wie die Mutter von diesem Alik. Alik hat es mit den denkbar legalsten Mitteln verstanden, nach Brasilien zu kommen. Der Bursche war einem sorgfältig ausgetüftelten Plan gefolgt, er ist qualifizierter Monteur geworden und ist mit anderen Bauexperten nach Polen geschickt worden, um dort ein Kombinat aufzubauen. Er hat eine Polin geheiratet und ist dageblieben. Ganz legal. Es ist nicht verboten, Polinnen zu heiraten und sich in Polen niederzulassen. Von Polen ist er nach Frankreich gegangen. Man sagt, das sei ganz leicht, die Polen verreisen ohne Schwierigkeiten, sie gehen nach Frankreich und kommen zurück, was man den sowjetischen Bürgern nicht erlaubt. Von Frankreich nach Brasilien zu gelangen, war kaum noch der Rede wert… Vielleicht wird Paul einen Weg ausfindig machen, in sein heißgeliebtes Frankreich zu reisen…
Wie heißt es noch bei Mandelstam, der jetzt in Mode ist?
Frankreich, im Namen von Mitleid und Erbarmen
Erflehe ich von deiner Erde und deinen Geißblättern
Die Wahrheit deiner Turteltauben und die Ungerechtigkeit
Deiner zwergenhaften Weinleserinnen mit ihren Gazebändern…
Das klingt gut. Und genau diese Erregung habe ich gespürt, sagt sich Ed, als ich die Farbphotos der Zeitschrift »Um die Welt« angeschaut habe, genauer: die Hutbänder der Weinleserinnen. Es wäre interessant herauszufinden, ob es »Um die Welt« schon in den dreißiger Jahren gegeben hat. Ed hat den Eindruck, daß es in Frankreich, ob sie dort nun Bänder tragen oder nicht, das gleiche Trampelpack gibt wie in Charkow. Hatte er es nicht schon bei seinen Reisen durch den Kaukasus, die Krim und die asiatischen Republiken der Sowjetunion getroffen?
»Kinder, trinken wir weiter?« schlägt Motritsch vor, der schon vor längerer Zeit seine leere Flasche unter die Bank gestellt hat. Sein Vorschlag erregt keine sonderliche Begeisterung. Die Kinder unterhalten sich träge, sie haben die Augen geschlossen, ihre Beine ausgestreckt und ihre Köpfe auf die Banklehnen gelegt. Nina hat ihren Kopf an Lonkas Schulter gelehnt. Selbst Fima und Viktor, die aktivsten, sind still. Viktor hat seinen Strohhut über die Augen geschoben und scheint als hitleristischer Ausbilder von einer Marschpause zu träumen. Es ist schön, obwohl zwischen ihnen und der Sonne die hohen schattigen Kastanienbäume stehen. Man sagt, daß an allen Bäumen Juden aufgehängt waren, als am 23. August die sowjetische Armee Charkow befreit hat. Vielleicht an diesen Kastanien…
In Charkow leben noch viele Juden, vor dem Krieg, so sagt man, waren es dreihunderttausend. Zweifellos ist es deshalb eine so geistreiche Stadt, denkt Ed. Da gibt es nichts zu deuteln, man wird niemals eine Zilja Jakowlewna mit irgend so einer Tante Mussej aus der Siedlung Saltow vergleichen. Seine Gattin Anna ist in einer jüdischen Familie natürlich ein Rowdy und eine Mißgeburt. Ein Revolutionär im Rock. Eine Anarchistin. Sie beschimpft ihren Onkel David als »dreckigen knauserigen Juden«, verspürt ihm gegenüber einen authentischen Klassenhaß. Onkel David ist Akademiker in irgendeiner Disziplin, er hat irgendwas mit Chemie, Physik oder dem Widerstand von Materie zu tun.
»Bei diesem fetten Ekel von Onkel ist die ganze Wohnung ein einziger Antiquitätenladen! Dieser Hurensohn weiß nicht wohin mit seinem Geld. Auf der Suche nach venezianischen Gläsern jagt er durch die Pfandleihhäuser… Und währenddessen sterben zwei ehrliche jüdische Frauen vor Hunger!« So leitet Anna ihre Philippika gegen ihren Onkel ein. Ihre Haßanfälle überkommen sie jedes Mal, wenn sie ihn seinen Hund ausführen sieht; die beiden Feinde treffen einmal im Monat unverhofft aufeinander. Seitdem Anna sich eines Tages an ihn rangeschlichen, ihm ins Gesicht gespuckt und ihm mit einer Monographie über Wrubel auf den Kopf geschlagen hat, führt nun immer häufiger die Haushälterin den Hund aus.
»Aber wir sterben nicht vor Hunger…«, widerspricht Ed normalerweise. »Warum glaubst du, daß man uns helfen muß? Aus welchem Grund?«
»Genau, Anna, warum soll David uns unterstützen?«
Die stolze Zilja Jakowlewna hebt die Schultern und nähert sich, in der einen Hand eine Zigarette, die andere auf die Hüfte gestützt. »Wir kommen auch ganz allein ohne David zurecht.«
»Weil, mein Engel Zilja, Papa Moissej, dein Ehemann, diesen Hurensohn von jüngerem Bruder ernährt und ihm das Studium bezahlt hat. Er ist dank Papas Hilfe Akademiker geworden. Papa hat ihm geholfen, als er an der Universität studierte. Und er ist uns kein einziges Mal besuchen gekommen, seit Papa tot ist und du mit zwei Töchtern am Hals allein warst. Er hat für uns niemals auch nur drei Rubel ausgegeben! Der dreckige knauserige Jude!«
»Anna, ich verbiete dir, solche Sachen in meiner Gegenwart zu sagen!«
»Natürlich, du bist ein Engel, Mama, du bist stolz… Du hast, ohne dich zu beklagen, in dieser schrecklichen technischen Bibliothek gearbeitet, du hast dich unter staubigen Büchern begraben, um niemanden um etwas bitten zu müssen. Es wäre nicht nötig zu bitten, es wäre nötig gewesen zu fordern, Mama!«
»Hör auf, Anna, man darf nicht so böse sein…«
»Man darf und man muß so böse sein! Ed, du hast das Photo von meiner Zilja in ihrer Jugend gesehen! Noch jetzt ist sie schön…« Anna faßt ihre Mutter an der Taille und betrachtet sie liebevoll — »schön sogar noch nach dieser schrecklichen nervösen Depression…«
»Anna hör auf, von dieser schmerzlichen Zeit unseres Lebens zu sprechen. Erinnere dich an die glücklichen Momente.« Zilja Jakowlewna zieht tief den Rauch ein.
»Nach dieser schrecklichen Depression hat sie sich in dieser technischen Bibliothek eingeschlossen, wo niemand sie sehen konnte. Eine schöne junge Frau… Hurensohn David. Das werde ich ihm nie vergeben!«
Ed ist von den Sagen der jüdischen Familie umgeben. Wie auf den Gemälden von Chagall fliegen Juden und Judenkinder da oben durch die Lüfte. Mit Säcken voller Sachen, die sie für die Familie »besorgt« hat, schwimmt Tante Ginda mit dem Kopf nach unten. Eine »Schufterin« und »Gewiefte«, wie Anna sie nennt, wenn sie von ihr spricht. Die fette Tochter von Ginda — Irkele — liegt in einen Pelzmantel gehüllt auf einem Daunenbett. Anna, die Anarchistin, ist neidisch wegen des Pelzmantels ihrer Cousine. Gindas Enkel Mischa (Ginda nennt ihn Mischkele) stößt mit seiner fleischigen Hand einen »General« weg, er mag nicht. Der »General« ist ein Sandwich mit Butter, Kaviar und — was für ein Schrecken!— darüber Marmelade! »Ich will nicht!« — »Dann geb ich es Ankele.« Ginda will ihm Angst machen. Immer bereit, Kaviar zu essen, schielt Anna, sie trägt ein rosa Kleid, nach dem Sandwich. »Dieser Unfähige«, Gindas Schwiegersohn Fima (auch er ist Ingenieur), der auf den Diwan geklettert ist, zieht mit finsterer Miene seine Hose an, wobei er sie hoch über den Boden hält, »um die Beine nicht schmutzig zu machen«. Aus den Wolken Chagalls taucht nun das Kanapee auf, auf dem die schöne, wie Anna grauhaarige Großmutter liegt — alle nennen sie, man weiß nicht warum, »Großmutter Brewdo«. Großmutter Brewdo in ihrem blitzsauberen Nachthemd mit kleinen Blumen; und ihre mondfarbenen Haare — schäumend wie bei allen anderen Rubinsteins — sind über das ganze Kopfkissen ausgebreitet. Auf ihren Haaren ruht ganz rund ein enormer Kater. »Das ist das Ende, Zilja. Ich kann mich nicht mehr aufrichten. Ich kann nicht mehr den Kopf vom Kissen hochheben.« — »Mama, Georgik schläft auf deinen Haaren!«
Sie sind komisch, die Juden, sagt sich Ed, komisch und anders. Man würde sich langweilen, wenn es in Charkow keine Juden gäbe. Es ist übel, wenn alle Welt sich gleicht. Wenn es in Charkow nur solide und schwerfällige Ukrainer gäbe, was wäre das langweilig. Die Juden bringen Leben nach Charkow, sie geben ihm einen Hauch von Markt, das ist der Orient. Unsere orientalischen Genossen…
»Was nun, trinken wir oder nicht? Schlaft ihr etwa?« Motritsch räkelt sich vor der Bank und schaut seitwärts irgendwo über Malvenbeete und andere üppige Pflanzen von Charkow zur Sumskaja-Straße. »Ah-Ah!« schreit Motritsch glücklich. »Da laufen die Jungs! Ich werde sie um ein paar Flaschen anhauen!« Motritsch springt auf die Beine wie ein Kind, er ist offenkundig sehr glücklich darüber, seine Krücken wieder los zu sein, und rennt weg.
Zurück kommt er mit dem Vosnessenskij von Charkow — Arkadij Filatow — und Oleg Schabelskij, einem Journalisten bei »Lenins Nachfolge«. »Unsere Genossen von der offiziellen Kunst möchten gerne mit den Genossen der linken Kunst einen trinken. Trinkt ihr mit der Boheme, Genossen?«
»Schnorrer.« Ed überrascht sich dabei, an Motritsch immer mehr Fehler zu entdecken. Ist das womöglich der normale Prozeß der Zerstörung eines einstigen Idols? Ed Limonow hat noch vergleichsweise wenig Erfahrung darin. Später wird er noch mehr als ein halbes Dutzend Idole zerstören müssen, aber an diesem Augustmittag des Jahres 1967 sitzt er eingeklemmt zwischen Genka und Sokolow auf der Bank und weiß noch nichts davon. Während er Motritsch zwischen der schwarzen Tasche des Journalisten Schabelskij und der schwarzen Tasche des Vosnessenskij von Charkow hin und her springen sieht, fragt sich Ed: Wie soll man sich im Leben verhalten? Es gibt zwei Strategien. Die erste: menschlich bleiben. Die zweite: den Leuten unsere Forderungen mitzuteilen, das ist die kritische Methode. Ed gebraucht sie immer häufiger gegenüber Motritsch. (Was wollen Sie, eine zwingende Notwendigkeit drängt ihn dazu, gnadenlos zu werden. Unmöglich, groß zu werden, ohne zu zerstören.)
»…Ich tauche und schwimme ohne Probleme.« Motritsch zieht an einer Zigarette, die er wie ein Dieb in der Hand verbirgt.
»Na und, du wirst schwimmen und dann…« antwortet Filatow ruhig.
Das Gesicht von Schabelskij hat diesen hochmütigen Ausdruck, den er immer zeigt. Er verachtet die Avantgardisten. Er ist zutiefst davon überzeugt, daß Motritsch, daß all die Dichter und die Maler, die sich im »Automaten« treffen, Analphabeten oder bloß Halbgebildete sind, und daß man, um etwas zu erschaffen, zuvor die Kunst der ganzen Welt verdaut haben muß. »Während du noch am Verdauen bist, schaffen wir in aller Ruhe unsere Meisterwerke. Verdau du nur!« hat eines Tages Motritsch geantwortet, als Schabelskij ihm wieder mal seinen Analphabetismus vorhielt.
»Nein, das ist nicht anständig«, mischt sich Viktor in das Gespräch ein. »Sie haben gerade gesagt, Arkadij, daß Herr Motritsch nicht in das Bassin des Spiegelbrunnens steigt, was er erst für fünfundzwanzig Rubel machen wollte und dann für zehn. Wenn er reinspringt, haben Sie gesagt, wird die Miliz ihn festnehmen. Darauf hat Herr Motritsch bemerkt, daß die hiesige Miliz seit langem schon darauf verzichtet, ihn festzunehmen, weil sie es satt hat, sich mit ihm abzugeben. Angeblich hat die hiesige Miliz unseren Dichter schon Dutzende Male festgenommen und kennt ihn zur Genüge. Und jetzt wollen Sie einen Rückzieher machen…«
»Oh, ich mache keinen Rückzieher.« Arkadij wird sauer. »Ihr wollt doch alle bloß saufen, Jungs… Für eine Flasche schwimmt Motritsch zehn Kilometer!«
»Also, wir glaubten nicht, daß Sie so primitiv sind, Genosse Repräsentant der offiziellen Avantgardekunst«, meint Lonka, der sich von Ninotschka gelöst hat. Sie geht, winkt allen zu und entfernt sich in Richtung Universität. Ihre Pause ist zu Ende.
»Na klar, wenn man sein Wort gegeben hat, muß man es auch halten.« Genka kommt den anderen zu Hilfe. Er ist immer sofort Feuer und Flamme, wenn sich auch nur die kleinste Gelegenheit für ein Abenteuer bietet.
»Das ist nicht in Ordnung!« brüllt der Weiße Bob. »Das ist nicht in Ordnung!«
Sogar M'sieur Bigoudi, normalerweise schweigsam, öffnet die Lippen und läßt fallen: »C'est pas bon, merde!«
»Wouahouh!! wouh!« schreit Ed als unartikulierte Unterstützung.
Es ist lächerlich und auch dumm, Arkadij so dreist und direkt auf den Arm zu nehmen. Er ist schließlich kein Trottel. Sie hätten ihm auch ganz einfach sagen können: Alter, wir langweilen uns, und es ist schon lange her, daß du uns eine Hasche spendiert hast. Filatow hat Geld, er ist Physiker, außerdem ist sein Vater General und irgendein hohes Tier an der Akademie von Charkow.
»Hol dich der Teufel, Wolodja… Ich wette, daß die Miliz dich festnimmt, wenn du im Spiegelbrunnen badest. Ich setze zehn Rubel.«
»Fünfundzwanzig, daß sie mich nicht festnehmen und ich nackt bade«, erneuert Motritsch seinen Vorschlag.
»Das ist ein bißchen viel für das zweifelhafte Vergnügen, deine kroatischen Knochen und deinen schrumpeligen Schwanz zu sehen. Ich habe keine fünfundzwanzig Rubel, du Schnorrer. Ich habe bloß einen Zehner!«
»Los, gehen wir«, sagt Motritsch zufrieden zur Bande. Die Jungs stehen auf, lockern ihre Beine und strecken sich. Viktor macht mit durchgedrückten Knien Gymnastikbewegungen: er berührt mit seinen Handtellern seine offenen Sandalen. Seine Zehen sind gekrümmt. Offenbar hat er den ganzen Winter über zu kleine Schuhe getragen.
21
Daß die Milizionäre auftauchen würden, war klar. Sie patroullieren ständig in den Anlagen beim Spiegelbrunnen. Immerhin ist hier das Stadtzentrum, da muß Ordnung herrschen. Ihr Auftritt kommt aber trotzdem überraschend: plötzlich stehen sie da zwischen den Trauerweiden, die ihre langen Zweige in dem von einer Zementeinfassung umrandeten Weiher baden.
»Bürger! Hören Sie auf und kommen Sie raus!« An einem anderen Ort hätten die Milizionäre Motritsch mit ordinären Flüchen überschüttet, nicht aber hier, am Weiher. Zuschauer haben sich auf der albernen Steinpagode über dem Bassin versammelt, Kinder plärren, Frauen kreischen und beäugen, erregt und geniert zugleich, den amphibienhaften Motritsch, der schließlich doch nackt ins Wasser gesprungen ist. Um Arkadij für seine zehn Rubel ein vollwertiges Spektakel zu gönnen.
»Ihr Scheißer!« antwortet Motritsch. »Ich komm nicht raus. Kommt doch selbst her.« Motritsch lacht im Wasser. Der weiße Körper des Kroaten schwimmt zur Mitte des Beckens und legt sich auf den Rücken, sein dunkler kroatischer Dichterschwanz plätschert im Takt seiner Beine.
»Bürger! Hören Sie auf mit dem Unfug, dies ist ein öffentlicher Ort!« Die dicken Lippen des älteren Milizionärs formen nur mit Mühe die ungewöhnlich höflichen Sätze. Mit seinem kräftigen Gesicht, seinem gedrungenen Nacken ist der etwa fünfzigjährige Wachtmeister zweifellos stärkere Ausdrücke gewohnt. Der andere Bulle, ein Bursche vom Land, ist noch jung, kaum halb so alt wie sein Vorgesetzter; er ist bestimmt gleich nach dem Militärdienst in die Miliz eingetreten. Früher gab es auf den Straßen Charkows nur alte Bullen. Inzwischen sieht man immer häufiger auch junge. Sie sind Trampel wie die älteren, aber weniger bösartig.
»Bürger! Sie bekommen 15 Tage für Erregung öffentlichen Ärgernisses! Kommen Sie sofort ans Ufer!« Ein Milizstiefel hat sich am Beckenrand aufgestellt, während der andere gewissenhaft die sorgsam gesetzten Margueriten niederstampft. Die Blätter der Trauerweide hängen dem Wachtmeister über die Schulterstücke wie Achselschnüre. Der junge Bulle scheint sich zu fragen, ob auch er in die Blumenbeete trampeln oder auf dem Teerweg bleiben soll. »Bürger, kommen Sie ans Ufer!«
»Warum soll ich rauskommen, um 15 Tage zu brummen? Mir gefällt es hier. Es ist kühl…« Motritsch wirft die Arme nach vorn und springt wie ein Delphin bis zur Brust aus dem Wasser, um zu zeigen, wie gut es ihm geht.
»Oh! Oh! Bravo! Eine menschliche Amphibie! Oh! Oh!« Die Menge, die sich allmählich um das Becken herum versammelt hat, schreit, pfeift, seufzt entzückt. Normalerweise langweilt man sich im staubigen und wasserlosen Charkow, selbst beim Springbrunnen.
Eh! Matrose! Du bist zu lange zur See gefahren!
Ich hab dich endlich vergessen.
Ich hab jetzt einen Seeteufel,
Per mir gefällt, ihn will ich lieben…
Motritsch hat plötzlich den Titelsong des Films »Der Amphibienmensch« angestimmt, der gerade in den Kinos von Charkow gelaufen ist. Er dreht sich in einem Sonnenfleck, prustet fröhlich und schreit von neuem: »Ihn will ich heben!«
»Ihn will ich heben!« brüllt Viktor begeistert.
»Ihn will ich heben!« stimmt der Weiße Bob ein.
Der magere und bleiche Physiker, der Vosnessenskij von Charkow schreit zwar nicht, daß ihm ein Seeteufel gefällt, aber die Situation gefällt ihm. Ein solches Vergnügen für zehn Rubel!
»Bürger! Ich warne Sie zum letzten Mal. Kommen Sie raus! Wenn nicht, wird das böse enden!« Der Wachtmeister wird knallrot vor Ohnmacht und Haß. Der kleine Bulle dagegen lächelt.
»Und was wirst du mit mir machen, Chef?« fragt Motritsch, der jetzt schnell zur Pagode schwimmt, als ob er dort aus dem Wasser kommen wollte. Die Bullen laufen an der Einfassung entlang zur Pagode. Motritsch aber, der einige Zentimeter vom Rand entfernt angehalten hat, wendet unter Wasser und schwimmt, die Arme machtvoll nach vorne werfend, zurück in die Mitte des Beckens… Von der Pagode aus droht ihm der Wachtmeister mit der Faust. »Ich hab jetzt einen Seeteufel, der mir gefällt, ihn will ich heben!…« singt Motritsch.
»Ein Volksvergnügen. Der Herr Dichter Motritsch nimmt in aller Öffentlichkeit ein Bad…« Die sarkastische, tiefe, gesetzte Stimme gehört ohne Zweifel Jurij Miloslawskij. Marionettenspieler, Dichter, Märchenerzähler (Rundfunksprecher), Autor der alptraumhaften surrealistischen Abenteuer von »Petja Fettarsch« — Miloslawskij ist eine bedeutende Persönlichkeit in der Charkower Szene.
Ed dreht sich um. Er hat sich nicht getäuscht. Vor sich sieht er das skeptische Gesicht Miloslawskijs. Daneben das Gesicht des jungen pickeligen Dichters Wernik, der eine weniger gelungene skeptische Miene aufgesetzt hat. »Der Herr Dichter Walroßitsch badet…« Wernik versucht, genauso sarkastisch wie Miloslawskij aufzutreten.
»Seid gegrüßt, Zionisten! Wie geht es dem internationalen Zionismus?« Die Dreckschleuder Filatow stürzt sich glücklich auf den ewigen Widersacher. Arkadij betrachtet Miloslawskij als seinen Rivalen, obschon es keine Frau zwischen ihnen beiden gibt. Filatow ist neidisch auf Miloslawskij, auf dessen Erfolg beim Publikum und in Charkow, auf seine Bewunderer, auf die Jungen, die Jurij ständig umringen. Sie werden sich erinnern, die beiden sind am Geburtstag des jungen Limonow aneinandergeraten.
»Dem internationalen Zionismus geht es gut. Wie Sie wissen, geschätzter Widersacher, waren unsere Panzer im Juni nur noch 50 Kilometer vor Damaskus.« Belustigt über diese Imitation eines Salongespräches senkt Miloslawskij den Kopf.
»Warum, Jurij, sind Sie nicht rechtzeitig auf die Golanhöhen ausgerückt, warum haben Sie sich nicht bei Eilath und Kuneitra mit den Syrern geschlagen?« Arkadij liebt es, seine Physiker-Allwissenheit auszubreiten. Wo hat er die Namen dieser Orte her, um die die Israelis mit den Syrern während des Sechs-Tage-Krieges gekämpft haben? Aus den Zeitungen zweifellos. Hat sie sich eingeprägt, der bildungsbeflissene Physiker…
»Wie Sie wissen, geschätzter Widersacher, gibt es Kommunikationsprobleme zwischen dem Gelobten Land und der Stadt, auf deren Asphalt wir hier jetzt stehen und zusehen, wie der berühmte Dichter und Alkoholiker in einem Becken mit chloriertem Wasser badet…«
»Er ist entkommen!« schreit Viktor. »Nackt…« Viktor und Lonka, der Motritschs Sachen in der Hand hält, brechen in Jubel aus… Motritsch hat die Milizionäre zu täuschen verstanden, indem er sich plötzlich an einer Stelle aufs Trockene gerottet hat, auf die sie nicht achteten — nun trampeln sie hinter dem nacktärschigen Dichter her, der die Hauptallee entlanggaloppiert und die Passanten erschreckt. Plötzlich biegt er ab und springt in ein Gebüsch. Von der Allee aus sieht man, wie die beiden Milizionäre in das Gebüsch gucken, aber zögern, dort einzudringen. Der jüngere fängt plötzlich an zu lachen. Einem nackten Mann nachzulaufen, ist sogar für einen Milizionär in Charkow eine amüsante Beschäftigung.
»Setzen wir uns?« schlägt Miloslawskij vor, als wäre er bei sich zu Hause und lade seine Gäste ein, Platz zu nehmen. Er ist hier auf heimischem Territorium. Beim Spiegelbrunnen befindet sich das Hauptquartier der Zionisten. Es wäre zwar falsch zu behaupten, daß sich auf diesen wenigen Bänken, die am oberen Ende der Anlage, parallel zur Sumskaja, stehen, nur Zionisten treffen, aber Miloslawskij und seine Freunde hocken dort häufiger und länger als alle anderen.
Neben Miloslawskij und Wernik gehören noch ein älterer Typ, Isja Schlaffermann, und ein Dutzend weiterer Leute, die eher eine Nebenrolle spielen, zu den Zionisten: Ed Siganewitsch, Kostja Skoblinskij, der Professorensohn Wladik Semernin, der sich plötzlich Jude nennt…
»Durchaus…« Arkadij kratzt sich den kurzrasierten Hinterkopf. Eine häufige und unbewußte Geste des Vosnessenskij von Charkow.
»Trotzdem wäre es nicht schlecht, Wolodja wiederzufinden. Ich habe ihm immerhin zehn Rubel versprochen…«
»Oh, nur keine Unruhe, geschätzter Widersacher! Herr Motritsch wird SIE finden und die zehn Rubel, die Sie ihm schulden. Wo auch immer Sie sein mögen!« Miloslawskij ist grausam. Er verzeiht Papa Motritsch seine Schwächen nicht.
»Genug, ihr habt genug über Motritsch gelästert…« Ed wundert sich selbst über seine Intervention zugunsten von Papa Motritsch. »Er ist jemand, auf seine Weise! Entfernt Motritsch aus Charkow, und es würde langweilig werden.«
»Ich kapituliere! Ich kapituliere!« Miloslawskij hebt die Arme. »Ich habe nichts gegen den Genossen Motritsch.« Und er fügt boshaft hinzu: »Ich sitze bloß nicht gern neben Pissern. Aber davon abgesehen, ist der Genosse Motritsch ein guter Genosse.«
Sie setzen sich auf zwei Bänke. Schon wieder. Von einer Bank zur nächsten zu wechseln, gehört zum Sommerleben der Charkower Dekadenzler. Die Zweige der Weide, die hinter den Bänken wächst, hängen weit über die Jungs hinweg bis auf den brüchigen und pflanzenüberwucherten Asphalt; die festen Wege im Park sind seit undenklichen Zeiten nicht mehr ausgebessert worden. Vor der Bank, auf der sich Miloslawskij, Arkadij, Genka und Schabelskij niedergelassen haben, sieht man tiefe Spuren im Erdreich. Im Sommer haben die Zionisten den Boden hier mit den Füßen regelrecht umgepflügt, so sehr haben sie gelitten. Im Juni hat der Sechs-Tage-Krieg stattgefunden. Wer die Bande von Miloslawskij »Zionisten« genannt hat, läßt sich heute nicht mehr sagen. Der wichtigste Schöpfer von Redewendungen und Spender von Spitznamen in Charkow ist, versteht sich, Bach.
Wernik, M'sieur Bigoudi und der Weiße Bob sitzen auf der zweiten Bank.
Bei den Dekadenzlern gibt es strenge hierarchische Strukturen, und die Rangfolge wird von allen anerkannt. Deshalb kommt es Miloslawskij durchaus zu, neben Filatow, Ed, Genka und Schabelskij zu sitzen. Auch Wernik nimmt sich manchmal dieses Recht heraus, aber seinem Rang entspricht es eigentlich nicht. Sind Miloslawskij, Ed und Wernik allerdings nur zu dritt, dann ist es natürlich klar, daß sie zusammen auf einer Bank hocken.
»Da sitzen sie ja schon wieder, unsere Grünschnäbel!« Erfrischt, lächelnd, die Haare naß und unterwegs gekämmt, taucht Motritsch in Begleitung von Lonka Iwanow und Viktor hinter ihrem Rücken auf. »Nun, Arkadij, habe ich Anspruch auf deine zehn Rubel?«
»Du hast, du hast…« Filatow schiebt schnell einen rosa Zehnrubelschein in Motritschs Hand.
»Jetzt gibt's was zu trinken. Ich lade euch zu mir ein«, erklärt Motritsch stolz. Und angesichts des Staunens, das er auf allen Gesichtern liest, fügt er hinzu: »Mama ist für eine Woche aufs Land gefahren. Geht aber bitte höchstens in Gruppen zu dritt!«
Aha, jetzt ist alles klar. Wenn Motritschs Mama, eine einfache, strenge, noch keineswegs alte Frau zu Hause ist, lädt Motritsch niemals Freunde zu sich ein.
22
Eines Tages gab es plötzlich überall Juden. Vorher waren sie alle Dichter, Maler, Philosophen, aber im Juni unterteilte sich die Dekadenz in Juden und den Rest. Wladik Semernin, der bis dahin Russe war, nannte sich nun Jude. Sein Vater war Russe, seine Mutter Jüdin. Und er entschied sich, Jude zu werden, weil es Mode geworden war, Jude zu sein. Wegen des Sechs-Tage-Krieges. Wegen der Siege der israelischen Armee, die Miloslawskij und seine Freunde täglich überheblicher werden ließen. Man entdeckte, daß der israelische Soldat der beste Soldat der Welt und der israelische General Moshe Dayan der beste General der Welt ist. Als Ed sich erlaubte, an der Tapferkeit des israelischen Soldaten zu zweifeln und meinte, wenn man den Israelis statt der schlecht organisierten und korrumpierten arabischen Armeen die sturen russischen Soldaten gegenüberstellen würde, dann würde man ja sehen, ob der israelische Soldat immer noch so tapfer wäre, da sagten die Zionisten, berauscht von den Siegen ihrer Nation, der israelische Soldat würde auch die Russen besiegen. Ed schnaubte spöttisch. Von ihren Bänken beim Spiegelbrunnen aus betrachten die Zionisten die Stadt Charkow, in der sie leben, mit immer größerer Anmaßung und Verachtung. Zwar hebt auch Ed Limonow diese Hammelherde nicht, der zu entkommen ihm soviel Schwierigkeiten bereitet hat, und er weiß, was er von ihr zu halten hat. Aber das Gemecker der Zionisten über das russische Volk ist sogar ihm unangenehm. Da kommt so ein Wanja aus der Fabrik an ihrer Bank vorbei: Angetrunken, in einem unförmigen und viel zu warmen Anzug, ist er aus der Vorstadt ins Stadtzentrum gekommen, um seine Frau und seine Kinder auszuführen, seine Hosenbeine schleifen über den Boden, er ist abgestumpft und benommen von der Hitze und dem Wodka — ein wahrhaft abstoßender Anblick… Und da sind die Zionisten auf ihren Bänken in ihrem Element, kichern und geben Kommentare ab. »Ihre Hoheit, die führende Klasse, ergeht sich…« Die Vasallen von Miloslawskij strengen sich besonders an. Dieser picklige und stotternde Wernik verzieht sein Gesicht — er sollte besser sich selbst ansehen, mit seiner pickelnarbigen Fresse — und ahmt die schwerfällige Sprechweise des Prolos nach, der schon längst mit seiner linkischen Familie hinter einer Biegung der Allee verschwunden ist. »Jurij, wenn Sie alles hier so sehr verabscheuen«, bemerkte Ed eines Tages zu Miloslawskij, »warum verlassen Sie dieses Land dann nicht?«
»Wie denn, Ed?« fragte Miloslawskij trocken und sah ihn an. »Sags mir.« — »Wenn man wirklich will, kann man abhauen. Der Sohn der Nachbarin von Annas Tante Ginda ist nach Brasilien gegangen. Er wollte nach Brasilien und hat es geschafft.«
Ed erzählte Miloslawskij die Geschichte von Alik, dem Monteur, und fügte hinzu: »Wenn man hartnäckig und charakterstark genug ist, kann man die Sowjetunion verlassen. Man kann auch ein Mädchen aus einem sozialistischen Land heiraten. Eine Polin oder eine Tschechin. Alle sagen, es sei eine Kleinigkeit, aus einem osteuropäischen Land auszureisen.« — »Mich läßt man nicht einmal in ein sozialistisches Land ausreisen«, sagte Miloslawskij ruhig. »Ich bin sicher, daß es über mich schon seit langem ein Dossier beim KGB gibt. Man muß sich auszeichnen, um in ein anderes sozialistisches Land zu kommen, eine saubere Biographie haben, und darauf muß man sich, wie man sagt, schon von frühester Kindheit an vorbereiten.« Miloslawskij lächelte auf eine besondere Weise, als wenn er Mitgefühl für die treuherzige Dummheit seines Gesprächspartners empfände. Jurij ist ein paar Jahre jünger als Ed, aber er tritt gönnerhaft auf und sieht älter aus. Er ist ein geborener Führer, die Jungen scharen sich spontan um ihn. Miloslawskij läuft, seinen massigen Kopf verächtlich in den Nacken geworfen, mit weitausholenden Schritten durch die Straßen von Charkow; an seiner Seite traben schmächtig seine Freunde und schnappen die Phrasen auf, die er fallen läßt. Unmöglich, Miloslawskij einmal ohne Begleitung anzutreffen, er ist ein geselliger Mensch. Jurijs Großvater war auch ein geselliger Mann und ein Führer, er war der Vorsitzende der ersten Parteischule von Charkow. Jurij ist so etwas wie der Vorsitzende einer Anti-Parteischule.
Verweilen wir hier kurz bei einem Ereignis, das sich im Februar 1967 ereignet hat — einem Ereignis, das Anna Moissejewna hernach »Eds erste Lesung« nannte —, denn es brachte, allerdings nicht für lange Zeit, Ed und Miloslawskij einander näher. Im Winter 1966/67 hatte der Dichter Limonow sich plötzlich (bloß für einen Winter!) der Prosa zugewandt und hatte zu seiner großen Überraschung dreißig Erzählungen geschrieben. Anna Moissejewna wünschte nun sehnlichst, vielleicht aus Sorge um ihrer beider Platz in der Hierarchie der Charkower Dekadenz, daß ihr Dichter sein Werk der Welt vorstelle. Kurzum, sie wollte alle schlagen und das Zimmer am Tewelew-Platz 19 in einen Salon Mme Récamier-Rubinstein verwandeln. Jeder Salon braucht mindestens ein Genie. Anna Moissejewna hatte eins, nun mußte sie es nur noch fertigbringen, daß die Welt es auch gebührend zur Kenntnis nahm. Wo aber Ed und seine Werke vorstellen, auf daß alle Welt ihn sah und bewunderte? Anna vereinbarte mit einem gewissen Boris Aleksejewitsch Tschitschibanin, der seine sechzig Rubel monatlich damit verdiente, daß er einmal in der Woche im dreckigsten Saal des Kulturhauses der Miliz die schrecklichen poetischen Werke von unbegabten jungen Menschen und senilen Alten anhörte, daß Ed in seinem »Seminar« seine Werke vortrug. Ed, der eine heftige Abneigung gegen den »Solschenizyn von Charkow« verspürte (so hatte er den großgewachsenen, rothaarigen und bärtigen Tschitschibanin getauft), hatte zunächst protestiert, dann aber zugestimmt. In jener Zeit hatte jedes mehr oder weniger große kulturelle Zentrum in der Provinz seine lokalen Solschenizyns, ebenso wie es überall einen örtlichen Vosnessenskij gab. Ed hatte überhaupt keinen triftigen Grund dafür, Tschitschibanin nicht zu mögen, aber der ehemalige Häftling hatte ihm von Anfang an nicht gefallen. Die Zionisten dagegen, mit Miloslawskij an der Spitze, schätzten und respektierten Tschitschibanin und fanden sich häufig im Kulturhaus der Miliz ein; sie hatten sich dort regelrecht eingenistet. Am Tag der Lesung ließ der Solschenizyn von Charkow mitteilen, daß er krank sei. Ob er das wirklich war oder ob er — die ihm entgegenbrachte Feindlichkeit mit Feindlichkeit erwidernd — unseren Helden ebensowenig mochte wie dieser ihn und sich deshalb seine Werke nicht anhören wollte, wird für immer ein Rätsel bleiben. Wie dem auch sei, ein schnurrbärtiger und furchtsamer Dichter mit einem sehr jüdisch klingenden Namen, den Ed sofort vergaß, leitete an diesem Tag anstelle von Tschitschibanin das Seminar. Er war Autor eines kleinen Gedichtbandes mit grünem Einband, den der Charkower Verlag herausgebracht hatte. Miloslawskij und seine Bande kamen und setzten sich alle hinten hin, wobei sie mit den Stühlen klapperten und wie üblich höhnisch kicherten. Ein Dutzend alter Literaturfreunde und -freundinnen saß in den ersten Reihen. Den Hauptdarsteller des feierlichen Ereignisses erinnerte der verwahrloste Saal mit seinen Zuhörern an einen Gerichtssaal. Er hatte — nach außen hin ruhig, tatsächlich aber mit schrecklichem Lampenfieber (es war immerhin seine erste »offizielle« Lesung) — zwei Erzählungen vorgetragen. Wir wollen hier nur die eine, die Erzählung »Der Fleischer«, näher betrachten, weil gerade sie das Publikum stark bewegte. Der Held der Erzählung war der Fleischer Okladnikow, der zwar sein reales Vorbild hatte — den Roten Sanja, Eds Kindheitsfreund, den der Dichter aus seiner Vergangenheit ausgegraben hatte —, den er aber in eine surrealistische, lastende und beunruhigende Atmosphäre gestellt hatte, die an »Hoffmanns Erzählungen« und die Thriller des 20. Jahrhunderts erinnerte, von denen unser Held damals nicht die geringste Ahnung hatte.
»Der Fleischer« frappierte das Publikum. Der zerstreute schnurrbärtige Dichter erklärte laut und vernehmlich, die Erzählung sei genial. Ein alter, kahlköpfiger Literaturfreund wollte irgendwas über die »bedrückende Atmosphäre« der Erzählung stammeln, aber die Zionisten buhten und pfiffen ihn aus. Die Erzählung gefiel ihnen, diesen Räubern und Allesverleumdern. (Hauptsächlich vor ihrem Urteil hatte Ed Limonow sich gefürchtet.) Beim Ausgang sagte Miloslawskij ihm, er habe nicht erwartet, daß Ed Limonow solch eine Prosa schreibe. »Und was glaubten Sie, was ich schreibe?« fragte, nun schon herausfordernd, der Autor der Erzählung »Der Fleischer«.
»Was schon, etwas Französelndes… Etwas Baudelaireartiges…«
Ed wollte sagen, daß man Miloslawskijs Gedichten einen vulgären Romantizismus vorwerfen könne (wie anders sollte man etwa folgende Zeilen charakterisieren: »Oh Lautrec, hast du heute schon alle Bars abgegrast? Hast du alle Frauen begrapscht?«…?), aber weil er in der großmütigen Stimmung des Siegers war, sagte er nichts. Statt dessen lud er Miloslawskij zu seinem Geburtstag ein. Zu diesem berühmten Geburtstag, zu dem Miloslawskij und Wladik Semernin Ed eine Parodie auf seine Erzählung »Der Fleischer« mitbrachten, die sie geschrieben hatten. Eine Witwe mit zahllosen Kindern war die Heldin. Später, als er durch Länder und ganze Kontinente vagabundierte, verlor Ed die Parodie, die mit großen Buchstaben in rotschwarzer Tinte auf Pergament geschrieben war; im Gedächtnis blieben ihm bloß die Verse:
Und die Witwe ging durch die boshaft zischelnden Flure zur Küche
Wo ihre Kinder es trieben, den Mitbewohnern zum Trotz…
Auch das Original, die Erzählung »Der Fleischer«, verschlang die Zeit: Sie gähnte, streckte sich und schluckte es mit einem Glucksen, genauso wie die neunundzwanzig anderen Werke, die Ed in diesem Winter geschrieben hatte. Von unserer jetzigen Position aus, Leser, sehen wir, daß der Ausruf »Genial!«, mit dem der offizielle sowjetische Dichter mit jüdischem Namen die Erzählung »Der Fleischer« bedacht hatte, an der Realität vorbeiging. Es wäre angemessener gewesen, stattdessen »Originell!« auszurufen. Tatsache ist, daß unser junges Talent die Erzählung auf außergewöhnliche Art und Weise konstruiert hatte. Die jungen Talente der Epoche zitierten entweder Andrej Platonow, den man gerade wiederentdeckte, oder die kraftlose Prosa Pasternaks, die den Kopf sprengende Prosa der Zwetajewa oder schließlich den einschläfernden Stil Andrej Belyjs. Unser Mann dagegen hatte es in diesen Jahren verstanden, während er unter der strengen und wachsamen Aufsicht des rundgesichtigen Tolja Melechow Tausende von grauen Papierblättern vollschrieb, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Nachdem er ihn in seinen Gedichten entwickelt hatte, verwendete er ihn automatisch wieder in seinen Prosaversuchen. Diese frische Art zu schreiben, fußte auf dem volkstümlichen Vers mit seiner freien Rhythmik und erinnerte (was unserem Dichter zur Ehre gereicht) an nichts. Welcher Richtung hätte man sie auch zuordnen sollen, alle diese: »›Luftballons! Luftballons!‹ ruft er, ›Nehmt mich mit!‹, und als er sich mit einem Fuß abgestoßen hat…« Nein, die Versuche unseres Dichters erinnerten in nichts an die schwülstige Deklamationspoesie jener Jahre. (Es steht zu vermuten, daß wir das Farbenprächtige, Malerische der Werke des damaligen Ed Limonow dem Einfluß verdanken, den die jüdische Familie auf ihn ausübte, in der er lebte: den blumigen Ausdrücken Anna Moissejewnas und Zilja Jakowlewnas, den Legenden und Mythen des jüdischen Milieus, in das unser Goj noch im zarten und aufnahmebereiten Alter geraten war. Seine Luftballons und das gestreckte Bein — erinnern sie nicht an die wohlbekannten Gemälde Chagalls mit ihren Liebhabern, die sich eben von der Erde in den grünen Himmel emporgeschwungen haben?)
Aber unser Ziel ist es weder, eine Untersuchung über das poetische Werk von Limonow durchzuführen, noch den Einfluß zu ergründen, den die jüdische Folklore darauf ausgeübt haben könnte, sondern eine bescheidenere Aufgabe, nämlich die Details des Prozesses festzuhalten, der einen Arbeiter und Ex-Ganoven in einen Dichter verwandelte. Von den Zionisten her wehten unseren Helden der süße, bunte Rauch und die Gerüche der Folklore nicht an. Die Zionisten, die so sehr darauf beharrten, Juden zu sein, waren Juden ohne Geruch und Geschmack, während Anna Moissejewna, die sich als eine Degenerierte betrachtete, in Wirklichkeit eine prächtige jüdische Rose war. Es stimmt, daß von Zeit zu Zeit ein Anfall von Wahnsinn die Rose überkam, aber danach duftete sie um so mehr. Der ehemalige Gießereiarbeiter hatte das Glück, ihre Bekanntschaft gerade nach einem solchen großen Anfall gemacht zu haben, der nächste würde die Rose erst 1970 welken lassen. Unter den Zionisten gab es vielleicht nur einen »wahren« Juden, ihr ältester und zugleich jüngster Anhänger, Isja Schlaffermann; untersetzt, mit breitem Rücken, erinnerte er mit seinen Lippen, seiner Nase und seiner beginnenden Glatze an Babel. (Es gibt einen ganz bestimmten jüdischen Typ, der an Babel erinnert, doch nicht alle jüdischen Männer, Leser, erinnern ebenso an Babel.) Unser Held war in die Vorstadtbaracke von Isja gekommen und hatte dort diese besondere stickige Luft wiedergefunden, die — wie er glaubt — in den jüdischen Häusern hängt, und den Geruch nach Naphtalin, der sich mit dem nach Hering vermischt, und den Vater in langen Unterhosen und die schnarrend sprechende grauhaarige Mutter. Wer hatte dem jungen Ukrainer Sawenko eingeredet, was ein jüdisches Haus sei und wie es riechen müsse, wird sich der Leser fragen. Die Erfahrung, oh geschätzter Leser! Denn in dem Haus seines Klassenkameraden Jascha Slawutzkij roch es nach einer Mischung aus Hering und Naphtalin, und als er dann größer wurde, glaubte der junge Ukrainer weiter, daß es in allen jüdischen Häusern nach Hering und Naphtalin riechen müsse. Und da sich die Freundin der jungen Mutter des kleinen Ukrainers, die Jüdin Rosa, die in einem Kiosk an der Straße der Roten Armee Seife, Wolle, Eau de Cologne und andere medizinische und Hygieneprodukte verkaufte, seinerzeit über die Romane George Sands — wie »Consuelo« oder »Die Comtesse von Rudolstadt« — mit ihren abgegriffenen, vergilbten Seiten gebeugt hat, versucht der junge Ukrainer 20 Jahre später (vergeblich), unter den Büchern von Anna Moissejewna ein noch abgenutzteres Exemplar von »Consuelo« zu entdecken.
*
Gleich nach dem Sechs-Tage-Krieg wurden sie ganz wild. Mit einem Mal war es möglich, mit einer Handbewegung die persönlichen Mißerfolge, die Willensschwäche, das Schläfrige, die Zaghaftigkeit oder den Mangel an Talent auszulöschen, indem man sich als Jude bezeichnete und damit die Gründe für alle Mißerfolge auf das Land übertrug, das einem fremd war und wohin einen das Schicksal verschlagen hatte. Der Pharao verkörperte von neuem das Böse, die Juden das absolut Gute. Ohne Moshe Dayan mit seiner Augenklappe à la Stevenson oder seine Jungs — die Post-Guderian-Panzerfahrer, die durch den Staub der Straßen nach Bagdad rollten — um Erlaubnis zu bitten, bemächtigten sich die jungen Juden der Welt und Charkows dieses Sieges, sie saugten sich eigenmächtig an ihm fest. Über jeder zivilen jüdischen Jacke (Ed sah das, auch wenn die Prolos es nicht sahen) prangte der Tarnanzug eines Fallschirmjägers. Die Panzer, die auf der Straße nach Bagdad stehengeblieben waren, versanken bis zu den Geschütztürmen in der Erde unter dem Gewicht der jungen Juden, die freiwillig aus der ganzen Welt, auch aus Charkow, dorthin gestürmt waren.
Die Juden hatten, das war klar, ein großes Bedürfnis nach diesem Sieg. Als zurückgebliebenes orientalisches Volk (vergleichbar mit den Indern, die ihre Unabhängigkeit von den Engländern erst 1947 errangen!), hatten sie ihre Unabhängigkeit erst spät erhalten. Ach, mögen sie glücklich werden auf ihrem Fetzen Papier mit ihrer Unabhängigkeit! Die »Zionisten« saßen wie Helden in der Anlage beim Spiegelbrunnen, sie ließen ihre Brillengläser wie Auszeichnungen oder Orden blitzen und machten die infame örtliche Bevölkerung, die mit den besiegten Arabern verbündet war, lächerlich, war sie damit doch selbst bezwungen und bestand sie doch weder aus Helden noch aus Panzerfahrern, sondern bloß aus linkischen, fetten und angetrunkenen Prolos. Was machen wir hier? schienen die Zionisten sich zu fragen. Warum sind wir nicht zu Hause, sondern im Land der Freunde unserer Feinde? Schnell nach Hause, zu unseren Panzern, zu unserem Sieg, nach Hause…! Aber sie wußten noch nicht, wie sie dort hinkommen sollten. Darf man sie für diesen spontanen Nationalismus verdammen, der so plötzlich in ihnen aufgeflammt war? Diese Statisten, diese Menschen, die ihren Mantel immer nach dem Wind hängen — wessen sie beschuldigen? Sie brauchen immer eine gemeinsame Sache, an die sie sich klammern können, um ihre individuelle Nichtigkeit zu überwinden. Den begabten Miloslawskij aber kann man verurteilen. Das Talent hat kein Recht, sich als zusätzlicher namenloser Körper in den Geschützturm eines nationalen Panzers zu zwängen. Auch nicht im Alter von zwanzig Jahren, in dem das Bewußtsein noch wenig entwickelt ist.
23
Man konnte die staubige Stadt Charkow in diesem kritischen Moment, wo der Sommer in den Herbst übergeht, mit einer welkenden, fieberheißen Chrysantheme vergleichen; giftig blühten tausende dieser Blumen in jenem August in der Stadt. Man konnte Charkow aber auch mit Anna Moissejewna vergleichen, mit ihrem erstaunlich üppigen, weißen, leicht welkenden Körper: mit dem ungeschnürten Heisch ihres mächtigen Hinterteils, mit ihren flinken, dickschenkligen Beinen über ihren kleinen Füßen. Dekadent, verdrossen, schön und furchtbar wie Anna Moissejewna, oh Heimatstadt des Helden! Später wird sich Ed der Stadt wie auch Annas schämen, aber gleichzeitig Stolz darüber empfinden, in so jungem Alter eine solche grauhaarige und halbverrückte Freundin gehabt zu haben. Charkow wird, wie Anna Moissejewna, der unumstößliche Beweis für den Ernst und die Tragik unseres jungen Mannes sein, und der Einfluß dieser häßlichen und beleidigenden Stadt, in der er dazu verurteilt war, sich zu bilden, wird sich auch dann noch in ihm bemerkbar machen, wenn er sich schon hunderte von Meilen von ihr entfernt hat…
Die jungen Leute durchqueren zum x-ten Mal den Schewtschenko-Park, biegen in die Rymarskaja-Straße ein, und nachdem sie einen Bogen um die Großmutter von Motritsch geschlagen haben, die nahe bei der Oper geröstete Sonnenblumenkerne verkauft, bleiben sie stehen und gehen in kleinen Gruppen in das Zimmer des »Kleinen Menschen aus Holz«. »Der Kleine Mensch aus Holz« Motritsch wohnt nicht in einer Mansarde, zu der man über eine hundertstufige Wendeltreppe gelangt. Motritsch wohnt in einer Behausung, deren Tür sich hinter der Chiffonniere im Zimmer seiner Mutter befindet. Ein Flur von zehn Metern Länge, eng wie ein Darm, führt von dort zu seinem Zimmer. In den Jahrhunderten der Existenz dieser Stadt haben sich in den Tiefen ihrer Eingeweide geheime Höhlen und Labyrinthe entwickelt, Ausgeburten des Zufalls, von deren Existenz wahrscheinlich weder die Miliz noch die örtlichen Behörden die geringste Ahnung haben.
Zahllose Male durch Luftangriffe und die Artillerien, die sich gegenseitig beschossen, zerstört, ist der Stadt ein System von Katakomben erhalten geblieben. Der Dichter Motritsch wohnt illegal in den Ausläufern einer dieser Ruinen. Das einzige Fenster hoch oben in der Mauer unter der Decke läßt bloß ein schwaches Licht (von einen unkrautüberwachsenen Brachgelände her) in das Zimmer einsickern. Die typische Behausung eines verwünschten Dichters.
Bloß Männer kommen zu dem Vefluchten, um das grandiose Schwimmereignis zu begießen. Filatow (aber ohne Schabelskij), Ed, der Weiße Bob, Viktor, Lonka Iwanow, Genka, M'sieur Bigoudi und Fima versammeln sich, mit Flaschen und einem Minimum Sakuski bewaffnet, in der exotischen Unterkunft des Dichters.
Sie lachen brüllend, schenken sich ein, reichen sich Brotstücke, Wurstscheiben und Käse, trinken den Porto abwechselnd aus demselben Glas (»Es gibt sowieso nicht genug Gläser, deshalb laßt uns lieber gleich eines für alle nehmen, ehe wir nicht mehr wissen, wer woraus getrunken hat«, hat der Hausherr vorgeschlagen), die männliche Gesellschaft scheint plötzlich zehn Zentimeter über dem rissigen Linoleum-Boden zu schweben. »Wir heben ab«, sagte Ed, wie gewöhnlich schon betrunken; er hat sich neben Genka auf die zusammenklappbare Liege gezwängt, die aus Aluminiumstangen, grobem Segeltuch und einem paar Dutzend Federn zusammengebaut ist. »Wir heben ab, was, Genka?«
»Ja, Eduard Wenjaminowitsch, es wird auch Zeit. Heute trinken wir noch, aber morgen machen wir wieder Schluß damit.« Genka verschwindet manchmal für mehrere Tage, und er beteuert, daß er an diesen Tagen nicht trinkt. Dunkle, dicke Ringe umranden die Augen des einstigen Idols von Limonow, wenn er etwas mehr als üblich getrunken hat. Anna vermutet, daß Genka herzkrank ist. Ed schielt und zwinkert mit den Augen und versucht, Genka fest anzusehen. Genka ist trotzdem schön. Sein Kinn ist kräftig und markant, nicht so wie bei unserem Helden dieses ausdruckslose gespaltene Etwas, das kaum ein Kinn zu nennen ist. Dennoch ist Ed sich bereits der Stärke seines Charakters bewußt und beginnt sich zu fragen, ob das volkstümliche physiognomische Ideal einer großen Stirn und eines entschlossenen Kinns nicht eine Saudummheit ist. »Saudummheit« — welchem Dorf, der Vermittlung wievieler Großväter und Großmütter und Vagabunden verdankt unser Held diesen Ausdruck, der einer seiner Lieblingsausdrücke ist? »Saudummheit«, das ist der Wahnsinn, das ist das Chaos. Normalerweise verzieht Ed sein Gesicht, wenn er seinen Lieblingsausdruck gebraucht. Er ist ein Organisator des Chaos, sein Bezwinger. Die Leute holzen das Chaos ihr ganzes Leben lang ab und stapeln es sorgfältig. Allerdings wächst das Chaos, hinterrücks, immer wieder aus der Erde nach, dschungelgleich und genau da, wo man es eben erst gefällt hat. Der Bekämpfer der Saudummheit, der hier am Leben des männlichen Kollektivs teilnimmt, hört, wie Filatow die Geschichte von der Entführung des Schwarzhändlers Sam erzählt, während sein Blick irgendwo zwischen dem Kinn seines Freundes Genka, das so solide aussieht wie der Bug eines Wikingerschiffes, und dem großen rostigen Eimer unter dem Waschbecken hin und her irrt. Aus dem Waschbecken tropft es regelmäßig in den Eimer. Neben dem Eimer schwingen die auf die Seite gekämmte Haartolle und die gerade Nase von Lonka Iwanow hin und her. Er sitzt auf dem Boden. Neben einer »Moskwa«. Auf der tippt Motritsch seine Werke, die sich dann in Charkow verbreiten.
»Sie beschatteten ihn offenbar schon lange, sie versuchten herauszubekommen, wo er seinen Schotter versteckt. Und als sie das nicht herausbekamen, beschlossen sie endlich, daß er es ihnen selbst sagen sollte.« Filatow sitzt am Tisch von Motritsch und reibt seinen Kopf an der hohen Stuhllehne und der Mauer. Filatow hat lange Beine, er ist mager, sein Haar kurz rasiert. Wie es sich für einen zeitgenössischen Dichter, Physiker und Sohn eines einflußreichen Mannes gehört, trägt er Jeans, die vielleicht eben jener Sam, von dem er erzählt, ihm verkauft hat. Filatow fährt mit monotoner Stimme fort: »Sam war im ›Automaten‹ und trank einen Kaffee-Kognak, als ein Mann sich ihm näherte und ihm höflich sagte: ›Sam, wir müssen ein Geschäft besprechen. Hast du ein paar Minuten Zeit?‹ Sam ging mit ihm raus, ohne den geringsten Verdacht zu schöpfen… Er dachte, daß der Mann ihm irgendwas anzubieten hätte, vielleicht etwas Antikes, vielleicht einen Koffer mit ausländischen Klamotten, vielleicht Devisen… Die Fresse des Typen schien ihm vage bekannt. Sam hatte ihn irgendwo schon mal gesehen. Sie gingen raus…«
»Mann, diese Arschficker, die gehen ran…« M'sieur Bigoudi rutscht auf seinem Hocker hin und her. »Wie im Krimi…« »…Ein Auto stand am Bürgersteig. Zwei andere Typen stiegen aus, die Sam, jetzt schon weniger freundlich, packten und ihn in das Auto schmissen. Meine Ljudmila, die in diesem Augenblick aus dem Theaterinstitut kam, hat die ganze Szene gesehen. Ljudmila hat gedacht, daß der KGB Sam mitnahm. Sam war der gleichen Meinung, weswegen er auch nicht schrie und ruhig ins Auto stieg, weil er wußte, daß nichts gegen ihn vorlag. Das heißt, im Visier hatten sie ihn schon, er war schon öfters angeschwärzt worden, aber sie konnten ihm nichts beweisen.— Sie wollen mir Angst machen, sagte sich Sam, und mich dann wieder freilassen. Das hatten sie schon mehrmals so gemacht… Trotzdem gefiel es ihm dieses Mal nicht, weil sie ihm die Augen zubanden. In dem Moment fing Sam zu zweifeln an: Sind sie wirklich vom KGB, die vier?…«
»Die drei«, korrigiert Motritsch. Er sitzt neben Lonka Iwanow auf dem Boden.
»Vier mit dem Chauffeur.« Filatow sieht auf seine elektronische Armbanduhr. »…Lange fuhren sie herum, ohne mit Sam zu sprechen. Ihm zufolge und nach der verstrichenen Zeit zu schließen, müssen sie ihn irgendwo außerhalb der Stadt hingebracht haben… Obschon es auch möglich ist, daß sie seelenruhig herumgefahren sind, um ihn glauben zu machen, sie würden ihn aus der Stadt schaffen. Dann stießen sie ihn raus, zwei nahmen ihn am Arm und führten ihn irgendeine Treppe runter…«
»In einen Keller haben diese Arschficker ihn gebracht!« Paul reibt sich die Hände vor Vergnügen und springt sogar von seinem Hocker auf.
»Ach, M'sieur Bigoudi, gefällt Ihnen die Geschichte? Wie du siehst, gibt es knallharte Typen in unserer Stadt… Und du möchtest nach Paris, nach Paris.« — Viktor bricht in Gelächter aus. Diejenigen, die die Beziehung Pauls zu Paris kennen, feixen zu dieser Bemerkung.
»Sie nahmen ihm die Binde von den Augen… Er sieht, er ist in einem Keller, nur daß die Mauern verputzt sind. Drei der Männer tragen Masken, bloß der, der ihn im ›Automaten‹ angesprochen hat, trägt keine. Er lacht über die ganze Fresse und sagt: ›Damit alles klar ist, Sam, alles was wir wollen, ist dein Schotter. Wo hast du ihn versteckt?‹ — ›Welchen Schotter, Jungs, seid ihr verrückt?‹ fleht Sam sie an. ›Ihr verwechselt mich mit jemand anders, Jungs! Woher soll ich Schotter haben, wo ich doch bloß am Bibliothekarinstitut studiere? Ich weiß nicht mal mehr, wann ich das letzte Mal einen Zehnrubelschein gesehen habe…‹ Sie lachen laut, und der ohne Maske sagt: ›Sam, wir sind nicht vom KGB und auch nicht vom OBChS.6 Denen kannst du mit sowas kommen… Aber wir sind hier nicht im Kindergarten. Du kommst hier nicht eher raus, Sam, als bis du uns gesagt hast, wo du deinen Schotter versteckst und meine Jungs dahin gegangen sind und ihn hier auf den Tisch gelegt haben…‹, und der Typ klopfte auf den Tisch. ›Aber woher soll ein Student was haben?‹ begann Sam zu flennen. Sie schüttelten den Kopf, und der ohne Maske nahm einen Stuhl, der an der Mauer stand, und stellte ihn mitten in den Keller. ›Setz dich, Sam!‹ — ›Danke‹, sagte Sam, ›nicht nötig, ich bin nicht müde.‹ — ›Setz dich, wenn der Chef dich darum bittet‹, sagt der kräftigste und haut ihm in den Bauch. Sam hält sich den Bauch und setzt sich. Genau so etwa.« Filatow rückt auf seinem Stuhl herum und erhebt sich sogar etwas, um zu zeigen, wie er gesessen hat. »›Nicht so, Sam‹, sagt sanft der ›Chef‹. ›Bei uns setzt man sich nicht so hin. Jungs, setzt ihn so hin, wie es sich gehört.‹ Die ›Jungs‹ packen Sam, drehen den Stuhl und setzen ihn so hin…« Filatow zieht den Stuhl unter sich heraus, dreht ihn mit der Lehne zu den Zuhörern und setzt sich rittlings darauf, mit dem Gesicht zur Lehne. »Sie haben ihn hingesetzt, sie befreien ihn von seinem Jackett und ziehen ihm sein Hemd aus. Das paßt Sam nicht. ›Es ist kalt bei euch, Jungs, laßt mich mein Hemd anbehalten, bitte.‹ — ›Keine Angst, Sam‹, sagt der Chef mit einem kleinen Lächeln, ›dir wird gleich warm. Und da es keine Frauen bei uns gibt, sondern bloß Gentlemen, zieht ihm auch die Jeans aus, Jungs.‹ Auch das paßt Sam nicht, aber was konnte er machen?« Filatow schaut fragend sein Publikum an, als wollte er die Ohnmacht Sams bestätigt wissen. Und wirklich, was hätte der kleine Sam, dieser Schwächling, schon gegen vier Eisschränke ausrichten können, fragt sich Ed Limonow. Er mußte sich unterwerfen.
»Sie banden ihn nackt an den Stuhl und holten einen Draht und einen elektrischen Apparat. ›Eh, Jungs, was habt ihr vor?‹ fragt Sam erschrocken.— ›Dir wird jetzt warm, Sam, wie ich es dir versprochen hatte‹, sagt der Chef lachend. Einer von ihnen hat sich inzwischen Gummischuhe und -handschuhe angezogen, hat einen ganz normalen Suppenlöffel aus Metall genommen, an dem aber ein Draht angeschweißt war…«
»Auh!« — ein aufgeregtes Stöhnen entfährt manchen Kehlen. »Schöne Scheiße!«
»Der Draht«, fährt Filatow unerschütterlich fort, »ist an einen Transformator und an ein manuelles Relais angeschlossen, um die Spannung ändern zu können, und von da geht er ans Netz. Aber ihr Relais ist sehr primitiv. So eine Spule von fünfzig Zentimetern Länge, versteht ihr, mit einem Draht, und an der Spule bewegt man einen Knopf: mehr Spannung, weniger Spannung. Unten gibt es eine unterteilte Anzeigenskala… ›Na, Sam, erinnerst du dich, wo du deinen Schotter versteckt hast?‹ fragt der Chef. Sam ist grün vor Angst, aber den Schotter preisgeben, den er in soviel Jahren angesammelt hat?— ›Ich hab kein Geld!‹ schreit er. ›Nein!‹ — ›Los, Witja!‹ — Der Chef gibt dem, der den elektrischen Löffel hält, ein Zeichen mit dem Kopf. ›Streichel ihm den Rücken, vielleicht erinnert er sich dann!‹ — Der, der Witja genannt wird, hat den Löffel zwischen Sams Schulterblätter gelegt und läßt ihn so nach unten wandern…«
»Au Scheiße!« Genka, der normalerweise nicht flucht, drückt mit diesem bewundernden Ausruf aus, wie er über diese parallele Welt denkt, über diese Leute, mit denen sie täglich im »Automaten« zusammenkommen. Kein Dekadenzler hat jemals daran gezweifelt, daß die Schwarzhändler harte Typen sind, aber so eine Geschichte…
»Sie haben ihn gefoltert, bis er das Bewußtsein verlor. Sie haben ihn vier Tage lang gefoltert! Und diese kleine Wanze hat ihr Geld nicht rausgerückt! Sam war so eisern wie Pawel Kortschagin7 und Oleg Koschewoj8 und hatte sich entschieden, eher auf dem elektrischen Stuhl zu verrecken und sich grillen zu lassen, als sein Geld herzugeben. Mehrmals, hat er mir gesagt, war er kurz davor auszupacken, aber er hat sich gehalten, dachte nur immer: noch ein bißchen… Zum Schluß hatte er richtig gelernt, wie ein Yogi das Bewußtsein zu verlieren… Vier Tage später haben sie ihm von neuem die Augen verbunden und ihn in der Gegend der Traktorenfabrik aus dem Auto geworfen… Um zwei Uhr morgens…«
»Das ist Sam!« — Motritsch, der tausend Tode gestorben ist, weil ein anderer so lange im Mittelpunkt stand, hat beschlossen, sich an das triumphale Ende von Arkadijs Geschichte anzuhängen. »Dieser kleine und mickrige Kerl, diese halbe Leiche, spielt plötzlich Oleg Koschewoj. Verrät die Partisanen nicht an die Deutschen…«
»Wer war dieses Kommando? Hat Sam das herausgefunden?« fragt Iwanow von seinem Platz unter dem Waschbecken aus.
»Sam glaubt, daß Sorik oder Blue-Marine ihm die Typen auf den Hals gehetzt haben. Er nimmt an, daß es eingeflogene Gangster waren, wahrscheinlich aus Moskau. Männer, die mal eben für eine Nummer hergekommen sind.«
»Aber Blue-Marine ist ein Freund von Sam. Sie arbeiten zusammen.« — Iwanow reißt die Augen auf.
»Business ist Business. Sam ist eine Nummer zu groß geworden, irgendeiner wollte den Konkurrenten abziehen und zu Fall bringen…« Filatow hüstelt plötzlich, peinlich berührt, und unterbricht den Informationsfluß. Vielleicht ist ihm bewußt geworden, daß es nicht gerade seinem Status als Physiker und Dichter entspricht, soviele Details über die Charkower Unterwelt der Gangster und Schwarzhändler zu kennen.
»Ja… das sind die Sitten des Wilden Westens. Bloß verstehe ich nicht, warum sie ihn nicht umgelegt haben, warum sie ihn in der Traktorensiedlung rausgelassen haben…« Motritsch, der in Wirklichkeit nur zu gut versteht, versucht von neuem, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, der lange Vorsitz Filatows hat ihn deutlich verärgert.
»Sie wollten seinen Schotter. Warum sollten sie bis zum Äußersten gehen?« erklärt der Weiße Bob.
»Amateure«, meint Genka. »Profis hätten die Information rausgekriegt. Sam ist kein Übermensch. Sie kennen die richtigen Kniffe nicht.«
»Wieviel Kapital wird Sam wohl haben?« Viktor reibt sich die Nase.
»Sam hat Schotter bis hier. Er ist schon zehn Jahre im Geschäft. Bis zu den Eiern. Für uns gewöhnliche Sterbliche unvorstellbar. Vielleicht mehr als eine Million…« Der Weiße Bob, der arme mutierte Tatar, schnalzt sogar mit der Zunge, als er das Wort »Million« ausspricht.
»Rubel?« fragt Viktor.
»Von wegen Rubel, Dollars!« Alle schweigen. Wie in der Szene ohne Worte im »Revisor«, denkt Ed.
24
Eine halbe Stunde später befinden sich alle wieder an der frischen Luft, im Schewtschenko-Park, in der Allee gegenüber vom »Automaten«; sie haben den »Kleinen Menschen aus Holz« auf seinem Klappbett schnarchen lassen. Sie haben sich so gesetzt, daß sie die Tür im Blick behalten, um die Freunde, die reingehen oder rauskommen, sehen zu können. Nach einhelliger Meinung der »Boheme« (so nennt Anna Moissejewna die Jungs) ist Motritsch alt geworden. »Der Alte Motritsch«, wie der Weiße Bob ihn auch in seiner Anwesenheit zynisch zu titulieren pflegt, ist dem anstrengenden müßiggängerischen Leben der Boheme, dem vielen Portwein, Kaffee, Schnaps, den Streitgesprächen und der aufreibenden Route Schewtschenko-Park — »Automat« — Spiegelbrunnen — Tewelew-Platz (mit Abweichungen) nicht mehr gewachsen.
»Der Alte sollte sich eines Tiesseren besinnen, sollte heiraten und sich noch ein Kind zulegen«, zieht der Weiße Bob in Motritschs Abwesenheit über ihn her. Anna hält den Weißen Bob für einen Schurken. Ed hält ihn für einen Realisten. Ed und der Weiße Bob sind nur wenige Jahre auseinander, aber für Ed verkörpert der Weiße Bob die junge, unbekannte, intrigante und zynische Generation. Ed ist daran gewöhnt, daß die Leute, die ihn umgeben, älter als er sind. Motritsch ist 34, Anna 30. Ed sitzt neben dem jungen Zyniker und hört mit einem gewissen Vergnügen, wie er über Papa Motritsch, der in seinem Loch schnarcht, herzieht. Über Eds altes Idol. Über den »Kleinen Menschen aus Holz«. »Der Alte sollte sich zur Ruhe setzen, er gehört in den Schaukelstuhl. Walja vom ›Poesie‹-Laden hat mir neulich unter vier Augen erzählt, daß der Alte versucht hat, sie zu bespringen. Aus Spaß hat sie ihm erlaubt draufzusteigen… und nichts…« Bob lacht. »Man könnte meinen, daß sein Locher nicht mehr funktioniert…«
Obschon Bob außergewöhnlich frech ist, spricht er den letzten Satz nur halblaut aus, damit die neben ihm auf der Bank Sitzenden, Lonka Iwanow und der ehemalige Medizinstudent, der schöne Serjoscha, ihn nicht hören können. Wenn Motritsch von den Sauereien, die der Weiße Bob über ihn erzählt, hört, würde er nicht zögern, ihm die Fresse zu polieren. Wer dabei gewinnen würde, wenn es zu einem Streit käme, bliebe abzuwarten.
»Eh, Ljuda, komm her!« schreit Bob, als er ein junges Mädchen mit unnatürlich grellgelben Haaren sieht. Das junge Mädchen trinkt neben dem Kiosk mit dem großen Segeltuchdach Sprudel, wobei sie ihr Glas mit Lippenstift befleckt. Die Arbeit der Sprudelverkäufer ist fast überall automatisiert worden, Automaten von der Farbe eines Feuerwehrautos sind an die Stelle der Kioske getreten; hier, beim Eingang zum Schewtschenko-Park, ist noch einer erhalten geblieben. Das junge Mädchen namens Ljuda dreht auf Bobs Ruf hin nicht einmal den Kopf, worauf er aufspringt und mit dem Schrei »Störrische Nutte!« zur Gelbhaarigen rennt und sie beim Arm packt. »Komm, ich stell dich den Kerlen vor.«
»Hau ab!« schreit sie wütend; sie schlägt ihm mit ihrer weißen Kunstledertasche gegen die Schulter. Ihre Schuhe mit Pfennigabsätzen und ihr Kleid sind auch weiß. Ihre Nägel und ihre Lippen violett. Ohne auf ihre Schreie zu achten, faßt Bob sie bei der Taille und schleppt sie mit dem Glas in der Hand zur Bank. Dort stößt er sie auf Eds Knie. »Willst du die Ware, Ed? Wenn sie dir gefällt, kannst du sie vögeln, sie ist eine Nachbarin.« Alle Mädchen, die Bob Ed bisher vorgestellt hat, sind seine Nachbarinnen. Man hat den Eindruck, daß er in einem riesigen Haus wohnt, das nur von zwanzig- bis fünfundzwanzigjährigen Mädchen bewohnt wird. Walja aus dem »Poesie«-Laden ist allerdings wirklich seine Nachbarin.
Die Nachbarin Ljuda, deren heißer Hintern für Sekunden auf Eds Knien gelandet ist (so heiß ist dieser Hintern, daß Ed die Wärme sogar durch seine gefütterte kakaofarbene Hose, ihr weißes Kleid und ihren Slip hindurch spürt), springt hoch. »Scheißtyp!« schreit sie Bob ins Gesicht und rennt weg.
»Sie hat sich wahrscheinlich für ein Rendezvous aufgedonnert und du hast sie begrapscht…« bemerkt der Menschenfreund Lonka Iwanow.
»Nun, Eduard Wenjaminowitsch, ist es Ihnen nicht gelungen, das Fräulein aufzuhalten?« Genka steht auf. »Ich hau ab. Meine Exflamme kommt mit meinem Sprößling. Wenn du willst, Ed, triffst du mich nachher bei Zwetkow, bei ihm im Hof werde ich mit meinem Sohn Fußball spielen, wie immer. Wann du willst, machen wir irgendwas zusammen…« Genka geht, gerade, schön, mit sicherem Schritt. Ein Ausländer, könnte man glauben, nicht ein Einwohner von Charkow. Selbst ein sehr gut gekleideter Schwarzhändler, denkt Ed, sieht noch vulgär aus. Und die »Boheme« macht, egal was sie trägt, immer einen etwas altmodischen Eindruck, einige orientieren sich an Blok, andere an den Futuristen. Es gibt jede Menge Dostojewskij-Figuren — so könnte Serjoscha, der ehemalige Medizinstudent, zum Beispiel Raskolnikow spielen. Bloß Genka kleidet sich modern. Stell Genka in einen beliebigen westlichen Film, und er wird nicht aus dem Rahmen fallen. Wird sogar neben Jean Marais oder Alain Delon gelassen vor sich hinlächeln.
Am Ende der Allee taucht ein dunkler Fleck auf, der sich schnell bewegt. Ed sieht jemanden in vollem Tempo vom Taras-Denkmal herankommen, aber seine Kurzsichtigkeit hindert ihn zu erkennen, wer es ist.
»Wer läuft da, Bob?« fragt er mit den Augen zwinkernd seinen Blindenführer, der sich rühmt, daß er mit seinen violetten Augen alles hundertzwanzigprozentig scharf sieht.
»Isja Schlaffermann. Ganz außer Atem. Er sieht völlig fertig aus… Du brauchst eine Brille, Ed.«
Jetzt erkennt auch Ed den Ältesten der Zionisten, der ungewöhnlich aufgeregt ist. Sein weißes Hemd steht über seiner breiten Brust offen, seine kräftigen Arme mit dem dichten rötlichen Haarwuchs sind bloß, die Khakijeans, die Ed ihm genäht hat, betonen seine kräftigen kurzen Beine. Isja hat vor kurzem mit Gewichtheben begonnen, und ohnehin schon breit und stark, ist er dadurch noch breiter und kräftiger geworden. Isja trainiert für die Schlacht.
»Jungs«, sagt Isja — er ringt nach Luft und öffnet die Arme weit, als ob er brustschwimmen wollte — »Arkadij Bessedin ist tot. Er hat sich umgebracht.« Isja nimmt seine dicke Brille ab, deren eines Glas gesprungen ist. Seine hellwimprigen bloßen Augen zwinkern schnell, schnell.
25
Es gibt Ereignisse, die dazu führen, daß plötzlich eine Epoche endet und eine andere beginnt. Der Tod des Übersetzers aus dem Französischen und des selbst in Charkow kaum bekannten Dichters Arkadij Bessedin bedeutete für die »Boheme«, daß Schluß war. Aus und vorbei. Basta. Kaputt. Ihre Zeit war abgelaufen. Um Gnade zu winseln, wäre da nur noch abgedroschen, wie die Polen sagen. Man hatte seine Zeit gehabt. Und fertig.
Isja steht da, ohne Brille, der heiße Wind rauscht in den Kastanienbäumen, die Sprudelverkäuferin stülpt das Glas über die Wasserdüse, drückt und spült es über dem emporspritzenden dünnen Strahl aus, die Allee entlang kommt Ljuda mit einem schönen jungen Mann am Arm, stolz klappert sie auf ihren hohen Absätzen an ihnen vorüber, sie hat ihr Glück gefunden — aber es ist schon eine neue Epoche. Folgt man der Einteilung des bedeutenden reaktionären Philosophen Konstantin Leontjew, so ist vor wenigen Augenblicken die Periode der blühenden Vielfalt für sie zuende gegangen, und nun sitzen sie, die Armen, bereits in der Periode der gänzlichen Banalisierung, des Niedergangs. Motritsch schläft, heruntergekommen, in seinem Kellerloch, wo es weiter in den Eimer tropft. Der Weiße Bob (schon mit zwanzig Jahren heruntergekommen!) berührt seinen Freund Ed mit dem Ellenbogen leicht an der Seite. Lonka Iwanow, Viktor und M'sieur Bigoudi beginnen — unsichtbar —, von innen heraus zu vermodern. Banal geworden, faulig, sind sie als Bande bereits dabei, sich aufzulösen und unterzugehen. Fast drei Jahre lang hat unser Held mit diesen Leuten zusammengelebt, ihnen verdankt er es, der Dichter Edward Limonow geworden zu sein. Jetzt aber muß diese von Zeit und Natur in einem schwierigen Prozeß geschaffene Gemeinschaft von ein paar hundert Faulenzern, Spaßvögeln, Schöngeistern, Alkoholikern, schlechten aber aufrichtigen Dichtern oder Malern sich auflösen und untergehen. Und das Signal für den Tod dieser Gruppe hat der Tod des Übersetzers aus dem Französischen mit seinem eckigen Boxergesicht gegeben. Des Dichters, der vor seinem Selbstmord noch mehrere lange Gedichte vernichtet hat, die bloß Isja, Melechow und Motritsch hatten lesen können. Was hatte es gegeben in seinen Gedichten? Hatten sich darin geniale Strophen übereinandergetürmt wie die Eisschollen auf der Charkow im April, oder war hilfloses Stammeln an der Seite ganz gewöhnlichen Wahnsinns sachte dahingeplätschert? Isja zufolge, der neben Ed sitzt und tief seufzt, ist hier, zu früh und aus freien Stücken, ein Genie dahingegangen.
»Da finden sich Leute zusammen, an die du dich für das ganze Leben binden möchtest, und dann gibt das Schicksal das Signal zum Rückzug, und man muß auseinandergehen«, sagt Ed zu seiner eigenen Überraschung laut.
»Wohin auseinandergehen?« fragt Viktor, nimmt seinen Hut ab und streicht mit der Handfläche über seine wie ein Stoppelfeld kurzgeschorenen Haare. Mit und gegen den Strich. Viktor hat nicht verstanden, was Ed gerade gesagt hat. Vielleicht hat niemand außer Ed hinter der Nachricht vom Tod des Übersetzers den mächtigen Trompetenstoß vernommen, mit dem das Schicksal das Ende des Spektakels ankündigte. Diese Heuchler, diese Provinzler taten nur so, als hätte der fremde Tod sie erschreckt, und rivalisierten bereits um die Erinnerungen an den Verblichenen, wobei sie sein Portrait natürlich mit rosa und schneeweißen Pinselstrichen malten, ohne jedes Schwarz.
»Er war der erste, der dir gratuliert hat, Ed, nicht wahr?« murmelt Isja traurig. »Wann war das noch?« — »Im Mai 65. Bei der Ausstellung der Kunst der Linken, in der Sumskaja, im dritten Hof.« Motritsch hatte die gelben Einladungskarten auf seiner alten und treuen »Moskwa« getippt. Bei dem Wort Ausstellung hatte er sogar zwei Fehler gemacht…
Irgendwo hinter dem Cafe »Pinguin« und vor der Straße, die die Sumskaja auf der Höhe der Spiegelbrunnen-Anlage kreuzt, betraten sie festlich gekleidet (Ed in einem sumpfgrünen Pullover, der ihm bis an die Knie reichte, und Anna in rotbraunem Kleid und leichtem Regenmantel), einen Hof, in dem die Bewohner ihre Wäsche zum Trocknen aufgehängt hatten. Durch ihn hindurch gelangten sie in einen zweiten, leereren Hof, und dann führte sie ein stockfinsterer, enger Tunnel in den letzten, dritten. An diesem Ort, der eher zum Hofgang von Gefängnisinsassen paßte als zu einer Ausstellung, war die Aktion bereits in vollem Gange. Ira Sawinowa stand neben einer Portraitserie von erschreckenden Monstern, die an eine Mauer gelehnt waren. Wagritsch Bachtschanjan mit seinem damals noch üppigen Bart stellte seine Emailarbeiten — verschiedenförmige, verlaufene Flecken in aggressiven Farben — und seine »Collagen« aus. Dieses Wort vernahm der Ex-Gießereiarbeiter an jenem Tag zum ersten Mal. Zwei Freunde — die Ed schon damals »die Bassows« nannte —, der junge Mischa, der »Elch«, (geborener Bassow) und Jura Kutschukow (Adoptiv-Bassow), führten bei der Ausstellung vor, was man in Charkow surrealistisch nannte. Dabei produzierten Bassow und Kutschukow in Wirklichkeit eher postsymbolistische Gemälde und Zeichnungen. Stucksche Schlangen wanden sich da um böcklinsche Bäume, dem nackten Mädchen streift der Dämon Strümpfe über… nicht ohne Grund waren das die Lieblingszeilen von Mischa dem Elch. Der delikate »Abstrakte«, Tolik Schulik — ein selbstverliebtes Wesen von neunzehn Jahren mit einer grauen Locke, die ihm in die Stirn fiel — hatte zwei Arbeiten mitgebracht, die der abstrakten Kunst zuzurechnen waren.
*
Sie befürchteten, daß der KGB Wind von der Ausstellung bekäme und sie auflösen würde (verzeih mir, Leser, wenn der KGB bisher auf den Seiten dieses Buches nicht aufgetaucht ist, ich führe ihn bald in die Arena, Ehrenwort!). Man hatte daher Einladungen nur an die verläßlichsten Leute verschickt. Zum Teil auch deshalb standen die Bilder direkt auf dem Stein- und Lehmboden des Hofes und hingen nicht an den Mauern — so war es viel leichter, sie einfach unter den Arm zu nehmen und zu verschwinden. (Der andere Grund war, daß man den Aufwand gescheut hatte, Nägel in die Ziegelsteine zu schlagen.) In der Sumskaja, nahe beim Eingang zum ersten Hof, hatte Motritsch »linke« Rowdies als Wachen postiert, die die Intellektuellen, die zur Ausstellung kamen, mißtrauisch beäugten und unter ihnen die KGBler zu entdecken versuchten. Die Charkower Intellektuellen kamen allesamt einmütig zu diesem seltenen Spektakel. Gebeugt, ja sogar in der Hocke betrachteten sie die Werke. Zahlreiche Photoapparate klickten und eine Kamera surrte. Es qualmte aus einem guten Dutzend Pfeifen, hier und da umspannten Wildlederjacken die gebeugten Rücken — das war in jenen Jahren die modische Uniform der Leute mit »liberalen« Berufen —, die Brillengläser der Intellektuellen fingen die Sonnenstrahlen auf und projizierten ihre Reflexe in den Hof… Irgend jemand schrie aufgebracht: »Wie können Sie einen Maler fragen, was er mit seinem Bild sagen will! Schämen Sie sich nicht?« Aus den Fenstern über dem Hof hingen die Köpfe der Bewohner des Festungs-Gefängnisses, als gehörten sie auch zur Ausstellung. Auf einem der Balkone kläffte unaufhörlich ein winziger, braunroter Köter. Die Eisengitter der Balkone waren rostiggelb, das altersschwache Steinwerk hatte die Farbe von feuchtem, verwesendem Fleisch. Fleisch nimmt diese Farbe an, wenn man es über Nacht in Rotwein und Essig mariniert, um Schaschlik daraus zu machen. Bevor sie losgegangen waren, hatten sich Ed und Anna eine Flasche Porto zu Gemüte geführt, und unserem Helden erschien die Welt so festtäglich wie bei einer Demonstration zum Ersten Mai.
Die Dichter lasen ihre Gedichte. Sie bestiegen der Reihe nach einen kleinen Lehmhügel neben den verwahrlosten Gemeinschaftstoiletten mit ihren alten, vermoderten Türen. Die mit Kreide geschriebenen Buchstaben »H« und »D« markierten die Geschlechtertrennung. Die Nachbarschaft zu diesem neorealistischen Attribut verwirrte die Avantgardisten übrigens ganz und gar nicht.
Unser Held las zwei Gedichte, die ihm heute ungeschickt und komisch vorkommen, so, als hätte jemand anders sie geschrieben. Doch die, die sich hier versammelt hatten, waren ein dankbares Publikum und schon glücklich über die bloße Existenz einer Ausstellung linker Kunst. Den Dichtern applaudierte man aufrichtig, und der Applaus galt — zu Lasten der Kunst der Rechten — zugleich der Kunst der Linken auf der ganzen Welt. An diesem Tag stellte Isja, den Ed bereits kannte, ihm den späteren Selbstmörder vor. Er trug einen Ledermantel. Im Mai 1965 war es kalt, und der spätere Selbstmörder schützte sich, um nicht zu frieren, mit Leder. Seine kräftigen Kiefer deuteten ein Lächeln an, und seine kleinen Brillengläser hüpften in dem Boxergesicht.
»…Erfreut… Interessant… in der Entwicklung… Sie… gelesen… Ihre… für mich interessanter als die Verse des ›Genies‹. Sie werden weit kommen.« Der Typ im Ledermantel schüttelte Ed die Hand, aber lachte nicht. Das war, in ihrer Gesamtheit, die kurze Zeremonie, die dem künftigen Selbstmörder Gelegenheit gab, im Leben Ed Limonows aufzutreten. Von neuem erschienen auf der Bildfläche die gekrümmten Rücken und die Hintern der Charkower Intelligenz.
»Was soll das, was steht ihr da wie die Hammel?« beschimpfte plötzlich ein gewisser Slawa Gurin das Publikum. »Sagt was, diskutiert! Habt Ihr eine Idee zu den Gedichten, die gerade vorgetragen wurden? Äußert euch!« Zu allen Zeiten haben Psychopathen Forderungen an die Masse gestellt. Immer ist es ihnen so erschienen, als sei die Masse nicht aktiv genug. Doch die wohlwollenden Charkower Bücherfreunde und Liebhaber der Malerei der Indifferenz zu beschuldigen, ist ungerecht. Sie waren einfach befangen, diese Glatzköpfe, diese Brillenschlangen, diese bedächtigen Väter, die manchmal ein Drittel des Familienbudgets für Bücher und Monographien ausgaben, sie waren zu schüchtern, um ihre Meinung zu sagen. Aber die Kunst, oh!, wie sie sie liebten, du Idiot Slawa Gurin! Nebenbei, was soll man schon erwarten von Gurin? Ein Schizo ist ein Schizo. Natürlich ist die Bezeichnung »Schizo« keine wissenschaftliche. Es wäre angemessener, diese umfangreiche Untergruppe der Charkower Boheme einen Trupp »interessanter Leute« zu nennen. Die »Schizos« sind weder Maler noch Dichter, obschon sie von Zeit zu Zeit ein Gedicht schreiben oder ein Bild malen. Ihr wesentliches Kennzeichen ist die Fremdheit, die zuweilen ans Groteske rührende Abnormität ihres Schicksals und ihres Verhaltens. Anna Moissejewna, die sich »Schizo« nennt — und die stolz darauf ist —, ist der vollkommenste Prototyp dieser Untergruppe. Aber zu den Schizos rechnete die öffentliche Meinung Charkows auch den supergesunden Boris Tschurilow. Weil der Yogi, der Gelehrte, der Bücherliebhaber, der Sammler Boris nicht im entferntesten an einen normalen Arbeiter erinnerte, und noch weniger an einen Gießer. Von solchen wie Boris kommt in der Hammelherde einer auf eine Million.
Igor Jossifowitsch Kowaltschuk, der Straßenbuchverkäufer und frühere Eisenbahnschaffner (»Rousseau war Zöllner, das war noch schlimmer«, meint Igor Jossifowitsch, um sich zu entschuldigen), ist auch ein Schizo. Welcher normale Mann von über fünfzig sucht schon die Gesellschaft von zwanzigjährigen Jungs und verbringt ganze Tage auf der Straße oder im »Automaten«? Igor Jossifowitsch hat, abgesehen von seiner Schamlosigkeit und in Ermangelung jedweder Komplexe gegenüber seinen jungen Genossen, noch das Talent, überall weitere Schizos aufzuspüren und sie in den Kreis der Boheme einzuführen. So tauchte Igor Jossifowitsch in den Salons von Charkow (unter denen das Zimmer von Anna am Tewelew-Platz 19 der komfortabelste war) und im »Automaten« in der Begleitung einer jungen Frau auf, die Marina Zwetajewa erstaunlich ähnlich sah. Sie hatte ein rundes Gesicht mit etwas verschwommenen Zügen, lange nicht gewaschene kastanienbraune Haare, trug eine große Umhängetasche, und eine Vielzahl von Tüchern und dunklen Stoffetzen umhüllten die unbestimmte Figur des großgewachsenen jungen Mädchens. Mascha Kultajewa schrieb Gedichte. Wie wäre es 1965 auch möglich gewesen, nicht zu schreiben, wenn du weißt, daß du der jungen Marina gleichst wie ein Wassertropfen dem anderen? Mascha hatte ein tiefes Lachen, sie war intelligent, belesen und behauptete, daß sie, wie Marina, Tochter eines Professors sei; sie trank viel, wenn sie mit Igor Jossifowitsch von einem Weinkeller zum nächsten zog. Manchmal schloß Motritsch sich ihnen an, und dann spazierten sie zu dritt durch Charkow. Igor Jossifowitsch war stolz auf seine Freundschaft mit der zwanzigjährigen Mascha, er war. zweifellos in sie verliebt, doch lange Dauer war dem Idyll nicht beschieden. 1966 stellte Igor Jossifowitsch, zum eigenen Schaden, Mascha-Marina dem Maler Wolodja Grigorow vor. Die stolze Mascha-Marina verliebte sich in den hellhäutigen Aquarellisten. Vielleicht hätte sie sich eher noch in Motritsch verliebt (es war schwer, sich in den vollkommen kahlen und farblosen Igor Jossifowitsch zu verlieben), aber Motritsch erklärte zu jener Zeit öffentlich, er sei kein »Beschäler, sondern ein Dichter« und ziehe es vor, bloß freundschaftliche Beziehungen zu Mädchen zu unterhalten, die wie Mascha tränken. Der hellhäutige Grigorow, weniger kompliziert gestrickt als die vorherigen Begleiter Maschas (er war mehrmals verheiratet gewesen und hatte von jeder Frau ein Kind), verführte sie — sie, die genauso pausbäckig wie Marina war —, und der untröstliche Igor Jossifowitsch schrieb bittere und schizophrene Verse, die alle Dekadenzler noch lange danach mit Vergnügen zitierten:
Wir suchten nach einer Balance
Das kleine Talent aber ward schal
Ach Maschka, du — keine Chance
Und nach Freud Maschal
Wie es nun mal üblich ist in allen armen Ländern mit unterentwickelten Empfängnisverhütungsmittelindustrien, fand sich Mascha bald geschwängert und gebar Grigorow das wohl vierte Kind. Danach nahm das Leben Maschas einen anderen Verlauf als das Marinas. Man vermutet, daß Igor Jossifowitsch in seinem psychoanalytischen Vierzeiler mit dem Wort Balance den Mann oder genauer: das männliche Geschlechtsteil meinte, nach dem das pausbäckige junge Mädchen mit der blassen Haut, den nußbraunen Augen und Haaren gesucht hatte. Und daß sie, nachdem sie es gefunden hatte, aufhörte, Gedichte zu schreiben und sich in eine gewöhnliche Mutter-Milchkuh verwandelte. Sie sind so monoton, deine Szenarien, oh Herr, wie die von Hollywood. Eins hast du erfunden und wandelst es kaum ab, reicht es doch, bloß die Namen zu wechseln.
26
Der »Schizo« Slawa Gurin war unverhohlen in Anna verhebt. Am Neujahrstag 1965 brachte er einen Elch aus Glas (von ihm selbst geblasen!) in den »Poesie«-Laden und überreichte ihn ungeschickt Anna. »Schönes Neues Jahr!« Anna Moissejewna war begeistert von diesem absurden Geschenk und vor allem davon, daß Slawa den Elch selbst geblasen hatte, sie hebt absurde Sachen. Ein anderes Mal schenkte der graue, wie aus Asphalt geblasene, fahle Gurin ihr einen Strauß Rosen. Ed lebte damals bereits mit ihr zusammen, er kam abends betrunken nach Hause, steckte die Nase in die Rosen und lachte laut.
»Slawa ist ein Gentleman, nicht so einer wie du, du kleiner Dreckskerl!« bemerkte Anna, wobei sie kokett mit ihren metallbeschlagenen Stöckelabsätzen klapperte. Die Reparatur der Absätze war eine ihrer beständigen Sorgen (ihre Abnutzung verdankten sie ihrem Gewicht) und verschlang einen beträchtlichen Teil ihrer Ausgaben. »Oh ja, Slawa Gurin, mit dem fang ich was an!«
Ed glaubte nicht an Annas Drohung. Er war nicht eifersüchtig auf den farblosen Gurin, an dessen Gesicht er sich nicht mal erinnern konnte. Im Gegenteil erregte eher Schulik, der Abstrakte, dieses dümmliche, aber schöngeistige Wesen indirekt seine Eifersucht. Anna, die sehr stolz auf ihre Erfolge bei der schöpferischen städtischen Jugend war, hatte es geschafft, den Abstrakten zu verführen, noch bevor der Exgießer in ihrem Leben aufgetaucht war. Pervers wie sie ist, hatte sie selbst ihm ihre Abenteuer aus der Zeit erzählt, in der sie noch »ein junges freies Mädchen« gewesen war. Eines Tages…
Der Exgießer hatte gerade den Liebesakt mit seiner ungewöhnlichen Freundin vollendet und lag im Dunkeln lang ausgestreckt auf dem Rücken; im schmalen Fenster sah er den Schriftzug »Bringen Sie Ihr Geld auf die Sparkasse!« aufleuchten, und sein Herz klopfte zum beunruhigenden Geflüster seiner Freundin. Begonnen hatte die Geschichte, von der Anna erzählte, mit einem Sturm (den Anna vermutlich hinzuerfunden hatte, aber davon flüsterte sie nichts), einem Hurrikan, einem Tornado, der über Charkow ausbrach. Durch die Katastrophe vom heimatlichen Tewelew-Platz 19 abgeschnitten, hatte sich Anna mit zwei jungen Burschen, Schulik dem Abstrakten und einem gewissen Lewa, in einem Bett wiedergefunden. Die beiden Typen hatten jeder auf einer Seite der lasterhaften Jüdin gelegen und sie abwechselnd geküßt. Später, als das Küssen keinen Sinn mehr machte, zu lange hatten sie sich schon geküßt, hatte es einen toten Punkt gegeben; sie lagen dann alle drei eine Viertelstunde lang im Dunkeln, ohne ein Wort zu sagen und ohne sich zu bewegen. Schließlich hatte Lewa (was für ein Fuchs!) Anna Moissejewna befummelt und gefunden, was er suchte, und langsam, aber zielstrebig und beharrlich hatte er sie bestiegen und ihr das Geschlecht eines Siebzehnjährigen reingesteckt. Tolik der Abstrakte hatte so getan, als ob er schliefe, und absichtlich tief geatmet. Aber als der Geschlechtsakt zwischen seinem Freund und der Frau, in die er verliebt war, sich allmählich dem Höhepunkt näherte, hatte der Abstrakte nicht mehr länger heucheln können und war in Schluchzen ausgebrochen. Er hatte geweint, und dann, gleich nachdem sich Lewa aus ihrem Körper entfernt hatte, war er über sie gestiegen. »Ich war die erste Frau in seinem Leben«, sagte Anna stolz im Dunkeln.
Was hier gerade beschrieben wurde, scheint uns, Leser, reizend, provinziell, hausbacken zu sein und kann uns allenfalls ein leichtes Lächeln entlocken. Eine sechsundzwanzigjährige Frau, die auf der Suche nach Abenteuern ist, mit zwei siebzehn- und achtzehnjährigen Jungs in einem Bett! Der Achtzehnjährige noch Jungfrau. Aber für den Exgießer, der noch nicht einmal Limonow geworden war, war das, was seine Freundin ihm erzählte, schrecklich, es regte ihn auf und war Anlaß zu langen Meditationen; er betrank sich sogar mehrmals wegen dieser Geschichte und beschimpfte Anna im Suff als Nutte und Prostituierte.
»Ich, eine Prostituierte! Ed!« flehte Anna ihn an. »Das alles war doch, bevor ich dich kennenlernte!« Er mußte einräumen, daß »all das« — die geschiedenen Kuligins und ihre »Nutten«bande (wie sie der Exgießer anfangs böse genannt hatte), der Abstrakte und die anderen Abenteuer Annas — vor ihm gewesen war, ja. Trotzdem hatte diese von Anna geschilderte Szene ihn bei ihren gemeinsamen Liebesakten noch lange zusätzlich erregt, auch wenn Ed nie darüber mit der Jüdin sprach.
Er war sogar eine Zeitlang mit dem Abstrakten freundschaftlich verbunden. Sie hatten, abgesehen von Anna Moissejewna, eine gemeinsame Leidenschaft: sie liebten es, sich gut anzuziehen. Obschon der Abstrakte herablassend bemerkte, daß Ed in der Kunst des Nähens dem bei allen Stutzern Charkows anerkannten Schneider Bobow nicht das Wasser reichen könne, Heß er sich doch seine Hosen von Ed fertigen, weil es billiger war. Ed ließ sich manchmal lieber mit »Naturalien« bezahlen, das heißt, Tolik brachte ihm ein Stück Stoff mit, den gleichen, den er auch für sich gekauft hatte. Ed vertraute dem Geschmack des Abstrakten. Nachdem sie so ein paarmal Stoff gegen Arbeit getauscht hatten, gefielen sie sich darin, als Zwillingspaar durch die Stadt zu spazieren und Charkow mit ihren schwarzen, weiten Hosen zu fegen.
Der Abstrakte gehörte zu jener Kategorie von Menschen (unter den Malern gibt es mehr als genug davon, nebenbei bemerkt), die ihren jeweiligen Beruf wegen seiner romantischen äußeren Attribute ergriffen haben. Diese Maler haben immer tolle Staffeleien aus dem besten Holz, jede Menge Pinsel, und man kann sogar Samtbarretts auf ihren Romantikerköpfen erblicken. Ihre Ateliers sind malerisch und erinnern an die Ateliers von Montmartre… Aber immer fehlt das Endprodukt der schöpferischen Aktivität; kurzum, an den Wänden ihrer Ateliers lehnen keine Meisterwerke. An den Wänden stehen gewöhnlich gut grundierte, ansonsten aber — jungfräuliche Leinwände. Der Abstrakte hatte mit neunzehn Jahren noch kein Atelier, aber sein älterer Bruder, der zur Armee gegangen war (»mein Bruder ist ein Esel«, sagte der Abstrakte und lachte unschuldig), und seine Mutter, die den größten Teil des Tages außerhalb des Hauses arbeitete, hatten ihm zwei kleine Zimmer zum Gebrauch überlassen; zur Musik der Beatles zappelte der Abstrakte im größeren Zimmer mit dem Pinsel in der Hand vor seiner Staffelei und betrachtete sich gleichzeitig in einem großen Spiegel (der höchstwahrscheinlich eigens für diesen Zweck an der Wand befestigt war).
»Ich bin schöner als du, Ed«, bemerkte er eines Tages mit Genugtuung, nachdem er sich neben Ed gestellt und in den Spiegel geschaut hatte. Anna hatte auf der Bettcouch gesessen, das Tonband des Abstrakten vibrierte, während es polnischen Jazz zerstäubte:
Verliebt zum ersten Mal
Verliebt auf den ersten Blick
Romantiker, romantisch
Verliebte…
»Anna, stimmt's, daß ich besser aussehe als Ed?« Anna und Ed konnten nicht mehr und brüllten vor Lachen.
»Nein, wirklich…«, fuhr der Abstrakte fort, »ohne diese Nase wärst du schön, Ed. Ed, du mußt dich einer Schönheitsoperation unterziehen…« Tolik hüpfte und machte einige »shake«-Bewegungen (er stand auf »shake« in dieser Saison). »Shake!« schrie er. »Ed, soll ich dein Porträt malen?« Tolik, naiv, fast dumm, war in Wirklichkeit ein guter Idiot, ein richtiger 19jähriger Fürst Myschkin.
»Willst du Geld haben, Ed?« schlug er häufig vor. »Du gibst es mir eines Tages, wenn du kannst, zurück. Ich brauch es nicht…« Der Alkohol ließ ihn gleichgültig, er bevorzugte Eis…
27
Es ist bereits erwähnt worden, daß vor dem Auftauchen Ed Sawenkos im Milieu der Boheme Anna Moissejewna, die lustige und unbekümmerte, sexuell emanzipierte Jüdin schlief mit wem sie wollte. Und sie wollte, wie es schien, mit so gut wie jedem der jungen exzentrischen Künstler Charkows schlafen. Vielleicht war es Anna Moissejewnas leidenschaftlicher Wunsch, das Wesen jedes einzelnen zu entdecken. Und wie kann eine Frau das Wesen eines Mannes entdecken? Einzig und allein, wenn sie ihn im Bett erlebt. Anna zu beschuldigen, sie wäre etwas zu oft auf die Jagd nach den Geheimnissen der Charkower Jugend gegangen, wäre unsinnig. Dennoch bereitete die glorreiche Vergangenheit seiner Freundin dem Exgießer unangenehme Tage und Minuten. (Hüte dich vor Frauen mit Vergangenheit, Leser, wenn du ein ruhiges Leben führen willst!)
Bei prasselndem Winterregen hatte Ed eines Tages in der Nähe des Gebäudes der alten Adelsversammlung den Adoptiv-Bassow, Jurij Kutschukow, getroffen. Der junge bürgerliche Intellektuelle stapfte, die Augen auf den Gehweg gesenkt (eine van Goghsche Pelzmütze umrahmte sein gelbliches Gesicht), unerschrocken mit seinen Arbeitsschuhen durch Wasser und Schnee. Einer seiner unförmigen und vollgesogenen Schuhe wurde von einem… Bindfaden zusammengehalten. Warum kauft er sich nicht auf dem Flohmarkt neue Schuhe? hatte Ed sich ärgerlich gefragt. Gewiß, Kutschukow ist arm, aber schließlich bekommt man, ob reich oder nicht, ein Paar schon für einen Rubel. Nein, der Gelbgesichtige zog es vor, in seinen Scheißlatschen zu humpeln, um damit das Recht zu haben, auf die Besitzer guter Schuhe herabzublicken.
»Jura!« hatte Ed dem bürgerlichen Intellektuellen nachgeschrien, der bereits vorbeigegangen war. Die Bassows, der geborene und der adoptierte, schnüffelten schon damals Äther; deshalb starrte Kutschukow, nachdem er sich ein paar Regentropfen von Nase und Kinn gewischt hatte, Ed, dessen georgische Mütze und seinen anständigen Ratinemantel blicklos an. »Ah, Ed… Guten Tag, Ed, verpiß dich!« Sein gelbliches, spitzes Gesicht, über dem ebenso wie seine Schuhe absichtlich schäbigen Schal, zeigte ein spöttisches Lächeln. Ed hatte gedacht, daß Jermak Timofejewitsch gut daran getan hatte, Jurijs Ahnherrn zu besiegen und sein sibirisches Khanat von Gelbgesichtern auszulöschen. Wahrscheinlich lohnte es gar nicht, sich von dieser hingespuckten Begrüßung des Herumtreibers beleidigt zu fühlen; solche Scherze gehörten nach Saltow, hier, am Tewelew-Platz, in seinem neuen Leben, hörte Ed Sawenko sie nur noch selten. »Das war grob, Jurij!« sagte er und wollte hinzufügen: Man könnte dir für deine Scherze die Fresse polieren, aber er sagte es nicht.
»Nichts für ungut, Sir, das war liebevoll gemeint.« Der Ostjake rieb sein regennasses Gesicht mit der Handfläche ab. Mit seinem gelblich-olivenen Teint und den rötlichen Haaren machte er wahrhaftig den Eindruck, letzter Repräsentant seines untergegangenen Geschlechts zu sein, aber Ed wollte nicht glauben, daß Kutschukow in direkter Linie von dem berühmten Herrscher des sibirischen Khanats, Khan Kutschum, abstammte. Er verdächtigte Jurij, die Geschichte frisiert zu haben, um sich interessanter zu machen.
»Um Ihnen meine Freundschaft zu beweisen, Sir, teile ich Ihnen ein Geheimnis mit, wenn Sie wollen. Eine neue Art des Koitus… Wie man sich vor einem verfrühten Orgasmus bewahrt. Sie können eine geile Frau mindestens eine, und sogar zwei Stunden, solange Sie wollen, durchficken. Wollen Sie?«
Jurij, der seinen Milizionär-Papa nicht liebte, hatte einen großen Teil seiner Kindheit auf der Straße verbracht. Wörter wie »Sir« und »Koitus«, die er sich bei Bassow Mischa auslieh, vermischten sich bei ihm mit einem Basisvokabular von Sauereien, die Ed, der sich mit Eifer auf seine neue Sprache gestürzt hatte, mit aller Kraft vergessen wollte.
»Schießen Sie los, Sir!« Er wurde auch spöttisch.
»Um nicht zu früh abzuspritzen, Ed, darfst du nicht pissen gehen… Fick weiter.« Kutschukow, der den ein wenig enttäuschten und skeptischen Gesichtsausdruck Eds unter der schwarzen Ratinekappe sieht, lächelt mit schiefem Gesicht. »Ehrlich. Die volle Blase drückt auf den Kanal, durch den das Sperma kommt und hindert dich daran abzuspritzen… Ich habe gerade so ein Weib durchgefickt… so ein fettes Weib…« Der Ostjake kicherte und zeichnete mit den Händen das fette Weib nach, und was er da in der Luft modellierte, erinnerte Ed, der augenblicklich alarmiert war, an die Silhouette von Anna.
»Sie ist zehnmal gekommen und ich kein einziges Mal! Sie hat sogar am Ende gesagt: Das reicht, hör auf, ich kann nicht mehr!« Der Gelbgesichtige mit seiner nassen Fresse schaute Ed provokativ an.
Unmöglich herauszubekommen, ob er Anna meinte oder nicht. Die Spezialistin auf dem Gebiet der »Entjungferung« der schöpferischen städtischen Jugend hatte ihm gestanden, daß der unverschämte Gelbgesichtige ihren Reizen zum Opfer gefallen war. »Das ist schon lange her«, hatte Anna obenhin gesagt. Fünfzig Meter von Kutschukow entfernt, bedauerte Ed, der schon die Sumskaja überquert hatte, ihm nicht in die Fresse geschlagen zu haben. Wahrscheinlich hatte er doch Anna gemeint.
»Ed!« Ed drehte sich um. Gekrümmt hatte der Gelbgesichtige von der anderen Straßenseite mit dem Arm in seine Richtung gewunken. »Denk dran! Nicht pissen!« Ein Windstoß schüttelte Jurij plötzlich wie einen Baum. Wo kriegt er bloß diese jämmerlichen Klamotten her? fragte sich Ed haßerfüllt.
*
Abgesehen von dieser verständlichen Eifersucht auf Jurij als Mann quälte noch eine andere, die auf den Künstler, unseren Helden: Alle versichern übereinstimmend, Kutschukow sei genial. Sowohl Miloslawskij, der solche Auszeichnungen nur sehr selten verlieh, als auch Motritsch, der nur auf sich selbst schwor und alle anderen kritisierte, und Bassow, den vielleicht seine Freundschaft blendete. Mischa hat Kutschukow bei sich aufgenommen. Jurijs Vater und Mutter hatten, angeblich, seine Bilder verbrannt und versucht, ihn in einer Anstalt einsperren zu lassen, deshalb ist er der Adoptiv-Bassow geworden. Die Bassows, das sind somit Mischa Bassow, Kutschukow und Mischas jüngere Schwester — Natascha. In der kleinen Wohnung der Bassows laufen die Eltern — die Mutter, eine intellektuelle Professorentochter, der Vater, auch ein Intellektueller und schrecklich willenlos — und Natascha, die schöne Kranke, auf Zehenspitzen um das gelbgesichtige Genie herum. Das Genie bemalt jeden Tag riesige Leinwände, die größer sind als es selbst, mit — gleich ihm — gelbgesichtigen Männern und Frauen. Auf sumpfgrünem Hintergrund, sumpf grün wie Eds Pullover. Der Exgießer wird selten Genie genannt. Melechow, der geheiratet hat und dicker geworden ist, hat sich aus der Boheme zurückgezogen, er umgibt sich jetzt mit den Leuten vom Fleisch- und Fisch-Trust. Der Mann von Wolkows Tochter darf nicht mehr als Heizer arbeiten, Melechow ist jetzt Anleiter beim Gebietskomittee des Komsomol. Das Gebietskomittee des Komsomol befindet sich in demselben Wolkenkratzer wie das Gebietskomittee der Partei, am Dserschinskij-Platz, aber in einem anderen Flügel des Gebäudes. Melechow verfolgt von dort weiterhin Ed und seine Erfolge, aber er hat weniger Zeit. »Die Boheme« hat seinen Verrat entschieden verurteilt, die Dekadenzler sind davon überzeugt, daß er sich »verkauft« hat, und sein bester Freund Motritsch hat sich mit ihm deshalb geprügelt. Es gibt nur sehr wenige in Charkow, die verstehen, was Ed eigentlich schreibt. Zum Teil auch deshalb will er nach Moskau. Unmöglich, daß Motritschs altmodischer Romantizismus und die Filatowschen Vosnessenskij-Imitationen auch dort als poetischer Maßstab gelten. Der »geniale«, in Charkow nicht anerkannte Limonow beobachtet feindselig den in Charkow anerkannten »genialen« Kutschukow. Trotzdem sagen ihm sein Gespür eines Jungen aus der Arbeitervorstadt und seine gesunde Verachtung für das, was die Mehrheit denkt, auch wenn sie sich aus Miloslawskij, Motritsch und Bassow zusammensetzt, daß er, Ed, in seinen Gedichten viel interessantere Sachen macht als Kutschukow mit seinen Bildern. Die gelben Gesichter auf sumpfgrünem Grund gab es bereits, wenn nicht in der UdSSR, so doch jedenfalls in Europa…
Gedächtnis — Reiterstandbild ohne Arme,
Wie nervös ist dein Galopp, doch du hast keine Arme
Laut schreist du heute auf verlassner Bahn
Und schön funkelst du ganz am Ende des Ganges…
— nein, Jurij, dieses Funkeln am Ende des Ganges kannst du wohl schwerlich auf deinen gelb-grünen Bildern ausdrücken…
Der verächtliche und souveräne Mischa Bassow, der Elch, hat sich nicht damit begnügt, nur das eine Genie bei seiner Familie einzuführen. Auch Motritsch hat er angeschleppt, hat ihn immer wieder angelockt und nach und nach an sein Haus gebunden. Das einzige Mal, wo Ed in die Wohnung der Bassows gekommen war, hatte er dort den Kroaten getroffen, der offenbar irgendwo geschlafen hatte und nun gähnend und sich kämmend herauskam. Bassow hatte eine Akademie bei sich eingerichtet. Die Mama schlich unsichtbar, wie ein leichter Schatten, an der Peripherie der Akademie herum, der Papa arbeitete den ganzen Tag auswärts und verdiente das Geld, um die Genies auszuhalten, die Szene aber wurde von den Genies und der kleinen, kranken Musikerin bevölkert; was die letztere betraf, so würde auch sie, wie alle erwarteten, sich einmal als genial erweisen (wenn sie überlebte); jetzt diente sie, mit ihren fünfzehn Jahren, als Modell, als Muse, als Inspiratorin, Vestalin, Beatrice, und, wie Ed vermutete, als nacktes Mädchen, dem der Dämon Strümpfe überstreift. Die kranke Natascha tauchte auf allen Bildern des Gelbgesichtigen und in den Gedichten des Kroaten auf. Abfällig lachte der große Elch Bassow zu seinen abfälligen Gedanken und wanderte in dem Tempel, den er Natascha und der Kunst errichtet hatte, hin und her. Das Parkett der alten Wohnung knarrte unter den Schritten der Genies und Gott allein weiß, womit sie ihre Zeit verbrachten, wenn sie nicht Gedichte schrieben oder Leinwände bemalten. Es ging das Gerücht, daß Motritsch während seiner ganzen »Bassow«-Periode nicht trank und daß Natascha jeden Abend für die »Genies« Klavier spielte. Natascha hatte Asthma, im Haus wurde nicht geraucht, und das ganze Jahr 1966 erwartete die Charkower Boheme ihr Ableben. Die »Bassows« machten, traurig, aber bestimmt, Anspielungen auf ihren nahen Tod. Im »Automaten« sah man manchmal Bassow Mischa, eine Tasse Kaffee in der Hand, an einem der hohen Tische stehen. Ausgefragt über die Gesundheit seiner Schwester, sagte Mischa in seiner üblichen Art, ungnädig, herablassend, seine wortkargen Sätze deutlich betonend, daß es Natascha sehr schlecht gehe, daß sie wieder einen Anfall gehabt habe, und daß die Anfälle von Mal zu Mal schwerer würden. Danach schaute Mischa über den Kopf seines Gesprächspartners hinweg dorthin, wo im hohen Fenster des »Automaten« violett und windig, gezeichnet vom aufkommenden Unwetter, der Abend hereinbrach. Bassow schien aus seiner Tragödie zu ihnen, den Personen eines Boulevardstükkes, herabzusteigen.
Eines Tages, als er mit Motritsch da stand, der in seinen fürstlichen Pelz eingemummelt war — der Kroate hatte zweifellos Schüttelfrost, wenn nicht aufgrund eines Katers, so vielleicht aufgrund der Musik, die Natascha am Vorabend gespielt hatte —, hatte Bassow Anna und Ed, die ihm von ihrem Plan, nach Moskau zu ziehen, erzählt hatten, als »aufgeregte Kleinbürger« und als »Einfaltspinsel« beschimpft und das Gesicht verzogen.
»Du bist ein Schwachkopf, Mischa!« hatte Anna zu dem jungen Mann gesagt, obschon sie ihn noch gestern beweihräuchert und behauptet hatte, er wäre eine Reinkarnation von Blok oder auch einem seiner Freunde oder wenistens von Andrej Belyj. »Ein prätentiöser Schwachkopf!« Ed und Anna hatten sich von den Bassows entfernt, die wortlos weiter ihren Kaffee schlürften.
Und plötzlich… plötzlich barst die »Familie Bassow« in Stücke. Eines schönen Tages wurde Motritsch unerbittlich und entschieden aus ihr ausgeschlossen; unmittelbar danach entdeckte man, daß Bassow Mischa aus Charkow verschwunden war! Und mit ihm Galja, die Exfrau Motritschs, und das Kind von Motritsch! Was Natascha betrifft, so war sie, anstatt zu sterben… schwanger! Kutschukow blieb bei den Eltern Bassow und lebte mit der jetzt sechzehnjährigen Natascha wie mit einer Ehefrau…
Ed Limonow lachte; es vergnügte ihn sehr, was geschehen war. Auch später wird es ihm immer Vergnügen bereiten, wenn bestimmte Ereignisse, selbst unangenehme und seinem eigenen Leben abträgliche, seine Theorien, seine Vorahnungen und seine Vorhersagen bestätigen.
Wie man hörte, hatten sich Bassow und die Frau von Motritsch in eine entlegene Stadt, weit weg in Sibirien, verdrückt, wo sie glücklich zusammenlebten. Wo genau das war, wußte niemand. Später war Bassow einmal, inkognito, zurück nach Charkow gekommen, hatte sich mit Wagritsch Bachtschanjan getroffen und ihm seine surrealistischen Chinatinte- und Federzeichnungen gezeigt, »gute Technik, sehr talentiert, viel Arbeit«, so hatte Bach sie charakterisiert. Bassow war dann wieder in seinem abgelegenen Nest verschwunden, ohne seine Arbeiten auch anderen gezeigt zu haben. Es gab überhaupt keine Gesetzmäßigkeit in der Kette Mischa Bassow — Galja Motritsch — Sibirien, wogegen beispielsweise in der Kette Kutschukow — Natascha Bassow — Familie Bassow sich eine logische Geschichte abzeichnete. Wie konnte ein junger Mann, ein bißchen zu intelligent und raffiniert selbst für eine Stadt wie Charkow, aus freien Stücken in einem sibirischen Loch verschwinden und dort mit einem Weib zusammenleben, das älter war als er und einmal mit einem Vorarbeiter im Walzwerk der Fabrik »Hammer und Sichel« verheiratet gewesen war? Ed hatte Galja Motritsch nie getroffen, er hatte bloß ihr Photo gesehen. Ein gewöhnliches, rundes Gesicht, eine einfache Frau. Verbarg sich vielleicht in Bassow, hinter seinem Elchprofil, auch eine rundgesichtige und einfache Natur, die Ed früher bloß nicht wahrgenommen hatte? Und hatte er sie nicht wahrgenommen, weil er Bassow nicht genügend gekannt hatte? Und wie hatte, interessante Frage, Bassow Ed wahrgenommen? Eine modisch ausgestellte schwarze Hose, der Kragen eines weißen Hemdes unter einem grobgestrickten kragenlosen Pullover. Oder in einem sehr schicken kakaobraunen Anzug… Oder in einer Weste mit vier Taschen, wie er mit dem Abstrakten in der Sumskaja spazierengeht… Hatte Bassow in unserem Ed einen Modegeck gesehen, einen Müßiggänger, den Freund Genka Gontscharenkos? Hatte er ihn als Müßiggänger wahrgenommen?
Aber man weiß nie, was aus einem Jungen oder einem jungen Mann einmal werden wird, wie unser Held zu sagen pflegt.
28
Auch wenn die jungen Leute, die jetzt auf der Bank beim Eingang zum Schewtschenko-Park sitzen, auf ihren Gesichtern nicht den Windstoß verspürt haben, den die jähe Flügelbewegung des Schicksals ausgelöst hat, so hat sie dieser Tod doch alle erschreckt. Dies ist der erste Tod in ihrem Milieu. Und noch mehr erschreckt sie der Umstand, daß der massive Arkadij Bessedin so denkbar wenig von einem Selbstmörder hatte. Bringen sich Leute mit eckigem Gesicht, kräftigem Nacken und starken Backenknochen um, indem sie sich bestialisch die Venen und Sehnen durchschneiden und sich außerdem noch aus dem Fenster stürzen?
»Tolja, Arkadij war doch trotzdem ein komischer Bursche, oder? Hast du nicht den Eindruck, daß er etwas behämmert war?« fragt Ed Melechow, den Paria, dem sie anläßlich des Todes von Bessedin verziehen und den sie angehalten haben, als er mit seiner schwarzen Aktentasche auf der Sumskaja zum allseits geschmähten Gebietskomitee des Komsomol ging.
»Begleitest du mich ein Stück, Ed, und unterhalten wir uns?« schlägt Melechow vor und steht auf. Ed verspricht der Bande zurückzukommen und geht dann mit Melechow die Allee hinunter, die parallel zur Sumskaja verläuft.
»Die Zeit vergeht«, bemerkt Melechow, »man hat schon die Astern gepflanzt.«
»Das sind keine Astern, Tolja… Das sind Chrysanthemen…«
»Die gehören zur gleichen Gattung… Arkadij war psychisch schwer krank, Ed. Er hatte schreckliche depressive Krisen, und… ich wollte darüber nicht vor Isja sprechen, aber ich habe einige Passagen aus einem seiner Gedichte abgeschrieben, ich wollte sie analysieren…«
»Und… sind sie interessant?« Ed macht ein paar schnelle Schritte voraus, um in Melechows Gesicht zu schauen. Er mag es sich zwar nicht eingestehen, aber er fürchtet, daß Melechow jetzt sagt: »Genial!« und dann… Was dann, du kannst doch nicht auf einen Toten eifersüchtig sein! Hat Bessedin eben die interessantesten Gedichte in Charkow geschrieben! Ed weiß selbst nicht, wovor er eigentlich Angst hat, aber er fühlt sich sofort besser, als Melechow kopfschüttelnd sagt: »Alles Unsinn, leider… Der blanke Wahnsinn. Und das Wichtigste…« Er bleibt unvermittelt stehen und bittet: »Hör zu, sprich darüber bitte nicht mit Isja. Isja war sein bester Freund, und meine Meinung wäre ihm unangenehm. Verstehst du, Ed, der Wahnsinn kann sich auf interessante, ungewöhnliche Weise ausdrücken. In einigen Gesängen des Maldoror von Lautréamont zum Beispiel findest du den reinsten Wahnsinn, aber wie interessant er ausgedrückt ist! Bei Arkadij war es der Wahnsinn des Chaos, ein monotoner, niederdrückender Wahnsinn.«
Sie laufen schweigsam fünfzig Meter weiter. An manchen Stellen ist der alte Asphalt des Gehwegs brüchig geworden, und es sprießt hier ein Bäumchen, dort ein Klettentrieb oder ein Büschel Unkraut hervor.
»Wie die antiken Gehwege… Das ist Pompeji, nicht Charkow…« Das rundliche Gesicht Melechows erheitert sich. »Und ich, Ed, ich höre auf bei den Anleitern. Man gibt mir eine Buchhandlung.«
Ed denkt, daß Melechow, der ein so guter Bücherkenner ist und in der Kunst des Straßenverkaufs nur Igor Jossifowitsch nachsteht, in einem Buchladen am richtigen Platz ist. Anleiter beim Gebietskomitee des Komsomol, das ist kein Beruf für Melechow. In den zweieinhalb Jahren ihrer Bekanntschaft hat Ed keine großen karrieristischen Neigungen an dem Sohn einer Hausmeisterin feststellen können. Die Jungs sind Idioten, denkt Ed. Haben den armen Tolja boykottiert. Und dieser Trottel von Motritsch hat damit angefangen. »Verkauft hat er sich, verraten die Boheme!«
»Und wo, Tolja, welche Buchhandlung?«
»Das errätst du nie.« Melechow bleibt stehen, stellt seine Aktentasche auf den Gehweg, holt ein Taschentuch raus und trocknet sein errötetes Gesicht. »Ich werde Direktor der ›Militärischen Buchhandlung‹.«
»Direktor?«
»Ja. Schließlich habe ich die philosophische Fakultät abgeschlossen. Ich habe ein Recht darauf. Eine Mannschaft von dreiundzwanzig Leuten!« erklärt Melechow stolz. »Der Laden selbst ist nicht so besonders, er macht seit mehreren Jahren Verluste. Ich will alles umorganisieren, die Leute einen nach dem anderen feuern und mir meine eigenen ranholen. Das wird eine feine Futterkrippe. Auf jeden Fall nehme ich Lonka Iwanow. Wir haben zusammen für den ›Poesie‹-Laden den Straßenverkauf gemacht, als ›Poesie‹ gerade eröffnet worden war.«
»Sie werden dir den ganzen Laden ausrauben.« (In unserem Helden ist plötzlich der den Intellektuellen gegenüber mißtrauische und skeptische Arbeiter wieder wachgeworden.) »Man darf der Boheme nicht vertrauen… Außerdem bauen sie alle wahnsinnig ab. Zum Beispiel dein alter Freund Motritsch, Tolja… Das letzte Mal ist er bei uns eingeschlafen und hat unser Bett vollgepißt. Daß einer trinkt, naja, aber warum das Bett…«
»Aber Lonka Iwanow ist nicht Motritsch. Und selbst Motritsch könnte gerettet werden, wenn man seine Gedichte verlegen würde. Ein Buch. Bloß ein kleines. Dann würde er sich wieder aufrappeln. Ein Mann kann nicht unaufhörlich schreiben, ohne Ergebnisse zu sehen. Schon das winzigste Buch würde ihm wieder Selbstvertrauen geben…«
Ed glaubt nicht, daß Motritsch aufhören würde zu trinken, wenn ein Gedichtband von ihm herauskäme. Das Trinken und das Herumstreunen in den Straßen Charkows sind für Motritsch schon längst von einem Vergnügen zur Lebensnotwendigkeit geworden. Früh morgens geht er in den »Automaten«, und da er eine Unmenge Freunde hat, ist er mittags schon betrunken, und dann duselt er auf seiner Bank im Schewtschenko-Park vor sich hin und macht nur ab und zu ein Auge auf, um zur anderen Seite der Sumskaja hinüberzulinsen, zu den beiden Eingängen des »Automaten«, um zu gucken, ob nicht noch ein neuer Bekannter auftaucht.
Melechow zieht sein Jackett an, holt aus seiner Aktentasche die bereits geknotete Krawatte und streift sie sich über den Kopf. »Ich gehe jetzt, man muß leiden bis zum bitteren Ende«, seufzt er. »Wenn du wüßtest, Ed, mit was für Scheißkerlen ich zu tun habe…« Er nimmt seine pralle Aktentasche und entfernt sich, kurzbeinig und korpulent.
Melechow hat zugenommen, sagt sich Ed, während er ihm nachschaut. Da sieht man, wohin ihn seine Liebe zu dieser Brillenschlange Anja Wolkowa gebracht hat. Er tanzt nach der Pfeife von Anjas Mutter und Freunden. Obschon der Fleisch-und Fisch-Trust Wolkow selbst im letzten Jahr an Krebs gestorben ist, ist seine Familie durchaus dem Milieu der sowjetischen Elite erhalten geblieben. Es bleiben seine Brüder, Mitglieder des Gebietskomitees, Generäle, Chefs, und seine noch einflußreicheren Moskauer Verwandten und Freunde. Natürlich sind sie es, die Melechow jetzt zum Direktor machen, nachdem sie sich davon überzeugt haben, daß Anjas Mann überhaupt nicht fähig dazu ist, Karriere zu machen, und daß seine Aufgaben als Anleiter beim Gebietskomittee des Komsomol ihn ankotzen. Kann ein Absolvent von Abendkursen an der philosophischen Fakultät Direktor einer großen Buchhandlung werden? Nein! Niemals! Die Wolkows haben wahrscheinlich den Familienrat einberufen und entschieden: Da Anjas Gatte, dieser Schwachkopf, weder im Komsomol noch im Parteiapparat Karriere machen will bzw. kann, geben wir diesem Idioten doch die Möglichkeit, sich mit seinen gehebten Büchern zu beschäftigen. »Was haben wir denn Passendes an der Buchfront, Iwan Iwanowitsch?« Iwan Iwanowitsch öffnet ein dickes Heft, durchblättert es, sucht. Der Mann von Anja, der Schwiegersohn von Wolkow kann und darf unmöglich etwas Geringeres als Direktor werden, sonst würde sich der krebszerfressene Leichnam Wolkows im Grabe umdrehen und nachts heraussteigen, um den Passanten auf den Straßen Charkows das Blut auszusaugen. »Geben wir ihm die Militärische Buchhandlung‹. Soll er sich in seinen geliebten Büchern vergraben.«
Ed setzt sich auf eine Bank und denkt nach, während er mit dem Blick einen Riß im Asphalt verfolgt — Charkow trocknet aus. Ist es eine langsam austrocknende, vielleicht eine sterbende Stadt?… Und hat Ed, hat Melechow selbst in jenem schon lange zurückliegenden Winter des Jahres 1964/65, als sie bei ihm in der Kontorskaja-Straße saßen und Borschtsch aßen, den die Hausmeisterin auf einem richtigen alten Kohleherd gekocht hatte (Melechow mußte an dem Tag dringend zum Dienst, er war damals noch Heizer, und spornte Ed zur Eile an) — hatten sie beide damals geahnt, daß sich Melechows Schicksal einmal so wenden würde? Und wenn du in den Epilog schaust, Leser, wird dich der Schrecken packen angesichts dessen, was Melechow später noch bevorsteht. Um noch einmal unseren Helden zu zitieren, sagen wir, mit einem Seufzer, daß man niemals im voraus wissen kann, was aus einem Jungen oder einem jungen Mann einmal werden wird.
29
Oder ist es vielleicht doch möglich? In letzter Zeit spürt Ed sehr deutlich, daß er etwas Besonderes ist, daß er sich von den übrigen Menschen, sogar von der Boheme, unterscheidet. Jeden Tag überzeugt er sich aufs Neue von seiner Außergewöhnlichkeit. Manchmal ist ihm dies Gefühl, etwas Besonderes zu sein, peinlich, manchmal erfüllt es ihn mit großer Freude. Wann hat das angefangen? Wann hat er zum ersten Mal gespürt, daß er anders ist? Es kommt ihm so vor, als hätte er das Gefühl schon immer gehabt. Nur manchmal hat er, für Monate oder gar ein Jahr, vergessen, daß er herausragt, und dann ist er mit der Menschenherde mitgelaufen und hat sich ihren Regeln angepaßt.
Als er etwa als Neunjähriger, bloß auf seine vagen Erinnerungen vertrauend, mit der Straßenbahn von Saltow zum »Kalten Berg« gefahren war (zweimal hatte er umsteigen müssen!), um seine große Liebe Natascha Kartamyschewa zu besuchen, hielt er sich schon lange für etwas Besonderes. Es war Winter, es taute, am Rand der Bürgersteige häufte sich der schmutzige Schnee, und Ed nagte den ganzen Weg über nervös an einem der Bänder seiner Ohrenklappenmütze, die ihm lose über die Wangen hingen. Das Mietshaus für Offiziere, in dem auch sie — seine Mutter Raissa Fjodorowna, sein Vater Wenjamin Iwanowitsch und er selbst, der kleine Reisende — vor ihrem Umzug nach Saltow gewohnt hatten, war alt und feucht und hatte mehrere Aufgänge. Natascha war nicht zu Hause, sie war noch in der Schule. Die Eltern Kartamyschew waren auch nicht da. Die einzige, die er antraf, war die Großmutter, die ihn an den mit einem Wachstuch bedeckten Tisch setzte und ihn mit selbstgemachten Zuckernüssen bewirtete. Später kam der Offizier Kartamyschew, er trug einen Uniformmantel mit Lederriemen und Koppel und einen Revolver an der Seite. Ohne seinen Mantel abzulegen, rief Kartamyschew Wenjamin Iwanowitsch an, um ihm mitzuteilen, daß sein Sohn sich aus unerfindlichen Gründen in seiner Küche befinde. Natascha Kartamyschewa kam von der Schule heim, sie sagten sich Guten Tag. Natascha war überhaupt nicht erstaunt, ihn zu sehen. Dafür waren die Eltern und die Großmutter um so überraschter. Natascha nahm ihre Mütze ab, und ihre blonden Haare fielen herunter. Natascha hatte sich verändert seit der Zeit, als sie noch im gleichen Haus gewohnt hatten. Auf den ersten Blick hatte er verstanden, daß die alte Natascha tot war, deshalb sprach er, nachdem sie sich begrüßt hatten, auch nicht weiter mit ihr, obschon alle übrigen Kartamyschews aus dem Zimmer gegangen waren, um die zwei allein zu lassen. Dann kam sein Vater, mit schneebedeckten Schuhen, auch er trug Gürtel und Koppel wie der Offizier Kartamyschew und einen Revolver, bloß roch seiner stärker nach Metall und Fett. Bestimmt hat Vater gerade seinen Revolver gefettet, das macht er gern, stellte der Reisende zerstreut fest. Schließlich fuhren sie zurück nach Saltow, wieder mußten sie zweimal umsteigen. Bei der Heimkehr, am Ende der Reise, war das Band seiner Mütze steifgefroren.
Diese Geschichte steckt voller unklarer Aspekte. War dieser Typ mit der runden Lammfellmütze, deren Bänder die langen Ohrenklappen nach unten verlängerten, wirklich in Natascha verliebt gewesen, oder war es bloß das Heimweh nach seiner Vergangenheit, nach seiner frühesten Kindheit gewesen, das ihn zum »Kalten Berg« gelenkt hatte, wo neben dem berühmten gleichnamigen Gefängnis das große Mietshaus für Offiziere stand? Wie auch immer, er war enttäuscht und machte sich nie wieder auf die Suche nach der verlorenen Zeit. Im Gegenteil, 1954 rannte er, auf der Suche nach der Zukunft, in Richtung Brasilien davon… Beweisen diese ständigen Fluchten, daß unser Held etwas Besonderes ist?
In jenem Winter, in dem der gastfreundliche Sohn der Hausmeisterin in der Kontorskaja-Straße den Deckel von dem blauen, bis zum Rand mit Borschtsch gefüllten Emailletopf hob (während Melechows Mutter mit geschürztem Rock auf den Knien den Fußboden im Zimmer aufwischte), in diesem Winter hatte es eine große Diskussion gegeben, an die sich unser Held bis heute erinnert. Der Streit ereignete sich bei der Endhaltestelle der Ringbahn in Saltow; dort, wo die Bahn in einem großen Halbkreis wendet, liefen Ed und Jurij Kopissarow hin und her, um sich aufzuwärmen.
»Ich scheiße auf dein Kollektiv, Jura…«, sagte Ed, »zuerst kommt das biologische Individuum, und erst dann kommt das Kollektiv.«
»Red nicht solchen Stuß, Ed!« erwiderte Jurij gehässig. Nach einem Jahr Studium an der physikalisch-mathematischen Fakultät der Universität von Charkow, von wo man ihn wegen seiner schlechten Prüfungsergebnisse relegiert hatte, sprang er nun als Schlosser und Monteur um Motoren herum, die das Fließband in der Montageabteilung von »Hammer und Sichel« an ihm vorbeitransportierte. Er schuftete zusammen mit anderen Versagern, die man irgendwo relegiert oder nicht zugelassen hatte. Ed hatte im August (wie wir schon wissen, mit der Hilfe von Jurijs Bruder) in dieser Fabrik aufgehört und lebte seither, nach einem kurzen Zwischenspiel als Buchverkäufer, ohne bestimmte Arbeit nach dem Prinzip »Gott gibt uns den Tag und also auch zu essen«. Jurij empfand daher gegenüber Ed den Klassenhaß des Proletariers gegenüber dem Lumpenproletarier.
»Red nicht solchen Scheiß, Ed! Das Kollektiv und seine Bedürfnisse waren sogar die Basis der primitiven Gesellschaft. Die Bedürfnisse der Individuen kamen erst später.« Jurij knöpfte den letzten Knopf seines eleganten, in englischem Stil geschnittenen Mantels zu. Den Mantel hatte eben jener berühmte Charkower Modeschneider ihm genäht, der Jahre danach die Begeisterung von Tolik dem Abstrakten erregte: Bobow. Er bestand übrigens darauf, daß man seinen Namen auf der letzten Silbe betont, Bobow, wie Dostojewskijs Bobôk. Bobôw studierte damals an der physikalisch-mathematischen Fakultät, ihn hatte man noch nicht relegiert. Das kam erst ein paar Jahre später.
»Dein Kollektiv, das ist die Hammelherde«, sagte Ed. »Das sind die schlimmsten, dein Kollektiv. Die Schwächsten. Sie scharen sich zusammen, um die Besseren zu unterdrücken, ihnen die Entfaltungsmöglichkeiten zu nehmen. Knut Hamsun, Jura, hat in einem seiner Stücke gesagt, daß man alle Arbeiter mit dem MG niedermähen müßte.«
Jurij verschluckte sich vor Wut und öffnete seinen Kragenknopf. Sein Zweiwochenschnurrbart zuckte erregt unter seiner Nase. »Der war ein Faschist, dein Knut Hamsun. Er hat Hitler gerühmt!«
»Ein Schriftsteller kann nicht Faschist sein. Er ist Schriftsteller, das ist alles. Knut Hamsun ist ein sehr guter Schriftsteller. Hast du ›Der Hunger‹ gelesen, Jurij?« (Zu jener Zeit fand Ed es noch notwendig, Hamsun vor der Beschuldigung, er sei Faschist, in Schutz zu nehmen. Heute würde er gleichgültig sagen: Faschist, na und? Das war schließlich seine Sache. »War«, weil er nicht mehr lebte. Ed hatte noch nicht von Ezra Pound und Céline gehört; und die Theaterstücke und Romane von Hamsun waren sowohl vor als auch gleich nach der Revolution ins Russische übersetzt worden.)
»Du hältst dich bestimmt für den Besten, Ed, oder?« Jurij verzog seine ererbte Kartoffelnase. Die ganze Familie Kopissarow hatte diese Nase, sein Bruder Mischa, der im Gefängnis saß, Papa Kopissarow, der Meister in einer Fabrik war (wiederum »Hammer und Sichel«) und Jurij. Eine normale jüdische Nase darf nicht die Form einer Kartoffel haben, und ein normaler Jude darf nicht bei »Hammer und Sichel« arbeiten, dachte Ed, hielt sich aber zurück.
»Du hältst dich für was Besonderes, Ed, ich weiß. Was Außergewöhnliches… Aber du hast nicht den geringsten Grund…« Jura sah Ed wütend an. »Welchen Grund könntest du schon haben? Daß du Gedichte schreibst? Millionen von Typen in deinem Alter schreiben Gedichte! Millionen! Ich glaub nicht, daß du was Besonderes bist. Du bist wie alle! Hörst du! Wie alle…«
Als er diesen Ausruf des triumphierenden Pöbels hörte, die Stimme des Kollektivs, die Stimme all derer, die sich an der Unterdrückung des einzelnen berauschen, schämte Ed sich sogar für Jura.
»Eh«, sagte er, »hör auf, solche Sauereien abzulassen! Wieso bist plötzlich auch du so ein Nachbeter dieser alten Prinzipien?«
Aber sein Freund sah ihn finster an unter seiner Mütze aus Hirschkalbfell, die ihm fast bis über seine dichten Augenbrauen gerutscht war. »Du bist wie alle!« wiederholte Jura starrköpfig.
Gerade das glaubte Ed nicht. Er hätte nicht beweisen können, daß er nicht wie alle war, wenn man ihn dazu aufgefordert hätte, aber er glaubte daran, daß er etwas Besonderes sei. Manchmal wurde dieser Glaube schwächer, aber ganz verließ er ihn nie.
»Deine Mutter hat mich gebeten, mit dir zu sprechen«, sagte Jura plötzlich als Erklärung dafür, daß er auf dem Thema so lange herumritt. Und außerdem hat es ihm Spaß gemacht, einem alten Freund eine Lehre zu erteilen, dachte Ed.
»Ich scheiße auf dein Kollektiv, Jura!« sagte Ed herausfordernd. »Und was mischst du dich da ein? Das ist mein Leben, daraus mach ich, was ich will.«
»Eben. Raissa Fjodorowna sagt, daß du dein Leben lang mit den größten Schwierigkeiten aus einer Scheiße rauskommst, nur um in die nächste zu geraten.«
»Auch wenn ich immerhin so weise gewesen bin, nicht im Gefängnis zu landen. Und da sprichst du von Scheiße!« Ed war aufrichtig verwundert.
»Du hast Glück gehabt«, erwiderte Jurij neidisch. Zumindest er wußte ganz genau, daß Ed Ende letzten Jahres beinahe zusammen mit seinem älteren Bruder im Gefängnis gelandet wäre.
»Jura«, Ed beschloß, friedlich zu sein, »erkläre meiner Mutter, daß das jetzt eine andere Sache ist. Daß die Leute, mit denen ich zusammen bin, Anna und ihre Freunde, schließlich genau die sind, denen ich immer begegnen wollte. Intelligent. Belesen. Kreativ. Meine Mutter kann jetzt beruhigt sein.«
»Wie soll sie das wissen, Ed?… Und ich bin mir, um die Wahrheit zu sagen, auch nicht sicher. Anna ist sechs Jahre älter als du. Außerdem ist sie ›schizo‹.« Der kleine Jura machte eine Grimasse. »Die alle wollen nicht arbeiten. Dehalb behaupten sie, Avantgardisten zu sein und tun so, als ob sie kreativ wären. Sie wollen nicht in die Fabrik gehen und den ganzen Tag an einer Maschine oder am Band schuften.«
»Und warum sollten sie schuften, wenn sie zu Größerem geschaffen sind?«
»Und ich, ich bin deiner Meinung nach nicht zu Größerem geschaffen!« Jurij riß wütend seinen Schal vom Hals. Ed zuckte mit den Schultern.
»Vielleicht. Schreib doch. Oder male.«
»Nicht jeder kann Gedichte schreiben oder malen«, schrie er. »Verstehst du das nicht? Es muß auch Leute geben, die die Schrauben an Traktorenmotoren festziehen, wie ich es mache!«
»Sei nicht hysterisch. Hör auf, Schrauben festzuziehen. Wer verlangt das von dir? Wer? Du hast doch Physik und Mathematik belegt. Also hättest du auch studieren sollen.«
»Das war mein Fehler.« Die Stimme des kleinen Jura wurde trocken. »Es hat mir den Kopf verdreht, daß sie mich in einer so superfeinen Fakultät genommen haben, ich hab das ganze Jahr nichts gemacht. Ich hab gesoffen, das ist alles, hab mich herumgetrieben, Mädchen… Ich hab bloß auf der faulen Haut gelegen, kurz gesagt… Und sie haben mich gefeuert.«
»Schreib dich wieder ein.«
»Um Physiklehrer zu werden?«
»Oooooh! Ich weiß nicht, Jura…«
Sie waren bis zur Ecke gegangen, wo ein eisig-winterlicher Windstoß ihnen ins Gesicht peitschte, so daß sie umkehrten. Es war Sonntag, alle Läden entlang der Straßenbahnlinie waren geschlossen. Es gab nur wenig Passanten. Ed war zum ersten Mal seit vielen Monaten nach Saltow zurückgekommen, um seine Eltern und bei dieser Gelegenheit auch Jurij zu sehen. Ed lebte schon am Tewelew-Platz 19, aber noch nicht legal.
»Auch du willst nicht arbeiten, Ed«, sagte Jura.
»Offenbar läßt dich diese Frage nicht in Ruhe, Jura. Warum gehst du mir mit deinem ›arbeiten‹, ›arbeiten‹ auf den Wecker? Warum? Arbeitest du vielleicht für mich? Bist du es, der mich ernährt?«
»Du und deinesgleichen, ihr seid die Parasiten der Gesellschaft.«
»Ich? Ein Parasit? Offiziell habe ich noch gar nicht aufgehört beim Buchladen. Erst seit drei Wochen arbeite ich nicht mehr.«
»Straßenverkäufer, das ist nichts für einen gesunden Mann Anfang zwanzig. Das ist ein Job für einen Alten oder Invaliden.«
Es war unmöglich, mit ihm zu diskutieren. Ed verstand nicht, wo er diesen hausbackenen Vulgärmarxismus her hatte. Vor nicht allzu langer Zeit war er noch ein ganz normaler, fortschrittlicher Typ gewesen…
30
Zu der Zeit, da unser Held in seinem stadtbekannten kakaofarbenen Anzug, fünfzig Meter von den granitenen Beinen des berühmten »Kobsaspielers« entfernt, versonnen auf einer Bank sitzt, um sich seiner Lieblingsbeschäftigung — der Selbstanalyse — hinzugeben, trabt Anna Moissejewna mit klappernden Absätzen die Sumskaja hinab; sie geht nach Hause zu Mama Zilja. Ein über die ganze Straße hinweg sichtbarer großer rosafarbener Fleck — unmöglich zu übersehen.
Wo ist der kleine Dreckskerl? fragt sich Anna. Sicher treibt er sich herum, aber mit wem? Vielleicht ißt er im »Lux« mit Genka zu Abend? Gut möglich. Sie essen Schaschlik, diese Herumtreiber. Und als Vorspeise hat Genka bestimmt eine gemischte Platte bestellt, oder nein… (Anna schließt die Augen und versucht, den Tisch und das Essen darauf »zu sehen«. Diese Fixierung auf das Essen ist eine ganz spezielle Eigenart von ihr. Immer fragt sie ihre Freunde, was sie den Tag über gegessen haben.) Genka und der kleine Dreckskerl essen Islandhering (aus der Dose) und trinken aus den kleinen Gläsern des »Lux« eisgekühlten Wodka, diese Schweinehunde. Als Anna Moissejewna in der anhaltenden Hitze des Nachmittags (sie bleibt mit den Absätzen im Asphalt der Sumskaja stecken) an den eisgekühlten Wodka denkt, durchfährt sie ein Schauer, und sie nimmt Kurs auf den nächsten Fußgängerüberweg, um weiter unten auf der anderen Seite einen Blick ins »Lux« zu werfen: Vielleicht sitzen Ed und Genka ja wirklich dort?
»Anjuta… liebliches Wesen, sagt man Alik nicht mehr Guten Tag?« Anna dreht sich um und sieht einen Mann, den man in jeder Stadt auf der Welt für einen Penner halten würde. Seine grauen, schmutzigen Haare hat er nach hinten gekämmt, sie sind steif wie die Haare einer Statue. Seine dreckige Hose hängt sackartig an ihm herunter, und seine Sandalen kleben an staubverdreckten Füßen. Die hängenden Schultern stecken allerdings in einem sauberen, vom vielen Waschen grau gewordenen weißen Hemd. In der Hand trägt er ein Netz, in dem Elektrokabel und Zeitungen zu erkennen sind.
»Wozu hast du dich so aufgeputzt, Alik? Guten Tag.« Anna kann nicht umhin, die borstigen, grauen Haare an seinem Ohr wenigstens flüchtig zu berühren. Ein starker und säuerlicher Geruch nach Wein, vermischt mit einem Geruch von Speiseresten im Endstadium der Zersetzung umhüllt Anna, die den Atem anhält, als Alik einen Arm um ihre Hüfte und auf die obere Partie ihres Hinterns legt und dreimal seine Wangen und Lippen auf ihre Wangen drückt. Alik Basjuk war gewissermaßen ein Freund ihres früheren Mannes, also was hilft's, da muß man diese unangenehme Begrüßungszeremonie mit einem Stück Scheiße schon über sich ergehen lassen, denkt Anna. Und schämt sich sofort ihrer Gedanken. Basjuk ist ein guter Typ, ein Alkoholiker, den das Leben zerbrochen hat. Er ist fünfzig, aber sieht aus wie fünfundsechzig. Wegen seiner langen und losen Zunge ist Basjuk unter Jossif Wissarionowitsch Stalin ins Lager gewandert. Er ist zur gleichen Zeit aus dem Lager zurückgekehrt wie Tschitschibanin, Solschenizyn und Tausende oder Zehntausende anderer Pechvögel. (Wer hätte sie zählen sollen?) Tschitschibanin hatte genug Willenskraft aufgebracht, um seine frühere Beschäftigung, Gedichte zu schreiben, wiederzuaufnehmen; Alik Basjuk dagegen wird zwar offiziell auch als Schriftsteller geführt und lebt von dem Geld, das ihm der Verband als Unterstützung zahlt, aber Gott allein weiß, was er bislang geschrieben hat. Und ob er überhaupt schreiben kann. Wenn er doch bloß nicht so stinken würde!
»Ich gehe Mama im Krankenhaus besuchen, Anna.« Basjuk, dessen Blut zu mehr als der Hälfte aus sauer gewordenem Alkohol besteht, kann nicht ruhig stehen bleiben, seine Arme und Beine bewegen sich ständig, der Penner-Schriftsteller hat den Tremor.
»Warum bringst du deiner Mama keine Blumen mit, Alik?« Anna überrascht sich dabei, daß sie mit ihm wie mit einem Kind spricht.
»Sie ist doch alt, Anjuta.« Alik lächelt und zeigt seine vom Nikotin gelben Zähne.
»So was Dummes, Alik. Die Frauen haben es gern, wenn man ihnen Blumen schenkt. Auch alte Frauen.«
Aus Aliks Netz, das im Takt mit seinem Besitzer zittert, fällt plötzlich scheppernd ein nicht näher identifizierbarer verchromter Gegenstand auf den Asphalt. Basjuk bückt sich.
»Was denn, Alik, bist du jetzt unter die Charkower Schrottsammler gegangen?« Anna lächelt, weil ihr plötzlich ein Lied einfällt, das die Bande ihres Mannes (Buritsch, Tschernenko, Brussilowskij) in Anlehnung an ein berühmtes Gaunerlied gesungen hat:
Drei Dichter sind entkommen
Aus dem Arbeitslager von Charkow
Drei Dichter sind barfuß entkommen,
Der eine war Eisenstadt,
Der zweite ein Degenerierter,
Und der dritte, verzeihen Sie, Basjuk…
Schon damals hatte man sich für Basjuk entschuldigen müssen. »Das ist kein Schrott.« Basjuk ist beleidigt. »Das ist ein Elektrorasierer.«
»Was, du läufst mit einem Elektrorasierer herum, Alik?« Anna betrachtet grinsend den mehrere Tage alten Bart von Basjuk.
»Ich will Mama rasieren, Anjuta. Mama ist alt, ihre Barthaare wachsen sehr schnell. Vor allem ihr Schnurrbart. Deshalb rasiere ich sie alle drei Tage.«
Anna, die den üblichen Satz Basjuks »Leihst du mir einen Rubel, Anjuta?« nicht erst abwarten mag, schiebt Alik einen Rubel in die Hand und entkommt bei grün über die Straße. Ein Alptraum! Anna will weder an Basjuk noch an seine schreckliche Mama im Krankenhaus denken, aber ihre wuchernde Einbildungskraft entwirft gegen ihren Willen das Portrait einer alten Frau mit grünlichem Teint und borstigem Schnurrbart vor ihrem inneren Auge. Sie stinkt doppelt so schlimm wie Basjuk. Ekelhaft. »Oh, Mama«, ächzt Anna laut und läuft, schnell, schnell, an den Hausmauern entlang die Sumskaja hinab — wie eine watschelnde Ente.
Im »Lux« erfährt sie vom Kellner Wolodja, der gerade einen Tisch deckt, daß ihr Mann noch nicht aufgetaucht sei. Das Restaurant ist noch ganz im vorrevolutionären Stil gehalten, seinerzeit kamen die Kaufleute dort essen. Und Gennadij Sergejewitsch, der Sohn des Direktors des Restaurants »Kristall«, sei auch nicht gekommen.
»Ich habe sie heute morgen die Sumskaja hinauflaufen sehen.« Wolodja hebt die Augen von dem Tisch, den er gerade deckt und betrachtet Anna finster. »Aber sehr früh vormittags. Er liebt das süße Leben, Ihr Gatte, Anna Moissejewna. Man sieht prächtig aus! Braun. Man geht die ganze Zeit spazieren…«
Das »man«, mit dem Wolodja vom kleinen Dreckskerl spricht, klingt ironisch, und Anna sagt sich, als sie das »Lux« verläßt und sich bemüht, das letzte Stück Gehweg zu bezwingen, das sie vom Tewelew-Platz 19 trennt, daß der kleine Dreckskerl wirklich zu viel Freiheit genießt. Sie, Anna, arbeitet unablässig. Erst im »Poesie«-Laden, dann im Möbelgeschäft, in der »Wissenschaftlichen Buchhandlung«, jetzt im Kiosk, während sich der kleine Dreckskerl wie ein Georgier oder ein Sizilianer, ein Brasilianer, genau, so ist es, eher wie ein Brasilianer im kakaofarbenen, mit Goldfunken gesprenkelten Anzug in den Parks und auf den Plätzen der Stadt herumtreibt. Das »süße Leben«, gut getroffen. Was anderes kann man über das Leben des kleinen Dreckskerls kaum sagen. Und die arme Anjuta schuftet! Und die arme Zilja Jakowlewna kocht gefilte fish für diesen Goj! Er hat es sich bequem gemacht, der kleine Dreckskerl! denkt Anna wütend und beschließt, das dem kleinen Dreckskerl zu sagen, wenn er von seiner Tour nach Hause kommt. Der kleine Dreckskerl, der zwei arme jüdische Frauen ausbeutet! empört sie sich ein letztes Mal, und nachdem sie am Institut für Kältetechnik vorbeigegangen ist, wo bereits die Abendschüler zusammenkommen, überquert sie den Bursatzkij-Abhang und betritt ihr Haus.
Das Innere des alten Gebäudes stinkt muffig nach Feuchtigkeit, nach kaltem Stein, nach Katzen- und Männerpisse. Die Treppe, die so aussieht, als sei sie aus einem Film, den man nach einem Dostojewskij-Roman gedreht hat, und deren ausgetretene Stufen seit dem Krieg nicht mehr repariert worden sind, führt direkt in den ersten Stock, es gibt kein Erdgeschoß, wer weiß, warum. Wie oft schon hat Anna gezittert, wenn sie allein den Hauseingang betrat, wie oft schon haben dort Männer, die sie nicht begehrte, im Dunkeln auf sie gewartet, und wie selten Männer, die sie begehrte…
Aber trotz allem, denkt Anna, während sie die Treppe hochsteigt, kann man nicht bestreiten, daß der kleine Dreckskerl einen positiven Einfluß auf ihr Leben hat. Auch Mama Zilja bestätigt das. Der kleine Dreckskerl bändigt Anna.
»Ein Mann kann natürlich nicht ewig mit einer Frau zusammenleben, die älter ist als er, Anetschka. Eines Tages wird Eduard dich verlassen«, hat kürzlich Zilja Jakowlewna, in ihrer Lieblingspose — eine Hand auf der Hüfte, in der anderen Hand eine Zigarette —, ruhig und zutreffend bemerkt. »Mir selbst ist es natürlich lieber, daß du mit einem Mann zusammenlebst, Anetschka, das ist besser als früher, als du bei überhaupt keinem bleiben mochtest…« Zilja Jakowlewna war gerade von einem Tee bei den reichen Verwandten zurückgekommen, sie trug noch ihr Prachtgewand — ein schwarzes Kleid mit weißem Spitzenkragen — und eine Kamee, ein Frauengesicht, die sie knapp unter dem hohen Ausschnitt angesteckt hatte. »Du mochtest bei keinem bleiben«, war die Formulierung, die die untadelige und feinfühlige Zilja Jakowlewna gewählt hatte, statt des wesentlich gröberen Ausdrucks »Gelegenheitsbeziehungen« oder des eher wissenschaftlichen Begriffs »Promiskuität«, der in jener Zeit in der Sowjetunion noch kaum verbreitet war, der aber präzise den Zustand beschreibt, in dem der Exgießer sein Mädchen gefunden hatte. »Eine Frau muß ihren Mann haben, Anetschka.«
»Zilja, dieser kleine Dreckskerl ist anämisch, er ist kein Mann. Als er frisch aus der Fabrik in die Stadt kam, da, ja, da sah er noch aus wie ein richtiger Mann, aber seit er mit den Dekadenzlern zusammen ist, ist er anämisch geworden.«
»Eduard ist jung, aber er ist ein Mann, Anetschka.« Zilja Jakowlewna hätte auf die Frage, ob ihr der Mann ihrer jüngsten Tochter gefiele, nicht antworten können. Aber niemand, nicht einmal sie selbst, stellte diese Frage. Was für Anna gut war, war auch für Zilja Jakowlewna gut. Anna geht es gut. Jedenfalls schläft sie jetzt immer zu Hause. Früher verschwand sie manchmal für mehrere Tage oder sogar Wochen, damals schlief Zilja Jakowlewna schlecht, rauchte viel und lag tagelang im Fenster, um den Platz im Auge zu behalten und auf Anna zu warten. Jetzt kommen sie alle nach Hause. Wenn der kleine Dreckskerl seiner Spaziergänge mit Genka durch die Stadt, ihrer Suche nach Vergnügungen und starken Erregungen müde ist, macht er sich gewissenhaft an die Schneiderei, um die Vorschüsse, die er bei seinen Streifzügen verpraßt hat, abzuarbeiten. Die Stoffe bedecken den Tisch im Eßzimmer, man hört die Nähmaschine rattern. Zilja Jakowlewna sitzt mit einer Zigarette in der Hand neben dem Spiegel und diskutiert mit dem kleinen Dreckskerl in aller Ruhe über Literatur, über Platonow oder Pasternak; Anna bringt aus dem »Poesie«-Laden, obwohl sie schon lange nicht mehr dort arbeitet, die neuesten und rarsten Bücher mit, und die kleine Familie gerät jedesmal in Begeisterung. In der Pause, wenn Anna vom Kiosk kommt, schiebt der kleine Dreckskerl seine Stoffe ans Tischende, und dann ißt man zu Mittag. Der »Kaviar« aus kleingehacktem Gemüse oder die Salate, die Zilja Jakowlewna zubereitet, erhalten lebhaften Beifall in der Familie. Der kleine Dreckskerl hat eine besondere Schwäche für Fleischpastete. Sicher würde Zilja Jakowlewna es vorziehen, wenn der Mann ihrer jüngsten Tochter ebenso groß, handfest und kräftig wäre wie der Mann ihrer ältesten Tochter, Theodor Sokolowskij. Und noch besser wäre es, wenn er einen technischen Beruf hätte. Und natürlich, wenn er Jude wäre. Das wäre viel beruhigender. Obschon Annas erster Gatte Jude gewesen ist und sie trotzdem sitzen ließ, bei ihrer ersten Erkrankung.
Der kleine Dreckskerl näht, bügelt und verbreitet in den beiden Zimmern einen Geruch nach geplättetem Stoff. »Komm, laß dich beschneiden, Ed! Dann bist du endlich ein ganzer Jude…« spottet Anna beim Anblick ihres in seine Arbeit versunkenen Gatten. »Einen jüdischen Beruf hast du ja schon.«
»Wieso einen jüdischen?«
»Die meisten Schneider in Charkow sind Juden. Das ist schon immer ein jüdischer Beruf gewesen. Es bedarf eines besonderen philosophischen Temperaments, um Schneider zu sein und sein ganzes Leben damit zu verbringen, Stoffe zusammenzunähen. Mir kommt es so vor, als sei dieser Beruf eng verbunden mit der Lektüre großer jüdischer Bücher, der Thora… Mit der Verlangsamung der Zeit…«
»Findest du, daß ich das Temperament eines Philosophen habe?« Annas Bemerkung interessiert den Schneider.
»Wenn man deine Zechtouren bedenkt, nein, andererseits aber hätte ich nicht einmal die Geduld, einen Sack zu nähen, während du einfach dasitzt und nähst.«
»Wißt ihr denn nicht, Kinder, daß Lew Davidowitsch Trotzkij als Schneider gearbeitet hat, nachdem er nach Amerika emigriert war? Er war Schneider in New York.« Offenbar hat Zilja Jakowlewna ihre Zeit in der technischen Bibliothek nicht vergeudet. Vermutlich war es in der Bibliothek langweilig, und so las sie den ganzen Tag nicht-technische Bücher… Anna öffnet die Tür zum Flur, zieht ihre Schuhe aus und geht barfuß an den Nachbarn vorbei, die über ihren Töpfen hocken. Anna weiß, daß die Nachbarn sie nicht leiden können. Aber Anna Moissejewna kann die Nachbarn auch nicht leiden.
31
Anna Moissejewna hatte mehrere Monate dem Arbeiter und seinem Wunsch, sie zu besitzen, widerstanden. Anfang 1965 war sie zur Kur in ein Sanatorium in Aluschta gereist. Ohne ihre Adresse zu hinterlassen und ohne ihm zu sagen, daß sie verreise. Sie war geflohen. Der junge Soldat mit seinem geschorenen Schädel war im »Poesie«-Laden vorbeigekommen, um Anna zu besuchen, er trug seinen Parademantel aus Ratine. Aber diese kurzbeinige Brillenschlange von Ljuda Wikslertschik hatte ihm hämisch gesagt, daß Anna nicht da sei. »Anna hat eine Kur antreten können, die jemand anders im letzten Moment abgesagt hat, sie ist in einem Sanatorium in Aluschta.«
Ed hatte in einem nahen Weinkeller auf dem Gogol-Boulevard drei Gläser Porto hintereinander getrunken, dann war er zum Bahnhof gegangen. Über die Gründe, die ihn zu diesem brillanten Manöver bewegten, mit dem es ihm gelingen sollte, Annas Herz endlich zu erobern, kann man bloß Vermutungen anstellen. Werfen wir, um diese Eroberung — womöglich das wichtigste Ereignis im Leben unseres Helden — etwas besser zu verstehen, einen kurzen Blick auf die Monate vor seinem Auftauchen in Aluschta.
Sie hatten sich Ende Oktober 1964 kennengelernt. An einem Tag, an dem es unvorstellbar heftig geschneit hatte, hatte Motritsch Ed zu Anna mitgebracht. Sie hatten sich häufig wiedergesehen, Ed kam mit Porto zum Tewelew-Platz 19, setzte sich in eine Ecke und beobachtete schweigsam die Gruppe, die immer auch Annas frühere Liebhaber einschloß: mal Kuligin, mal den gelbgesichtigen Ostjaken, mal Myschkin, den Abstrakten. Der Arbeiter war wie gebannt von den Gedichten, den Kerzen, den literarischen Diskussionen, der Bildung seiner neuen Bekannten; so gebannt, daß er darüber sein Geschlecht vollkommen vergaß — vergaß, daß er einen Schwanz hatte und daß Anna eine Frau war. In seinem grenzenlosen Egoismus des Megalomanen, der sich bis zu seinem zweiundzwanzigsten Lebensjahr einsam und allein durchs Leben geschlagen hatte, zweifelte er nicht im geringsten daran, daß Anna, diese Abende, daß alles ihm gehörte. Anna zufolge (unser Held war betrunken und erinnert sich nur dunkel dieser Geschichte) hatte er eines Tages Myschkin den Abstrakten geschlagen und rausgejagt, weil er für seinen Geschmack etwas zu lange in Annas Wohnung geblieben war. Er selbst brach erst auf, nachdem er sich davon überzeugt hatte, daß der Abstrakte nicht zurückkam. Während er durch die winterliche Stadt nach Saltow lief, fragte er sich, ob er nicht umkehren sollte, um sich davon zu überzeugen, daß kein Mann bei Anna war!
Warum er damals Annas Körper überhaupt keine Beachtung geschenkt hatte, bleibt ein Rätsel. Diese Frau, die erste, die er in der neuen Welt kennengelernt hatte, hatte ihn augenscheinlich schüchtern gemacht. Alle Frauen, die er bis dahin gehabt hatte, waren mehr oder weniger einfache Mädchen aus der Vorstadt gewesen, mit den üblichen Interessen der Mädchen aus der Vorstadt. Klamotten, ein schicker Typ auf einer roten »Jawa«, davon träumten sie. Hinten auf dem Motorrad zu sitzen, ihren Typen an der Taille zu halten, ihre Haare im Wind fliegen zu lassen, waren ihre kühnsten Träume. Ed verstand es noch nicht, bei einer Frau wie Anna zu landen, einer Frau mit wildem, durchdringendem Blick, der selbst die härtesten Kriminellen alter Schule (mit Stiefeln und Schiebermütze) in den Straßenbahnen von Charkow und später Moskaus dazu zwang, aufzustehen und ihr Platz zu machen. Aber der junge Größenwahnsinnige zweifelte nicht an seinem guten Recht auf Anna. Deshalb verlangte er auch eifersüchtig von Anna, ihm Treue zu bewahren.
Kurz vor Silvester waren Anna und der wie immer an ihr klebende Ed mit Kuligin und seinen Freunden herumgezogen und hatten eimerweise gesoffen. Eds erster Kunde (wir kennen ihn bereits), der Physiker Sajatz, seine Freundin Schenja Katznelson, der Freund und Kollege von Sajatz, der magere Physiker mit dem seltenen Vornamen Harry (alle nannten ihn Harris), die blondgebleichte Inna, Freundin und Trösterin aller, die den Spitznamen »Fursa« hatte, der schöne Lonka Bruk, der noch schönere Exfriseur Mirkin, der kleine Dieb Tschernjawskij, Sohn eines Generals, und andere, die namenlos bleiben, waren mit ihren Haschen durch die erst tauende, dann überfrierende und schließlich eisglatte Stadt von Wohnung zu Wohnung gezogen. Ein kollektiver Wahnsinn hatte die Gruppe ergriffen, ein »Massenamok« trieb sie an, erschöpfte und erregte sie… Wer weiß, wie weit sie gegangen wären, nach den Hunderten geleerter Weinflaschen, nach den hunderttausend gewechselten Worten, nach diesen verrückten dostojewskijschen Diskussionen über den Sinn des Lebens — womöglich bis zum Mord, wenn nicht plötzlich ein Ereignis die Atmosphäre entladen und die sich anbahnende Tragödie in eine Farce verwandelt hätte.
Kuligin, Bruk, Ed, Sajatz und Harris hatten in der Menge, die abends den »Gastronom« füllte, vor einem der bauchigen Glastresen eine Kette gebildet, und der schamlose Gewohnheitsdieb Tschernjawskij hatte hinter dem Tresen in eiskalter Ruhe zuerst einen Schinken, dann Wein- und andere Flaschen hervorgeholt und an sie weitergereicht; die beiden weißbekittelten Verkäuferinnen, denen Tschernjawskij währenddessen starr und unverwandt in die Augen blickte, standen wie hypnotisiert, mit offenem Mund, dabei…
Plötzlich waren Milizionäre in den Laden gekommen und hatten sich, als sie die Szene sahen, auf die Diebe gestürzt. Schreie folgten, Stürze in die Sägespäne hinter der Theke, Würgen, Getrampel, Krach, Flüche und die Flucht über die eisglatte Oberfläche der Stadt. Eine halbe Stunde später schlichen Harris, Inna-»Fursa«, Ed, Mirkin, Sajatz und die schöne Schenja in der Puschkin-Straße, scheu umherblickend, aus Toreinfahrten hervor und fanden sich wieder zu einer Gruppe zusammen. Sie staksten die Puschkin-Straße hinab, ohne sich entschließen zu können, zurück in die Sumskaja zu gehen, fanden mit großer Mühe ein Taxi und landeten, nachdem sie dem Fahrer den dreifachen Preis gezahlt hatten, am Ende der Welt in der neuen Wohnung von Harris.
Das Forschungsinstitut, bei dem Harris arbeitete, hatte ihm eine 3-Zimmer-Wohnung verschafft, nachdem er mit siebenundzwanzig seine Doktorarbeit geschrieben hatte. Den Doktor hatte er dafür bekommen, daß es ihm gelungen war, eine Formel zu knacken, die bis dahin noch niemand hatte knacken können.
»Wenn Harris einen Kater hat, vergnügt er sich damit, schwierige Probleme zu lösen. So vermeidet er das Schädelbrummen«, erklärte Sajatz Ed, als sie vom Taxi zu Harris' Haustür schlidderten, dem letzten Haus, hinter dem sich ein Brachgelände erstreckte. Ein regnerischer Wind fegte zwischen den Gebäuden aus weißen Ziegelsteinen hindurch, die alle gleich aussahen. In der Ferne sah man einen dunklen Reck, vielleicht ein Tannenwald. Damit der Leser nicht etwa glaubt, es handele sich hier um gewöhnliche Abenteuer ganz gewöhnlicher Leute, möchten wir darauf hinweisen, daß zwei der sechs, die da aus dem Taxi stiegen, später eines eher ungewöhnlichen Todes sterben werden. Aber folgen wir unseren Helden, betreten wir mit ihnen im Erdgeschoß die neue Wohnung des Physikers.
Das Parkett war das Wertvollste darin, wenn man von dem importierten tragbaren Fernseher mit V-Antenne absah, der in einem Zimmer auf dem Boden stand. Aber das Parkett war eigentümlich verzogen, wellenförmig bog sich das Holz überall nach oben und nach unten. »Wundert euch nicht«, erklärte Harris, »diesen Boden haben nicht die Arbeiter auf dem Gewissen mit ihrer Jagd nach dem Plansoll von tausend Quadratmeter Wohnfläche für ihre sowjetischen Mitbürger. Das war ich. Ich Idiot bin zu einer Dienstreise nach Moskau aufgebrochen und habe den Wasserhahn im Bad offengelassen.« In zwei Zimmern lagen Matratzen auf dem Boden herum. Ein alter abgenutzter Diwan stand im dritten an einer Wand. Die Küche war der am meisten benutzte Raum. Der kleine wackelige Tisch war mit Tassen übersät, in denen Kaffeereste standen. Aufgeweichte Zigarettenkippen schwammen darin.
»Mein Gott!« schrie Schenja Katznelson, als gute Hausfrau. »Du hast diese Wohnung in einen Schweinestall verwandelt, Harris! Wenn man sie einer anständigen Familie gäbe…«
»Als ich sie bekam«, meinte Harris, während er alle vier Flammen seines Gasherdes anzündete, »hab ich die Leute angefleht: Wozu geben Sie mir eine so große Wohnung? Was soll ich damit? Sie haben erklärt: Jetzt, wo du Doktor bist, hast du Anspruch auf zusätzliche Wohnfläche. Damit du besser denken kannst.«
Sie lachten laut. Harris war, und sein tragischer und plötzlicher Tod bestätigt das nun, mindestens ein halbes Genie. Wir können das Wesen und das Gewicht seines Beitrags zur Forschung nicht beurteilen, da sind wir nicht kompetent. Aber daß dieser Typ ein wirkliches Original war, keine Nachahmung oder Kopie wie der größere Teil der Menschheit, daran besteht kein Zweifel.
Die Mädchen bemühten sich, wenigstens Harris' Küche etwas aufzuräumen, und nachdem die Tassen gespült waren, schenkten sie darin den restlichen Porto aus, der die Geschichte heil überstanden hatte. Im Lauf des Abends, der — in Anbetracht der begrenzten Alkoholmenge und der allgemeinen Erschöpfung — nur bis ein Uhr dauerte, flirtete Irina mit dem Buchverkäufer und dem nachdenklichen Genie Harris, während Schenja ihre üblichen Bemerkungen zu ihrem Sajatz abgab. Ed notierte innerlich, daß Sajatz dem Sänger Jacques Brei, den er kürzlich bei Anna auf einer Plattenhülle gesehen hatte, sehr ähnlich sah. Man debattierte leidenschaftlich das Los der anderen Beteiligten an der Razzia im Lebensmittelgeschäft, und um ein Uhr morgens, nachdem jeder seine Meinung dazu geäußert hatte, kam man zu dem Ergebnis, daß wohl alle hatten abhauen können außer vielleicht Tschernjawskij, der sich hinter dem Tresen befunden hatte.
»Wenn Tschernjawskij sich schnappen ließ, geschieht es ihm nur recht!« sagte Schenja. »Er hat uns schließlich in dieses dumme und ganz und gar nicht ungefährliche Abenteuer hineingeritten. Wenn sie Sajatz geschnappt hätten, wäre er auf jeden Fall aus dem Institut gefeuert worden. Ihr seid doch erwachsene Menschen und macht solche Sachen. Diebe! Harris, ein Doktor — und ein Dieb!« Schenja schüttelte den Kopf und zog ihre schönen Augenbrauen in die Höhe. Sie selbst machte im übrigen die gleichen Sachen, sie trank nur weniger und schlief zweimal so viel wie die anderen, sie pflegte ihre majestätische, schwarze und weiße Schönheit.
»Ich glaube, sie haben Kuligin eingesackt«, meinte Mirkin boshaft grinsend. Wie in allen Gruppen, die seit langem bestehen, gab es auch in dieser verdeckte Sympathien und Antipathien. Mirkin schlief mit Wika Kuligin, vielleicht rivalisierte er insgeheim mit ihrem Exehemann.
»Falsch«, sagte Schenja. »›Schlymm‹« (so nannten sie Tolik manchmal) »ist ein sehr vorsichtiger Typ. Außerdem stand er am Ende der Kette, dem Ausgang am nächsten. Er hatte drei Flaschen. Ich habe ihn mit Anna laufen sehen, wie sie die Sumskaja zum Park hin überquerten.«
Alle stimmten darin überein, daß sie nie mehr klauen würden, daß es weder ihrem Alter (Mirkin, der älteste, war neunundzwanzig) noch ihrer Stellung entspreche, solche Dummheiten zu begehen, und dann verteilten sie sich auf die Zimmer, um zu schlafen. In die Stadt zurückzukehren, bei diesem Eiswetter, mitten in der Nacht, war (beim besten Willen) unmöglich. Es gab keinen Bus mehr, und wie in dieser Eiswüste ein Taxi finden? Harris hatte kein Telephon. Da die zwei Paare mit gutem Recht die Matratzen genommen hatten, blieb für den Buchverkäufer nur der alte Diwan. Mirkin, der seinen schwarzen Anzug ausgezogen und sorgfältig zusammengelegt hatte, baute sich aus den Mänteln etwas zusammen, das an ein Nest erinnerte, und schlief darin ein. Ed dagegen schlief nicht, er überdachte, was die schwarzhaarige Schenja gesagt hatte. »Kuligin überquerte mit Anna die Sumskaja in Richtung Park.« Er stellte sich Kuligin vor, ohne sein plumpes Brillengestell, wie er mit Anna auf dem Boden ihres Zimmers hegt. Die Mäntel, die die Tür beschweren, hängen über ihren Köpfen. Er liegt auf Anna.
In diesem Moment biß ihn die erste Wanze. Das heißt, zunächst kam der Buchverkäufer gar nicht darauf, daß es eine Wanze war. Er rieb sich die Schulter; der Gasherd verbreitete eine angenehme Wärme, Ed hatte sich nackt hingelegt und bloß seinen Slip (aus Baumwolle, mit kleinen Blumen) anbehalten. Als die zweite ihn biß, zweifelte Ed schon nicht mehr daran, daß die dreckigen kleinen Biester den Diwan bevölkerten. Aber er machte kein Licht, um den Feind aufzuspüren, sondern begnügte sich damit, sich zu kratzen, um Mirkin nicht aufzuwecken, der in der anderen Ecke schlief; da sie beide »ungepaart« waren, hatte man sie im gleichen Zimmer untergebracht.
Schließlich war es trotzdem nötig, Licht zu machen, in zehn Minuten war der Körper des Buchverkäufers an die hundert Mal gebissen worden. Mirkin wurde mißmutig wach, und Ed forderte ihn auf, sich den Diwan anzusehen. Er entfernte die Polster vom Holzgestell, und da sah man die Wanzenkohorten an den Löchern zu ihren Nestern zwischen den Latten des Gestells zusammenkleben. »Du arschgefickter Hurenbock«, schrie der nackte Mirkin und holte ihren Gastgeber. »Ich hatte dir doch gesagt, Harris, nimm diese Sauerei von einem Diwan nicht mit, der ist bestimmt voller Dreck! Und du hast ihn mitgenommen, Idiot! Jetzt schau dir das an!« Harris setzte sein eisernes Brillengestell auf seine lange Nase und verzog das Gesicht vor Ekel. Dann warfen sie sich Mäntel über die nackten Körper, nahmen das Gestell und die Polster, stiegen die drei Stufen zur Haustür hinab, trugen den verwünschten Diwan in die Nacht hinaus und warfen ihn neben einen Laternenmast. Es regnete und war noch glatter geworden. »Auf daß ihr alle erfriert und ertrinkt!« wünschte Harris den Wanzen zum Abschied.
Ed verzog sich wieder in die Küche und wickelte sich nach der Methode Mirkins in die Mäntel, die übrig waren, aber es gelang ihm nicht einzuschlafen, und um drei Uhr morgens verließ er, nachdem er sich lautlos angezogen hatte, Harris' Wohnung. Am schlimmsten war der erste Kilometer durch freies Gelände. Der Wind brachte ihn Dutzende Male zu Fall, und ab und zu flogen von irgendwelchen halbfertigen Gebäuden losgerissene Holz- und Metallteile an ihm vorbei. Eine winterliche Windhose wütete über dem Stadtrand von Charkow. Eine mächtige Schicht warmer Luft aus Afrika war, hoch am Himmel über der Ukraine, auf eine mächtige Schicht kalter Luft aus Grönland gestoßen, und die wenigen Irren, die aufgrund ihres unausgeglichenen Temperaments in dieser Nacht auf den Charkower Straßen unterwegs waren, mußten bitter leiden.
32
Lange war der Buchverkäufer gegangen, bis ihn sein topographischer Riecher direkt zur Hauptverkehrsstraße, zur Sumskaja — etwas unterhalb des Dserschinskij-Platzes —, geführt hatte. Eine weitere halbe Stunde brauchte er, um zum Tewelew-Platz zu gelangen und sich unter Annas Fenster einzufinden, aus dem das warme, im Regen verschwimmende Licht ihrer Nachttischlampe drang. Ed wußte, daß die Lampe auf der Truhe vor dem Fenster stand und daß die Vierzigwattbirne von einem Lampenschirm bedeckt wurde, der wie ein chinesischer Sonnenschirm bemalt war.
»Anna!« Das erste »Anna« verlor sich in Regen, Wind und Finsternis und klang furchtsam. Niemand erschien in dem hohen, alten Fenster des Straßenbahn-Zimmers. Ed erinnerte sich daran, daß Zilja Jakowlewna zwei Fenster weiter schlief, formte seine Handteller zu einem Schalltrichter und versuchte einen weiteren, gut gezielten Schrei. »An-na!« Er wartete. Im Lieht der Straßenlaterne über dem Taxi-Halteplatz (kein einziger Wagen stand da) konnte man sehen, daß der Schnee dicht wie eine Mauer fiel. Eds dicker Ratinémantel (danke, Michail Kopissarow!) war seinen Preis wert. Die Nässe drang bloß durch die erste der beiden flauschigen Stoffschichten, seine Schultern und seine Brust blieben trocken. Nicht so seine Füße, an denen er amerikanische Armeestiefel trug und die in Pfützen kalten Wassers badeten. »Annnnnaaaa!« schrie der Buchverkäufer. Annas Schatten, der sich den Morgenrock über der Brust zurechtzog, erschien hinter der Scheibe. Sie schaute auf die Straße hinunter, verschwand für einen Augenblick wieder im Zimmer und öffnete danach erst das Fenster.
»Kann ich raufkommen?« — Der Buchverkäufer hatte den Kopf erhoben, und der Regen peitschte ihm gnadenlos ins nasse Gesicht.
»Geh nach Hause, Ed«, sagte Anna leise und schaute hinter sich ins Zimmer.
»Ich weiß, daß Kuligin da ist. Kuligin ist bei dir und ihr vögelt!« brüllte er wie von der Richterbank herunter.
»Ja, Kuligin ist da, und was ist daran schlimm, Ed?«
»Ich komm rauf!« sagte er drohend und tat so, als wollte er um die Ecke zum Hauseingang gehen.
»Mach keinen Unsinn, Ed, du weckst das ganze Haus auf. Ich würde dich rauflassen, aber ich habe keinen Platz, wo du schlafen kannst. Ich schlafe in meinem Bett und Tolik auf dem Fußboden…«
»Ihr schlaft zusammen!« Der Buchverkäufer war damals noch fest davon überzeugt, daß ein Mann und eine Frau, die sich nachts unter dem gleichen Dach befinden, gar nicht anders können, als sich zu paaren oder wenigstens zusammen im gleichen Bett zu liegen. »Dieser Gesichtspunkt ist gewiß barbarisch, aber exakt« — so können wir diesen jugendlichen Irrtum mit einem Zitat des bedeutenden Dichters Brodskij kommentieren.
Wenn der Buchverkäufer betrunkener gewesen wäre, hätte er einen Skandal gemacht. Schon so, in seinem gegenwärtigen Zustand, hätte er einen Skandal gemacht, geschrien und an die Tür geklopft, wenn diese sich direkt am Treppenflur, in bequemer Reichweite, befunden hätte. Aber leider war, nach dem Hauseingang und der Treppe, die einem das Herz zerriß, noch die Wohnungstür, die in den Gemeinschaftsflur führte, zu überwinden. Und dahinter, wie wir bereits wissen, noch zwei weitere Türen! Zuviele fremde Leute hätten seine durchnäßte und schmerzverzogene Fresse sehen können, bevor es ihm möglich gewesen wäre, Anna Rubinstein eine reinzuhauen. »Die Nutte von der Sumskaja.« Er erinnerte sich an die verletzende Bemerkung Tolik Tolmatschows, dem er vor kurzem in der Straßenbahn begegnet war, als Tolik gerade aus dem Gefängnis kam. »Man sagt, daß du mit der Nutte von der Sumskaja zusammenlebst?« Ein erster Goldzahn hatte in Toliks Mund geblitzt.
»Du Nutte von der Sumskaja!« schrie der Buchverkäufer zu Anna hoch und ging. Er ging langsam. Zerrissen von diesem heftigen morgendlichen Dialog.
*
›Was bist du doch für ein verdammtes Arschloch, Ed.‹ Der Gefährte Mischa Kopissarows, der Pseudo-Stahlgießer und Typ aus Saltow, Ed, grinste boshaft und betrachtete die durchnäßte Figur in dem großen Mantel verächtlich. ›Du hast sie alleingelassen, die beiden. Du bist gegangen, und sie vögeln weiter. Du Klugscheißer!‹
›Und was hätte ich tun sollen? Hm? Die fünfzig Nachbarn vorne, dann die drei Familien hinten und noch Annas Mama wecken? Außerdem weiß ich nicht, ob mich die Nachbarn in den Flur reingelassen hätten, an der Tür ist eine Kette, das heißt, es ist überhaupt nicht sicher, daß ich ihr in ihre kleine unverschämte Fresse hätte schlagen können. Einen Skandal machen, nur um auf der Wache zu landen?‹
›Du hättest dich von Anfang an nicht in eine solch idiotische Situation bringen sollen. Warum vögelst du sie nicht, warum sitzt du ständig nur still neben diesem phänomenalen Hintern, statt sie zu vögeln?‹
›Sachte, sachte. Hör auf mit deinen Schweinereien. Ich weiß nicht, warum ich noch nicht mit ihr geschlafen habe.‹
›Du lügst. Man weiß immer alles über sich selbst, man hat bloß Angst davor, sich die Wahrheit einzugestehen. Also, du weißt es ganz genau.‹
›Na gut, ich habe Angst. Ja.‹
›Wovor?‹
›Ich habe Angst, bei ihr keinen hochzukriegen, ich habe Angst, impotent zu sein, ich habe Angst, mir zu verderben, was da ist, und ich habe Angst davor, daß sie mich dann rauswirft. Ich brauche sie, ihre Umgebung. Wo fände ich sonst noch solche Leute? In Charkow jedenfalls nicht. Am besten, es bleibt alles, wie es ist…‹
Das grüne Tor des historischen Museums hatte den Ed aus der Vergangenheit und den aus der Gegenwart von ihrem Dialog abgelenkt. Der Buchverkäufer preßte sich an das Gitter und schaute in den Hof hinein. Zwei Panzer glänzten im Regen: ein britischer aus der Zeit des Bürgerkriegs — Denikin war mit diesen Panzern gegen Charkow vorgerückt — und ein deutscher Panzer, eine Trophäe aus dem letzten Krieg. Rechts waren ein paar Fenster im Priesterhaus erleuchtet. Jedenfalls behauptete Anna, daß in diesem Gebäude im Hof des historischen Museums Popen mit ihren Frauen lebten. Die Popen in langen Unterhosen und ihre Frauen in langen Nachthemden sitzen vielleicht gerade in der Küche und trinken Tee, dachte Ed. Vielleicht sind sie gerade aufgestanden, weil die Popen zur Arbeit müssen. Links zeichnete sich im regnerischen Himmel der Glockenturm ab, der zur Residenz des Metropoliten gehörte. Der Glockenturm, die Residenz und die Kirche des Metropoliten waren vom Hof des Museums durch eine Mauer getrennt. Eine niedrige Laterne beleuchtete die rissige Hanke des Turms. Ein großer Teil des Turms war allerdings von einem hölzernen Baugerüst umgeben — dieses Denkmal aus dem siebzehnten Jahrhundert wurde gerade restauriert. Der Buchverkäufer berührte die Pforte im grünen Tor, sie war nicht verschlossen. Er ging einen aufgeweichten Sandweg entlang — seine amerikanischen Stiefel versanken darin wie in geschmolzener Schokolade — und setzte sich, mit dem Rücken an den englischen Panzer gelehnt, auf einen Sockel. Der Panzer war gelb wie die britischen Militärmäntel aus dieser Zeit.
Es stürmte so heftig, daß es dem Wind sogar gelang, eine Handvoll durchnäßten Sand vom Weg loszureißen und gegen das Haus der Popen zu schleudern. Zänngg, zänngg! antworteten die Fensterscheiben. Der Buchverkäufer meinte, in einem der dunklen Fenster im Erdgeschoß ein weißes Gesicht zu sehen. Die Popen haben es gut getroffen, dachte er, so hoch auf dem Hügel, nahe bei Gott und der Geschichte, oberhalb der Charkow, da, wo der Legende zufolge die Stadt von dem freien Kosaken und Banditen Charj gegründet worden war. Interessant. Vielleicht sitzt Gott mit Wrubelflügeln, als allmächtiger Jüngling, da oben auf dem Glockenturm? Oder vielleicht, wie ein großer Vogel, unter der Kuppel der Mariä-Verkündigungs-Kathedrale am gegenüberhegenden Ufer des Flusses? Gott existiert nicht, das ist offenkundig, es gibt die Wissenschaft, es gibt den Anfang aller Anfänge. An einen fremden Christus zu glauben, der im Nahen Osten geboren worden ist, das ist Unsinn. Obschon Melechow behauptet, es gebe immer mehr Gelehrte, die Darwin und seine Theorie über den Ursprung der Arten in Zweifel ziehen und die, auch wenn sie nicht an Gott glauben, doch nicht bestreiten, daß die Welt auf einen Schlag erschaffen worden sein könnte. Bloß von wem? Der Buchverkäufer veränderte seine Stellung und schaute vorsichtig am Glockenturm, der sich im Himmel verlor, nach oben. Und wenn es Ihn doch gibt? Und ich sitze hier und behaupte, daß es Ihn nicht gibt? Wenn es Ihn gibt, gefällt es Ihm vielleicht nicht, daß ich denke, daß es Ihn nicht gibt? Aber überwacht Er denn andererseits ständig die Gedanken eines Jeden, jede Sekunde? Wenn dem so ist, dann wäre Gott ja so etwas wie ein phantastischer Super-KGB, der die Gedanken überwacht. Was für Mühe Ihm das wohl macht… Wenn es Ihn gibt, dann kann man Ihn auch um etwas bitten. Aber worum Ihn bitten? Um alles, um… Der Buchverkäufer verstand, daß er hier auf seinem Sockel, mit dem Rücken an den nietenbeschlagenen »Panther« gelehnt, Gott besser um nichts bitten sollte. Er verstand, daß er aufstehen, über den Zaun klettern, den Glockenturm betreten und nach oben steigen mußte; bloß da, oberhalb der Stadt, konnte er von Gott erbitten, was er wollte. Da oben hätte seine Bitte mehr Gewicht. In seinem ganzen Leben hatte Ed noch nie ein Gotteshaus betreten. Vielleicht würde Gott, wenn es Ihn gab, dem Gebet eines Frischbekehrten mehr Aufmerksamkeit schenken? Wer noch nie an einem Glücksspiel teilgenommen hat, soll beim ersten Mal ja immer gewinnen…
Er stand auf und ging zur Mauer hinüber, wobei er am ganzen Körper spürte, wie der Sturm zunahm und im Hof und am Himmel immer beängstigender tobte. Mehrmals stießen ihn Wasser und Wind hin und her, langte ihm die bestialische Pranke der Natur ins Gesicht. Wenn du dich nur für kurze Augenblicke in der Natur aufhältst, nimmst du sie gar nicht wahr. Wenn du aber gezwungen bist, eine ganze Nacht draußen zu verbringen, und das Wetter schlecht ist, dann erst merkst du, daß es nur die Natur gibt; die schwächlichen Menschen haben sich wie die Wanzen in Harris' Diwan versteckt. Auch wenn die Stadt sie unterworfen hat, knurrt die Natur vor den Schwellen zu unseren Türen, dachte unser Held, als er sich von einem Baum auf die hohe, feuchte und schmutzige Mauer schwang. Wenn es plötzlich keinen Strom mehr gäbe, wenn er nicht mehr durch die Leitungen flösse, dann wäre die Stadt innerhalb weniger Monate vernichtet. Nein, das würde nicht reichen, daß es keinen Strom mehr gäbe. Wenn auch das Gas verschwände, dann würde die Natur wie ein großes, wildes, schwarzes Tier, wie ein gigantischer Hund von Baskerville mit den Ausmaßen der Mariä-Verkündigungs-Kathedrale, der Stadt an die Gurgel springen und die Bevölkerung verschlingen, die schwächlich und verzärtelt in den vier Wänden ihrer Gemeinschaftswohnungen hockt und Speck angesetzt hat von all den fetten Fleisch- und Kartoffel- Gerichten.
Er fiel auf der anderen Seite der Mauer herunter und blieb in einer eiskalten Pfütze hegen, bis er wieder zu sich kam. Der junge Mann war so sehr in seine Gedanken versunken, so gefesselt von dem Zusammenstoß mit der sogar in Charkow, einer Stadt mit einer Millionenbevölkerung, ungezähmten Natur, daß er auf seinen Körper kaum achtete. Es ist kalt, dachte er nur, und stand wieder auf. Die Tür zum Glockenturm, die genau wie der Panzer mit Nieten beschlagen war, war verschlossen. Sie gab seinen Stößen mit der Schulter auch nicht einen Millimeter nach. Sicher kam man auch über die Kirche des Metropoliten, die sich im Dunkeln verbarg, in den Turm. Wenn aber schon der Zugang zum Glockenturm durch diese mit Spitzen gespickte Panzertür so achtunggebietend versperrt war, dann konnte man sich leicht vorstellen, wie erst der Eingang zur Kirche verbarrikadiert sein würde! Und so kletterte er über die durchnäßten Bretter des Gerüsts, die sich unter seinen amerikanischen Stiefeln bogen, in den Himmel hinauf, wobei er sich so nah wie möglich am Turmkörper hielt. Der Himmel stürzte sich, zur Turmspitze hin immer heftiger, in Böen auf seinen Mantel und attackierte ihn, unbeeindruckt von seinen Mißerfolgen, immer wieder aufs neue. Der junge Mann sah in den methodischen Versuchen des Himmels, ihn vom Gerüst zu reißen, keine Bosheit, sondern eine beharrliche Gleichgültigkeit. ›Wenn es klappt, umso besser, wenn es mißlingt, dann sollte es eben nicht sein.‹ Weder zählte er die bereits bezwungenen Plattformen noch die wackligen Stufen dazwischen. Zu jener Zeit wurden solche Gerüste an Ort und Stelle aus Ausschußbrettern recht und schlecht zusammengezimmert; und obschon das eigentlich stabil genug sein mußte, um das Gewicht einer ganzen Mannschaft von Restaurateuren, von Werkzeugen und Baumaterialien auszuhalten, wakkelte, ächzte und schwankte es wie alle provisorischen Bauten, allein schon unter dem Gewicht des Buchverkäufers. Da, wo die verglasten Fenster endeten und wo schwarze Löcher sich in das Fleisch des Kirchturms bohrten, die ihn an das schwarze Loch hinter dem Ohr von Igor Jossifowitsch Kowaltschuk erinnerten (Folge einer Schußverletzung, behauptete Igor; in Wirklichkeit aber, wie sich später herausstellte, Folge einer banalen Operation), da begriff er, daß er zum Teufel hinaufkletterte. Plötzlich krachte, für diese Jahreszeit ungewöhnlich, ein heftiger Donnerschlag, und auf der Seite der Mariä-Verkündigungs-Kathedrale riß der Himmel auf. Riß auf zu einem trägen Spalt von blau-violetter, bleicher Färbung, der noch lange am Himmel zu sehen war. Gleichzeitig wurde es heller, und die stechenden Regenböen, die der Himmel zuvor auf unseren Helden hatte niederprasseln lassen und die ihn wie mit Nägeln gespickte Bretter getroffen hatten, verwandelten sich in einen sanfteren und gleichmäßigen Regenschauer, der aus der ganzen Breite des Himmels strömte. Und wieder spaltete ein träger, blau-violetter Riß die Wolkendecke. Solche Risse gab es auch in Zilja Jakowlewnas Lieblingstellern aus Porzellan; diese Teller stammten noch aus der Zeit der Zaren. Er kniete sich hin, er wußte, daß es sich so gehörte, wenn man betete, und kehrte dem Glockenturm und seinen Löchern den Rücken zu; mit den Stiefelspitzen verankerte er sich in einem der Löcher und beugte sich so weit nach vorn, daß er mit der Stirn die durchnäßten, nach feuchtem Gips stinkenden Bretter berührte.
»Herr, oder Wer immer da oben ist…«, begann er — und unterbrach sich, um zu überlegen, worum er ihn bitten sollte. »Sorge dafür, daß… daß mein Schicksal außergewöhnlich ist. Daß es« — er zögerte — »wie in den Büchern ist! Daß ich immer gewinne, daß ich ein… HELD sein werde…« Es kam ihm so vor, als bewegte jemand in den nahen Regenwolken schnalzend und schmatzend seine riesigen Lippen. Der Buchverkäufer fühlte sich unbehaglich, er spürte: Allein auf weiter Flur jemand anderem, und sei es auch nur dem Himmel, von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, war schrecklich. Jene Phänomene, die der Volksmund mit »Gänsehaut« und »Ihm stehen die Haare zu Berge« umschreibt, überkamen ihn, und er gelangte zu dem Schluß: Nein, dort gab es keinen Gott. Wenn es ihn gäbe, dann würde er sich jetzt wohlfühlen und hätte keine Angst. Es war der Teufel, der da mit den Lippen schnalzte und in den Wolken lachte, genau, er war es!
Aber du bist etwas Besonderes! sagte er zu sich (oder sagte es jemand anders zu ihm?). Wenn du etwas Besonderes bist, dann soll auch dein Schicksal so sein. Wozu brauchst du einen Gott aus dem Nahen Osten, er beschützt die Krüppel; du schließ einen Pakt mit dem Teufel. Einverstanden? fragte er sich (oder jemand anders oben aus den Wolken ihn). Sei du schlimmer noch als alle anderen.
›Das ist Schwachsinn, dummes Gewäsch!‹ wandte an dieser Stelle der Kriminelle aus Saltow und Gießereiarbeiter aufgebracht ein, der mit einem überraschend gesunden Menschenverstand die religiösen Fragen anging. ›Das ist der Sturm, sonst nichts. Nicht die geringste übernatürliche Kraft dahinter. Kletter wieder runter und geh nach Hause!‹
»Eure Eminenz, allmächtiger Teufel«, begann Ed begeistert und überhörte die Stimme des Saltower Provinzlers. »Sie sind dem Doktor Faust oder seinem Schöpfer erschienen. Sie haben einen Pakt mit Melmoth und anderen Tapferen unterzeichnet… Auch ich bin tapfer. Helfen Sie mir. Schaffen Sie mir Kuhgin aus dem Weg. Bringen Sie ihn woandershin. Soll er doch mit roter Tinte Anna talentvolle Briefe schreiben, wie er es früher vom Neuland aus gemacht hat. Schicken Sie ihn wieder ins Neuland zurück, ja? Putzen Sie ihn weg, da sage ich nicht nein, ich möchte mit Anna Zusammensein, ich brauche sie. Machen Sie das, ja? Das ist das Minimalprogramm. Und das Maximalprogramm, Euer Ehren, ist, mir dabei zu helfen, immer außergewöhnlich, immer ein Held zu sein. Einsam auf einem Felsen wie Melmoth die Mißgeschicke der Menschheit mit einem kleinen Grinsen zu betrachten…«
Der Leser, der das Gefühl der Ekstase niemals am eigenen Leib erfahren hat, wird diese komische und zugleich anmaßende Szene auf dem Glockenturm nicht verstehen. Die klassische Romantik, die zu jener Zeit allein die Vorstellungskraft unseres Helden beflügelte, mag etwas altmodisch erscheinen. Aber auf das Vorbild kommt es nicht an; wenn der Schauspieler es versteht, wahrhaftig und temperamentvoll zu spielen, wird er das Publikum in jedem Fall zu Tränen zu rühren. In unserer Geschichte war der Buchverkäufer das Publikum. Er war im Himmel von Charkow in lautes Schluchzen ausgebrochen und hatte lange und heftig geweint. Von Zeit zu Zeit hatte er versucht, ein Zeichen am Himmel zu entdecken. Vom Sturm abgesehen, ereignete sich dort jedoch nichts Besonderes, so sehr er sich auch anstrengte, die Aufmerksamkeit Seiner Majestät Luzifer auf sich zu lenken. Als der Weinkrampf nachließ, hatte er sich gefragt: Vielleicht reicht es jetzt mit dem Heulen? Vielleicht sollte ich wieder runterklettern und nach Hause schlafen gehen? Aber es war ihm so vorgekommen, als wäre es noch zu früh, die Szene zu beenden, er hatte deshalb noch in aller gebührenden Form dem Teufel für den Fall, daß er ihm helfen würde, seine Seele versprochen und war erst danach tränenüberströmt wieder hinuntergeklettert.
Er hatte sich in den Hof des historischen Museums fallen lassen; ein kleiner bissiger Hund, der gerade aufgewacht war, hatte ihn dort verbellt, während er einen wahrhaftigen Popen in Soutane, mit irgend etwas Weißem auf dem Kopf und einer Aktentasche in der Hand, beobachtete, wie er die Treppe vor dem Haus hinunterkam. Der Pope hatte, während er an ihm vorbeiging, ein Zeichen gemacht und mit tonloser Morgenstimme gesagt: »Der Herr schütze dich, mein Sohn!« Dann hatte der Priester, wie eine Frau, seinen Rock hochgehoben und war in das dunkle Auto gestiegen, das auf ihn wartete. Ed war hinter dem Auto, das langsam die Panzer umkurvte, durch das grüne Tor hinausgegangen. Leute, die schon am frühen Morgen zur Arbeit mußten, liefen noch halb schlafend und trotzdem eilig durch die Straßen.
33
Er war schon einmal in Aluschta gewesen. Im Verlauf eines ihrer ›Überfälle‹ auf den Süden hatten Ed und der Kater Bondarenko 1961 dort ein paar Tage verbracht.
Wie ein Privatdetektiv nahm Ed sich methodisch alle Sanatorien vor und fragte die Leute danach, ob bei ihnen nicht ein Kurgast namens Anna Moissejewna Rubinstein untergebracht sei. Er durchstreifte das Stadtzentrum, lief die Strände ab und erkannte sogar den Kiosk wieder, unter dessen Dach er und der Kater eine Nacht verbracht hatten. Das Dach war, wie vor vier Jahren, mit einer dichten und immergrünen Flora bedeckt. Ed verfinsterte sich beim Gedanken an seinen in Kolyma eingesperrten Freund und lenkte seine Schritte in ein Etablissement, das schlicht und lakonisch »Wein« hieß. In der Bar mit den modernen, großen und zur Mitte hin beschlagenen Fenstern spielte ein Musikautomat eine Platte; einheimische Männer und Kurgäste, ihre Gläser mit Porto in der Hand, verteilten sich im Raum. Es gab nur wenig Einheimische, und trotz der beachtlichen Zahl von Kurgästen wirkte das Etablissement »Wein« nicht überfüllt, sondern verströmte die angenehme und lebhafte Atmosphäre, die man aus existentialistischen Filmen kennt. Ed bestellte ein Glas Porto und schaute auf das Meer und den graugelben Strand hinaus, während er seinen Wein trank. Tiefhängende Wolken zogen über das Meer, es drohte zu regnen.
In einer Ecke des Saales stand ein mit kleinen Spielsachen geschmückter Weihnachtsbaum, und eine der Kellnerinnen, eine unansehnliche, nicht mehr junge Frau mit stillem Gesicht, ging plötzlich hinter die Theke und knipste die Tannenlichter an. Für einen Moment betrachteten alle Anwesenden den Baum, der stolz mal in der einen, mal in der anderen Farbe leuchtete. Die Leute stießen miteinander an, und ein besoffener Kerl in einem grünen Regenmantel drückte sich an die Kellnerin Numero Zwei, die ihm scherzhaft einen Klaps mit dem nassen Wischlappen versetzte, den sie in der Hand hielt. Ed wandte sich wieder dem Meer zu und dachte daran, daß der Kater erst wenig mehr als zwei Jahre abgesessen hatte und daß er also noch zehn Jahre brummen mußte. Was für eine Riesenscheiße, zehn Jahre! Eine Ewigkeit! Er versuchte, sich vorzustellen, was in diesen zehn Jahren mit ihm selbst geschehen könnte, aber er kam über die Suche nach Anna in Aluschta nicht hinaus. Warm angezogene Kurgäste, deren Pulloverkragen aus den Mänteln ragten, gingen in Gruppen auf dem einsamen Strand spazieren. ›Im Winter baden kann man im Süden natürlich nicht, aber man fühlt sich großartige dachte Ed. Es wäre schön, immer am Meer zu leben, wenn es so wäre wie jetzt, wenn wenig Menschen auf den Straßen wären und eine Musiktruhe spielte… Sollte er Anna denn wirklich nicht finden? Er mußte! Und wenn Wikslertschik ihn belogen hatte und Anna nicht in Aluschta, sondern in Jalta war? Es blieben nur drei Sanatorien übrig, die außerhalb der Stadt auf den ersten Ausläufern der Berge lagen, die sich am Meer entlang erstreckten. Er trank noch ein Glas Porto und ging los, er orientierte sich an dem Plan, den er beim Kiosk an der Bushaltestelle gekauft hatte.
Im letzten der drei Sanatorien sagte man dem jungen Werther, ja, es gebe dort durchaus einen Kurgast namens Anna Rubinstein. »Eine schöne Dame mit grauen Haaren?« fragte die Frau an der Rezeption, nachdem sie die Liste der Kurgäste durchgesehen hatte; ihre Haut war erstaunlich weiß für eine so bejahrte Eingeborene aus dem Süden. Ed identifizierte sie als Oberschwester. In den sowjetischen Institutionen dieser Art betrachtete man die Kurgäste als Kranke, man wog sie, man nahm ihnen Blut ab, machte Röntgenaufnahmen und verordnete Therapien. Zumindest gab man ihnen Lebertran. Ob man Anna auch Lebertran gibt? fragte sich der junge Romantiker.
»Sie sind ein Verwandter? Ihr Sohn?« mutmaßte die neugierige Eingeborene. »Ihr Bruder!« antwortete der Buchverkäufer herausfordernd und ging zu dem Gebäude, das man ihm genannt hatte, um dort das Zimmer zu suchen, dessen Nummer man ihm ebenfalls gegeben hatte. Mit seinem unverwüstlichen Mantel aus schwarzem Ratine, seiner georgischen Mütze, die so flach wie eine Landebahn war, seiner schwarzen »Winterhose« (flanellgefüttert und natürlich von ihm selbst genäht), seiner (schwarzen) Weste, die der Leser bereits kennt, und einer kurzen, in den Schultern breiten Jacke aus dem gleichen Stoff, sah der Bruder aus wie ein Mönch. Bloß die Linie seines weißen Hemdkragens hellte seinen mönchischen Habit (andere mögliche Varianten: spanischer Grande oder sizilianischer Bandit) etwas auf.
Im betreffenden Gebäude stieg er die Treppe hoch und legte sich auf dem Weg zu Annas Tür den ersten Satz zurecht. Nachdem er eine ganze Serie von fröhlichen und dämlichen Ausrufen verworfen hatte, weil sie ihm zu lässig oder zu affektiert vorgekommen waren, entschied er sich für ein »Guten Tag, Anna«, nach dem er dann schlicht und männlich lächeln würde.
Aber nicht Anna öffnete ihm, sondern eine große und schöne Frau mit einem großen, schweren Gesicht. Sie trug einen Morgenrock aus Chinaseide mit Vögeln aus Gold darauf. Der junge Werther sah wohl ziemlich dumm drein, womöglich stand ihm sein Mund offen, denn die Frau lächelte, ihr strenges Gesicht wurde weich, und sie fragte ihn: »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
»Bitte verzeihen Sie mir«, antwortete der junge Mann. »Ich habe mich bestimmt in der Tür geirrt. Ich suche Anna Rubinstein.«
»Dann haben Sie sich nicht getäuscht.« — Die schwarzen Haare der Frau waren naß, vielleicht hatte sie sie gerade gewaschen. »Anna Rubinstein wohnt hier.«
»Erlauben Sie?…« sagte Werther.
»Nein«, antwortete die Frau scharf, und dann lachte sie. »Anna ist nicht da. Soweit ich mich erinnere, ist sie heute morgen ganz früh zu einem Ausflug in eine Wein-Sowchose aufgebrochen.«
»Danke.« Der Buchverkäufer drehte sich um, um zu gehen.
»Soll ich ihr irgend etwas ausrichten?« Die Frau hatte die Tür noch nicht geschlossen und wartete. Interessierte sie sich womöglich für den unverhofft erschienenen jungen Mönch? So einen sah man in den Straßen der sowjetischen Städte damals nicht gerade häufig. Mit seiner Blässe und seinem poetischen Aussehen, das er sich in den letzten vier Monaten zugelegt hatte (der Portier vom »Automaten« nannte ihn nie anders als »Dichter«, obschon unser Held zu dieser Zeit gar keine Gedichte schrieb, er hatte vorher welche geschrieben und würde erst später wieder welche schreiben), konnte unser junger Mann durchaus das Interesse der schönen Leningraderin Margarita geweckt haben. Ihre ein wenig düstere Schönheit beeindruckte ihn. In Saltow, fiel dem Buchverkäufer ein, sang man über solche Frauen:
Ah, was für ein Drama
Pique-Dame
Zersprengt haben Sie mein Leben…
Sie mußte über Dreißig sein. So eine konnte ohne weiteres ein Leben zersprengen.
»Sagen Sie Anna bitte, daß ihr Bruder nach ihr gesucht habe«, bat er die Pique-Dame und entfernte sich über den kirschfarbenen Teppich. Zuallererst das Gelände erkunden, schrieb das Handbuch der Topographie seines Vaters vor, das er in seiner Kindheit freiwillig auswendig gelernt hatte. Also erkundete er das Gelände, machte alle Zugänge zum Sanatorium aus, untersuchte die Höhen, die das Gelände überragten, als ob er die Absicht hätte, dort Maschinengewehre aufzustellen (das alte Handbuch seines Vaters empfahl diese extremen Maßnahmen), und bezog schließlich auf der geeignetsten Höhe seinen Beobachtungsposten unter einem immergrünen Baum aus der Familie der Nadelhölzer. Ob das womöglich eine Andentanne ist? überlegte unser Held, der ehemalige Trapper und Naturforscher. Die Rinde des Baums war unnatürlich rot und strömte diesen starken, herben Geruch aus, der für die südliche Vegetation charakteristisch ist. Steine und Anhäufungen kleiner Felsbrocken verbargen unseren Helden, es war unmöglich, ihn von der Straße aus zu sehen. Wenn man ihn danach gefragt hätte, warum er sich für diese Stellung entschieden hatte, die es ihm nicht nur erlaubte, die Straße zum Sanatorium zu beobachten, sondern die ihn gleichzeitig unsichtbar machte, hätte er zweifellos nicht zu antworten gewußt. Er hätte irgend etwas gestottert wie: »Ach, ich weiß nicht…« Wir aber, als unparteiische Beobachter, könnten, wenn wir wollten, in der Wahl dieses Überwachungsplatzes zwischen den gelblichen Felsbrocken die Keimzelle zu einer Paranoia erkennen, die das Leben unseres Helden später komplizierter machte, als er es sich gewünscht hätte. Er versteckte sich so gut, als hätte er gerade eben einen Tyrannen ermordet, sich dann in die Berge geflüchtet, und als hätte er nun die Miliz, die Hubschrauber und die Denunziationen der Bergsteiger und Schäfer zu fürchten, denen er begegnet war. Dabei hockte er doch nur irgendwo in der näheren Umgebung von Aluschta, etwa hundert Meter vom Eingang zum »Sanatorium des Druck- und Verlagswesens« entfernt. Die Verdächtigungen, er sei paranoid, werden jedoch in dem Moment hinfällig, da man die Hypothese aufstellt, daß die jungen Menschen sich, genau wie die jungen Tiere, natürlicherweise spielerisch verhalten. So wie das Kätzchen, das ja keineswegs schwachsinnig ist, genau weiß, daß das Papier oder das Stück Stoff, das man an eine Schnur gebunden hat, keine richtige Maus ist, und trotzdem mit freudig aufgerichtetem Schwanz weiter dem Papier hinterherjagt, so saß auch unser junges Männchen in den Felsen und versteckte bei jedem Wagen, der das Asphaltband der Straße hinauf- oder hinabfuhr, seinen Kopf zwischen den Steinen.
Nach einigen Stunden des Ausschauhaltens hatte sich der Tag bereits gefährlich dem Abend genähert, und finstere Gedanken ballten sich zuhauf unter dem Baum, an dessen rotem Stamm unser Held lehnte. Wo ist sie? Hat sie vielleicht einen Mann kennengelernt und schläft gerade mit ihm? Anna fällt es nicht schwer, einen Mann zu finden, sie braucht bloß einen ihrer koketten Bücke zu werfen, und schon… Wozu bin ich überhaupt hergekommen? Anna hat mir verheimlicht, daß sie wegfährt, sie wollte nicht, daß ich weiß, wo sie ist. Sie wird einen Wutanfall bekommen, wenn sie mich sieht… Aber wo ist sie?
An der Bergstraße waren etwas zu früh die ersten Laternen angegangen, und das weiße Sanatorium zwischen den gelblichen Felsen unter dem blauen Himmel wurde plötzlich einem Bild von Magritte ähnlich.
Er war sehr hungrig. Ein weniger manischer junger Mann hätte sich verdrückt, um in einer Gaststätte essen zu gehen, oder schlimmer noch: wäre Butterbrote und Bier kaufen gegangen und hätte danach gemütlicher auf der Lauer gelegen oder gewartet. Unser Held aber ist gerade dadurch so interessant, weil er seine verworrenen Ziele mit einem außerordentlichen Extremismus und allen dazugehörigen Exzessen verfolgt. Ein anderer wäre nach der ersten Bekanntschaft mit Anna schon am selben oder am folgenden Abend mit Geschick und Mut zum Koitus gelangt, hätte Anna bezwungen… — und sie hätte ihn in der nächsten Woche vergessen. Und auch diese komischen Mißverständnisse, diese halbverlogenen Bittgesuche an den Teufel, vom Glockenturm aus, hätte es dann nicht gegeben, und nicht diese Reisen durch die Städte der UdSSR. Alles wäre so einfach und langweilig gewesen wie bei den normalen Männchen und Weibchen.
*
Der Bus der Wein-Sowchose kam in dem Moment, wo der Himmel vollkommen schwarz geworden war. Obschon der Bus weder mit einem Bacchus bekränzt noch mit Reben verziert war, begriff Ed sofort, daß er aus der Sowchose kam; die etwas zu aufgedrehten Passagiere, die heraussprangen, ihr Lachen und die Weinflaschen, deren Hälse aus ihren Taschen ragten oder die die Kurgäste in den Händen hielten, verrieten es ihm. Anna war nicht dabei.
34
Anna war erst gekommen, als er gerade beschlossen hatte, seinen Beobachtungsposten zu verlassen und zum Sanatorium zu gehen, um sicherzugehen, daß die jüdische Frau sich nicht etwa unbemerkt an ihm vorbeigeschlichen hatte. Wider Erwarten wurde Anna weder im Auto gebracht (von einem Mann), noch kam sie in einem Taxi (allein). Sie kam langsam die Straße herauf, vorbei an den dunklen, jungen Zypressen und den krummgewachsenen, niedrigen Bäumen einer Art, die Ed nicht kannte und die verästelten Rohrleitungen ähnelten, die man aus dem Inneren eines alten Gebäudes entfernt und wahllos hier und da zwischen den Felsen in den Boden gerammt hat. Er hätte sich am liebsten auf Anna gestürzt, aber seine Seele, die eines Spions, hielt ihn zurück. Er beschloß, sie zu beobachten, kletterte von seinem Beobachtungsposten zur Straße hinab und lief ihr auf der anderen Straßenseite hinterher, wobei er die Felsen und Bäume als Deckung benutzte. Übrigens war es gar nicht nötig, leichtfüßig und geschickt von Versteck zu Versteck zu springen und immer wieder in den Rissen der Finsternis zu verschwinden. Anna lief gedankenverloren unter den Straßenlaternen entlang, ihr grüner Wollmantel war aufgeknöpft, vertrauensvoll und ahnungslos wie die Mehrzahl der Menschenwesen, blickte sie sich nicht um. Von der Seite betrachtet hatte Anna Rubinstein unserem Helden nicht gefallen. Sie wirkte klein, etwas zu massig, wie eine grüne Seifendose, die sich den Hügel hinaufschleppte. Man hörte sie sogar atmen, diese grüne Dose, während sie den Berg bezwang. Allein der schöne Kopf Annas, auf dem sich überraschenderweise ein hoher Knoten türmte, gefiel ihm. Anna mit ihrem Knoten ließ ihn an Iphigenie, Jokaste oder Io aus der griechischen Tragödie denken. Oder an Klytämnestra, die gerade Agamemnon verraten hat. Annas Beine endeten nicht wie üblich in spitzen Stöckelschuhen, sondern in flachen, alkoholikerkackefarbenen Wildlederstiefeln. Deshalb wirkt Anna so klein und rundlich, begriff unser Held. Sie trägt keine Absätze.
Hinter ihr betrat er den Hof des Sanatoriums und folgte ihr, ohne sich sonderlich zu verstecken, in das Gebäude. Eine Angestellte in weißer Bluse saß in der Halle neben der Treppe und las eine Zeitschrift. Anna wechselte mit ihr irgendwelche unverständlichen Sätze, bloß einzelne Laute konnte er verstehen. Als unser Held die Frau vom Service sah, erinnerte er sich daran, daß dieses Gebäude ausschließlich Frauen vorbehalten war, daß er ein Mann war und man ihn um diese Zeit nicht hineinlassen würde. Er wollte gerade nach Anna rufen, die bereits die Treppe hochging, als die Frau unversehens aufstand und in einem Seitengang verschwand. Vielleicht ging sie auf die Toilette. Da sonst niemand in dem hellerleuchteten Eingangsbereich zu sehen war, sprang er, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hoch.
Auf sein Klopfen hin öffnete Anna. Sie hatte schon Zeit gehabt, ihren Mantel über einen Bügel zu hängen und hielt diesen mitsamt Mantel noch in der Hand.
»Du! Oh! Den ganzen Tag habe ich geahnt, daß du kommen würdest. Du bist verrückt!«
Das junge unerfahrene Männchen hatte den Eindruck, daß Anna unzufrieden war, ihn zu sehen. Er umarmte ihren massigen Körper etwa in Höhe ihrer Taille, zog sie an sich und küßte die Frau auf die Lippen. Sie roch stark nach einer Mischung aus Haarspray, anderen lieblichen Parfumeriegerüchen und Schweiß. Ed hatte sie an sich gezogen und geküßt, nicht etwa weil er sie küssen wollte, sondern weil er wußte, daß Küsse Wunder wirken, wenn eine Frau erzürnt ist. Und überhaupt muß ein Mann auch genauso auftreten. Das Bild der grünen Seifendose, die unter seinem kritischen Auge die Bergstraße hinaufschritt, war noch nicht verflogen, weshalb der junge Mann mit dem Kuß versuchte, dieses Wort »Seifendose« aus seinem Bewußtsein zu verbannen.
Anna war aber gar nicht wütend. Zwar brachte die Ankunft des jungen Mannes ihre Pläne für den Urlaub durcheinander, den sie als eine freie Frau hatte verbringen wollen, das heißt, das schmälerte ihre Hoffnungen auf ein paar Badeabenteuer und drohte ihr die Unannehmlichkeiten zu bereiten, die sie schon kannte. Aber wie jede Frau war sie glücklich darüber, daß ein junges Männchen ihr zuliebe etwas Verrücktes tat. Daß er ihr zuliebe gekommen war. Aluschta-Charkow, das sind immerhin gute achthundert Kilometer.
»Wie hast du mich gefunden, Schizo?« Anna trat beiseite, um den Schizo zu betrachten, und da sah der junge Mann das beste an ihr: ihr Gesicht und ihre Augen, und »die Seifendose« verschwand aus seinem Bewußtsein.
»Nach der deduktiven Methode. Und der selektiven Methode. Ich habe mir alle Sanatorien von Aluschta vorgeknöpft.«
»Und Lilja hat dich fahren lassen?«
Hier muß dem Leser erklärt werden, daß die Buchhandlungen von Charkow in den ersten Tagen des neuen Jahres wie verrückt arbeiten, um den Plan des abgelaufenen Jahres noch zu erfüllen. In dieser Zeit die Kollegen im Stich zu lassen, war ebenso schlimm, wie als Soldat das Schlachtfeld zu verlassen, war Desertion. Dennoch waren für Ed damals die Gefühle wichtiger als der Plan und das Kollektiv. Er desertierte, ohne zu zögern, um einer Frau zu folgen.
»Du hast nichts gesagt?« fragte Anna bestürzt. »Lilja wird brüllen und toben.« Anna hängte endlich ihren Mantel in den Schrank. Als sie sich wieder zu dem jungen Mann umdrehte, verklärte ein freudestrahlendes Lächeln ihr Gesicht. Frauen haben einen stark entwickelten Sinn für Konkurrenz, und obschon Anna wußte, daß der junge Mann für die Direktorin nichts übrig hatte, empfand sie doch Befriedigung darüber, daß er mit seiner Desertion dieser machtgierigen Faschistin einen, wenn auch nur kleinen, aber immerhin gezielten Schlag versetzt hatte.
Den jungen Mann hatte der Ausdruck »Brüllen und Toben« abgelenkt, er stellte sich vor, wie Lilja brüllte vor Wut und mit Büchern um sich warf, während die Verhärmte in ihrem abgeschabten Pelz mit ihren weitaufgerissenen grauen Augen entsetzt zusah.
»Gefällt dir meine neue Frisur, Ed?« Anna hatte sich so hingestellt, daß er sie im Profil betrachten konnte, und wandte sich ihm nun wieder zu. »Ich war beim Friseur.«
»Sehr!« Ed log, er war überzeugt, daß man Frauen Komplimente machen mußte. (Später wird sich seine Meinung zu dieser Frage ändern.) In Wirklichkeit erschien ihm Annas Frisur auf diese, seiner Kurzsichtigkeit angemessene Entfernung zu künstlich. Der Friseur hatte mit Haarspray nicht gespart, er hatte Annas Haare ausgetrocknet; ihre Haare waren so steif wie zu sehr gestärkte Spitzen.
»Es gibt heute einen Tanzabend, Ed. Gehen wir hin?«
»Um das Hammelvolk tanzen zu sehen?«
»Ed… Hört ihn euch an, Leute! Schon ist er ein Snob geworden! Letztes Jahr hast du noch in einer Gießerei gearbeitet, Ed!«
»Na und? Im Betrieb habe ich die Hammelherde auch nicht ausstehen können und mich von ihr ferngehalten.«
»Aber du mußtest doch irgendwie mit deinen Arbeitskollegen kommunizieren, Ed, oder?«
»In meiner Brigade hatte jeder seine Arbeit. Wenn ich keine Lust hatte zu reden, konnte ich mich den ganzen Tag auf ein paar Sätze beschränken. Ich habe mich mit Tschurilow befreundet. Boris gehört nicht zum Hammelvolk, wie du weißt.«
»Gut, wie du willst, Ed, aber ich gehe tanzen. Wo bist du untergekommen?«
»Nirgends«, gestand der junge Mann finster.
35
Manchen Angewohnheiten seiner kriminellen Jugend noch immer treu, hatte der junge Mann die Einnahmen seines letzten Arbeitstages mitgenommen. Wie wir bereits erwähnt haben, hatte er aber leider nicht das Talent Igor Jossifowitsch Kowaltschuks, und die Summe war nur sehr bescheiden. Anna hatte fünfzig Rubel nach Aluschta mitgenommen. Arm wie sie war, hatte sie zynisch darauf vertraut, daß die männlichen Kurgäste, an deren Bekanntschaft es ihr ganz sicher nicht mangeln würde, bei abendlichen Unternehmungen für sie bezahlen würden. Es konnte daher keine Rede davon sein, ein Zimmer zu mieten. Nach der Ankündigung des letzten Tanzes (Anna hatte den ganzen Abend mit dickbäuchigen Kurgastkavalieren zwar ungeschickt, aber selig Walzer getanzt, während der kleine Dreckskerl ihr von seinem Standort neben ein paar häßlichen älteren Frauen erbittert mit den Augen gefolgt war) gesellten sie sich zu der großäugigen und ernsten Leningraderin Margarita und erklärten ihr die Situation. Die traurige und einsame Margarita wirkte so schön und so königinnengleich erhaben, daß die Männer sich scheuten, sie zum Tanz aufzufordern; sie zuckte mit den Schultern und sagte mit ihrer dunklen und tiefen Stimme: »Ich verstehe. Es ist schon zu spät. Dein Bruder kann nur bei uns schlafen.«
Der Leser wird sich nun die Lippen lecken und erwarten, daß eine Orgienszene zwischen einem Jungen und zwei schönen Frauen folgt. Aber es ist nicht alles so einfach in dieser Welt, teurer Leser. Die Frauen und der »junge Mönch«, der hinter ihnen hertrabte, verließen den Ballsaal unter den Blikken jeder Menge ungehobelter Kerle. Die groben, aber zögerlichen Männchen tasteten mit ihren begehrlichen Bücken die Hintern der beiden (wie unser Buchverkäufer fand) sinnüchsten Frauen ab, die sich in dem Klub des Sanatoriums befanden. »Wenn du nicht dagewesen wärst, Ed, hätte ich diesem schönen Flieger da den Kopf verdreht!« flüsterte Anna ihrem »Bruder« zu, als sie hinausgingen. Die Aussicht auf die Hindernisse und Unannehmlichkeiten, die durch die Anwesenheit ihres »Bruders« auf sie zukamen, ging ihr allmählich doch auf die Nerven.
Die Nachtwache ließ den Bruder nicht ins Gebäude. »Nach zehn Uhr abends ist Männern der Zutritt verboten!«
»Wo ist denn, bitte, hier ein Mann!« rief Anna wütend; dieser Ausruf, der Margarita ein leichtes Lächeln entlockte, gefiel dem Bruder überhaupt nicht, aber er schwieg.
Die Nachtwache war unerbittlich. »Für Männer verboten.« Der junge Mann mußte so tun, als ob er ginge, und eine weitere Stunde im Kalten zwischen den Bäumen und Felsen herumlungern, der gleichmäßigen Arbeit der Wellen zuhören und darauf warten, daß das Sanatorium Ruhe fand und einschlief. Dann schlich er sich unbemerkt in den Hof und gelangte zu dem Gebäude, wobei unter seinen Füßen der Kies auf dem Weg knirschte. Von einer alten Säule aus sprang er über die Balustrade, die den ganzen zweiten Stock umgab, nachdem er sich an den architektonischen Auswüchsen der Säule hochgehangelt hatte. Von der Balustrade aus gelangte er leicht in das Zimmer von Anna und Margarita (Anna öffnete ihm das Fenster).
»Alles in Ordnung?« fragte von ihrem Bett aus die traurige Margarita unsichtbar im Dunkeln.
»Ja, ja«, antwortete Anna, »alles in Ordnung. Gute Nacht.«
*
Die Nacht wurde stürmisch. Flüsternd einigten sie sich darauf, daß Ed, wie ein Bruder, neben Annas Bett auf dem Fußboden schlafen sollte. Im Slip legte er sich auf eine der warmen Dekken des Sanatoriums und bedeckte sich mit seinem Mantel. Anna trug einen seidenen Morgenrock, der sich unschön über ihrem großen Körper spannte und ihren Bauch betonte, sie legte sich auf ihr Bett und die Federn quietschten, als sie sich ausdehnten und wieder zusammenzogen. So blieben sie eine Zeitlang still liegen. Ed versuchte herauszubekommen, ob die Leningraderin schlief oder nicht. Irritiert von Annas Sticheleien, von der Verneinung seiner Männlichkeit und ihren Bemerkungen über das glückliche Sexualleben, das sie hätte haben können, wenn er nicht gekommen wäre, beschloß Ed, auf den Körper der unverschämten Jüdin einen Anschlag zu verüben. Die Leningraderin schien zu schlafen.
Er richtete sich auf, streckte den Arm aus, berührte leicht das Bett und ließ seine Hand weitergleiten, bis sie auf etwas stieß, was sich als Annas Arm herausstellte. Nachdem er ihren Ärmel gestreichelt hatte, ging er mit seiner Hand bis dort hinunter, wo sich der Ärmel öffnete und rollte ihn an Annas Arm hoch. Er streichelte ihren Unterarm. Wider Erwarten war Annas Arm weich und zart wie der eines Kindes. Anna ist heute böse und stachlig gewesen, aber ihr Arm ist überhaupt nicht so, dachte Ed. Dann glitt er bis zur kleinen harten Handfläche Annas herab und verweilte dort, um sie zu streicheln.
Natürlich war er schüchtern. So schüchtern, wie sein geliebter Julien Sorel war, als er sich in das Zimmer von Madame de Rênal schlich. Aber diese zaghafte Eroberung gefiel der verdorbenen Jüdin, die im Dunkeln ihren Atem anhielt. Wo wird er mich streicheln? fragte sie sich, und in Erwartung der Zärtlichkeit gerieten alle Orte, die sich darauf vorbereiteten, in eine angenehme Erregung. Als es ihr schließlich so vorkam, als widme der junge Mann sich zu sehr der Erforschung ihrer Handfläche, ergriff Anna einfach und natürlich die Hand, und nachdem sie ihren Morgenrock geöffnet hatte, legte sie sie auf ihre Brust.
Eine Ewigkeit lang blieb er bei ihren Brustwarzen, und als sie schon daran dachte, dem Unentschlossenen von neuem zu helfen und seiner Hand den Weg zu weisen, der zu anderen Regionen ihres Körpers führte, strich er mit einer großen Bewegung über ihren Bauch, seine brennende Hand legte sich auf ihren schönsten Seidenschlüpfer, und nach einigem Tasten glitt sie hinein und pflügte durch das Büschel wirrer Haare. Wie sie stinkt! dachte der Held und schlüpfte ins Bett, wobei er versuchte, keinen Krach zu machen. Wie ein großes Raubtier!
Nein, in dieser Nacht versenkte er seinen Herrscherstab nicht in der heißen Quelle, die in den Eingeweiden der Jüdin pulsierte. Wegen der schönen Leningraderin beschränkten sie sich auf Zärtlichkeiten mit der Hand. Doch im Verlauf der Nacht verwandelten sich ihre Zärtlichkeiten in Schmerzen, denn ihre ansteigende Temperatur durfte, wie es natürlich gewesen wäre, den Siedepunkt nicht erreichen. Die Temperatur stieg und stieg, und dann schalteten sie den Apparat in voller Fahrt aus. Nachdem sie diese thermische Operation einige Male wiederholt hatten, fühlten sich beide wahnsinnig gefoltert, wahnsinnig erschöpft. So wie man sich nach einem großen Lachanfall erschöpft fühlt, den man unterdrücken mußte. Zu den leichten Geräuschen, die plötzlich von Margaritas Bett her ertönten, schliefen sie ein.
Am nächsten Abend tranken sie Champagner in Gesellschaft von Margarita und dem Flieger, mit dem Anna geflirtet hätte, wenn ihr »Bruder« nicht in Aluschta aufgetaucht wäre. Die logische Folge dieser freundschaftlichen Sauferei war, daß der »Bruder« seine zweite Nacht im Frauenhaus des Sanatoriums verbrachte. Den Flieger hatte die wählerische Margarita abgefertigt. Ganz so wie Rückfalltäter, die ihr erstes Verbrechen verpatzt haben, benahmen sie sich im Lauf der zweiten Nacht noch ungezwungener und noch unverschämter. Nein, sein Stab versank auch in dieser Nacht nicht in der Jüdin, aber sie gingen so weit, daß die. Frau, beglückt über »seine« Existenz, lachend mit »ihm« zu spielen begann. Während sie »ihn« in ihren kleinen Händen hielt, flüsterte sie dem jungen Buchverkäufer glücklich zu, daß sie ihn bis zu diesem Augenblick für impotent gehalten habe. Nachdem sie sich gegenseitig erforscht und davon überzeugt hatten, daß alles an seinem Platze war, warteten sie nun nur noch auf einen günstigen Moment. Wenn es Sommer gewesen wäre, hätten sie sich schon längst am Strand begattet oder in den Bergen. Weisen wir nebenbei darauf hin, daß sie sich im milden Winter auf der Krim durchaus auch unter freiem Himmel hätten lieben können und daß sie es sogar versuchten, ja. Mehrmals entblößte der »Bruder« Annas Unterkörper und legte sie auf die nackten Steine, aber jedes Mal guckte ein Alter mit Stock und einem knallroten Kopf unter einer weißen Schiebermütze boshaft grinsend hinter einem Baum oder einem Felsen hervor (Anna behauptete, es sei immer derselbe gewesen).
In der dritten Nacht hielt die majestätische Margarita die Anspannung nicht mehr aus. In dem Augenblick, in dem Anna, das Geschlecht des jungen Mannes im Mund, ihren Bauch und ihre nasse Spalte auf seinen (sie sagte: musikalischen) Fingern rieb, sprang die Leningraderin plötzlich aus dem Bett, zog den Morgenrock über ihr Nachthemd und rannte türeschlagend raus.
»Sie holt die Nachtwache«, flüsterte Anna. Die Liebenden sprangen aus dem Bett und begannen, nach einem Versteck zu suchen. Anna, nackt (ihr riesiges Hinterteil schimmerte hell in der Finsternis), schloß die Tür ab. Im übrigen reichte es, den »Bruder« zu verstecken, Anna hatte das Recht, sich dort aufzuhalten. Sie hasteten nackt im Zimmer herum. Anna machte das Licht erst an und dann wieder aus. Man hörte Schritte und Stimmen sich der Tür nähern. Es wurde heftig geklopft.
»Wer ist da?« fragte Anna, obschon sie genau wußte, wer da war.
»Die Nachtwache. Machen Sie sofort auf!«
Warum er nicht durch das Fenster stieg und die alte Säule des alten vorrevolutionären Palais, das man in ein Sanatorium umgewandelt hatte, hinunterkletterte (er war diesen Weg immerhin schon dreimal hinaufgeklettert), ist schwer zu verstehen. Vermutlich lag es aber daran, daß er es nicht geschafft hatte, mehr als Slip und Hose anzuziehen. Viel absurder und erniedrigender aber war es ihm später vorgekommen, daß er Annas flüsternd gezischten Rat: »Kriech unters Bett, Ed! Ich glaube nicht, daß sie unter dem Bett nachsehen…« befolgt hatte. Er kroch unter das Bett, und Anna, die seinen Mantel und all seine anderen schwarzen Sachen zusammengerafft hatte, warf sie auf die Balustrade und schloß das Fenster.
»Öffnen Sie, Rubinstein, oder ich hole die Miliz!« »Was wollen Sie? Warum klopfen Sie mitten in der Nacht an meine Tür? Scheren Sie sich weg, Sie stören meinen Schlaf!«
Anna ließ sich schnell ins Bett plumpsen und versuchte dabei den Eindruck zu erwecken, als ob sie sich nur umdrehte. »Man hat uns gesagt, in Ihrem Zimmer befinde sich ein Mann.«
»Das ist eine Lüge. Hier ist niemand.« Anna stand endlich auf, und nachdem sie ihren Morgenrock übergeworfen hatte, öffnete sie die Tür.
Zwei Nachtwachen und ein grobschlächtiger Typ, der im Frauensanatorium wohl als Rausschmeißer diente, betraten das Zimmer und schauten quasi direkt unter beide Betten.
36
Man warf den jungen Liebhaber auf der Stelle aus dem Sanatorium; den Rest der Nacht verbrachte er draußen, in der kalten Natur, zwischen den Felsen über dem Meer, und konnte den Himmel betrachten, der allmählich heller wurde. Am nächsten Morgen setzte man Anna wegen moralischer Verkommenheit vor die Tür. Und obwohl Anna beim Zusammenpacken ihrer Sachen der »Schlampe von Margarita« in aller Deutlichkeit gesagt hatte, was sie von ihr hielt, waren sie und ihr »Bruder« doch äußerst gedrückter Stimmung, als sie etwas später in einem modischen und kalten Cafe saßen, Porto tranken und harte Eier und luftgetrocknete Wurst aßen.
Das Unangenehmste stand Anna noch bevor. Das Sanatorium des Druck- und Verlagswesens gehörte der Gewerkschaft, und wenn Anna nach Charkow zurückkam, würde sie dort schon eine Kopie der Anordnung ihres Rauswurfs aus dem Sanatorium erwarten, die die Verwaltung an die Gewerkschaft in Charkow geschickt hatte. Annas Direktion wäre verpflichtet, auf den »Amoralka« (so nannte der Volksmund den Bescheid über einen Rauswurf wegen unmoralischen Verhaltens) zu reagieren. Man konnte Anna entlassen, das hatte das zu bedeuten. Im »Poesie«-Laden zu arbeiten war angenehmer und brachte mehr Prestige ein als die Arbeit in jeder anderen Buchhandlung, und Anna hing an ihrem Job.
Anna machte ihren »Bruder« für alles verantwortlich. »Wie konnte ich nur so blöd sein, mit dir etwas anzufangen, einem Minderjährigen«, meinte Anna, während sie ihr Ei kaute. »Wenn du nicht gekommen wärst, hätte ich hier leben können wie Gott in Frankreich. Wenn man bedenkt, daß ein Oberst aus dem Militärsanatorium mir hinterherlief! Oder ich hätte mit dem Flieger Bekanntschaft schließen können… Wie hieß er doch gleich… Boris… Ich hätte Champagner getrunken und Schokolade gegessen. Und jetzt, was machen wir jetzt? Du hast kein Geld, Ed!«
»Du auch nicht!« grummelte der »Bruder« finster. »Und glaubst du etwa, wenn man den Flieger Boris unter deinem Bett gefunden hätte, daß man dich dann nicht rausgeschmissen hätte?«
»Mein erster Ehemann, Gasko, Gaston Mironowitsch, hatte recht, du bist verrückt, Anjuta!« Anna holte einen kleinen Spiegel aus der Tasche, und während sie ihre Augen schminkte, begann sie einen ihrer typischen Monologe an Anjuta. »Oh, du hattest recht, Gaston Mironowitsch…«
»Einen komischen Namen haben ihm seine Eltern gegeben«, meinte Ed wütend. Annas Vergangenheit machte ihn gereizt.
»Und du, glaubst du etwa, deiner wäre besser? EDUARD. Ein Operettenname. Und dein Vatername! Wenjaminowitsch! Du mußt Jude sein, Ed. Dein Vater — Wenjamin, deine Mutter — Raja — und der sagt, er sei kein Jude… Ha, ha, ha! Außerdem ist Eduard Wenjaminowitsch im Theater oder im Film immer ein Antiheld, ein Verräter, ein Intellektueller mit Fliege, der ein junges unschuldiges Mädchen verführt. Gewöhnlich hat er eine Glatze.«
»Ich hab volles Haar«, fuhr Ed sich empört mit der Hand über den Kopf — »bitte sehr, Haare genug! Aber von deinem Gaston Mironowitsch sagt man, daß er bereits seine letzten Haare verloren hat.«
Anna steckte ihren Spiegel zurück in die Tasche und schwieg, ihr Blick ging über den Kopf ihres »Bruders« hinweg unbestimmt in die Ferne.
»Hör zu, Ed. Ich habe eine Idee. Dieses Miststück, das mich mit achtzehn krank alleingelassen hat, lebt in der Nähe, in Simferopol. Er soll uns nur etwas Geld geben, wenn nicht, fahren wir hin, löschen seine ganze verfluchte Familie aus und vergewaltigen seine Kinder… Los, gehen wir telephonieren!«
So also wurden sie Erpresser. Später werden sie auch Spekulanten, Privatunternehmer und kleine Gauner sein… Sie werden ein halbes Dutzend sowjetischer Gesetze übertreten…
*
Erst in Charkow konnten sie sich zum ersten Mal lieben. Nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatstadt war das erste, was sie taten, im Restaurant des Hotels »Charkow« essen zu gehen. Sie hatten nicht mehr genug Geld für die Rechnung, und Anna mußte ihre Uhr als Pfand hinterlassen. Nach der Rückkehr in ihr Zimmer — der blutrote Schriftzug »Bringen Sie Ihr Geld auf die Sparkasse« vor dem Fenster war bereits erleuchtet — legten sie sich auf das Bett. Da, auf dem schmalen und harten Kleinmädchenbett Annas, drang unser Held, der sich in dieser Situation schrecklich linkisch vorkam, zum ersten Mal in die brennendheiße Quelle der jüdischen Frau ein. Die selbstgefällige Anna, die eine Schwäche für die Verführung Minderjähriger hatte, behauptete später, daß der kleine Dreckskerl noch Jungfrau gewesen sei, wie Tolik, der Abstrakte, und daß sie aus ihm einen Mann gemacht habe. Leider fühlen wir, die wir die Wahrheit kennen, uns verpflichtet, Anna, der Deflorateurin von männlichen Jungfrauen, dieses eine Blatt aus ihrem Lorbeerkranz zu zupfen. Trotz der jugendlichen Furchtsamkeit, die er angesichts des massigen Körpers von Anna Moissejewna verspürte, hatte unser Held vorher schon oft seinen Körper befleckt, wenn er ihn mit den knochigen Körpern der jungen Dirnen aus der Vorstadt vereinigt hatte.
Im »Charkow« hatten sie ein ukrainisches Nationalgericht gegessen, Borschtsch mit kleinen Brötchen. Die Brötchen waren, ganz dem Rezept entsprechend, reichlich mit gehacktem Knoblauch gewürzt, so daß ihre Liebe, abgesehen von dem starken und kräftigen Geruch Annas und dem schwachen und leichteren Eds, auch noch schwer und atemberaubend nach Knoblauch roch. Der Unterschied zwischen Anna und den mageren Heranwachsenden aus dem Arbeiterviertel erstaunte und erschreckte ihn. Die jüdische Frau, die sich ihm, von ihrer panzernden Kleidung befreit, hingab, kam ihm vor wie ein starkes, massiges Tier, wie ein weißhäutiges Flußpferd zum Beispiel. Der Flußpferdhintern, die gewaltigen Schenkel und riesigen Brüste der Frau — unser Held schwamm in diesem Meer aus Fleisch und fühlte sich darin wie einer der mageren Juden Chagalls, nur daß er unbeschnitten war. Zu behaupten, daß die Göttin Demeter sein Blut nicht in Wallung gebracht habe, hieße der Rubensfrau Anna Moissejewna größtes Unrecht anzutun. Der Buchverkäufer drang im Verlauf ihrer »Hochzeitsnacht« wiederholte Male in ihr Rubensfleisch ein, und jedes Mal hinterließ er in der Dame einen Teil seiner selbst. Leider war jeder Koitus nicht gerade von Dauer, denn der Buchverkäufer, zu erregt von seiner neuen Erfahrung, konnte und wollte seine Empfindungen nicht kontrollieren. Als die ersten Strahlen Auroras gleich Röntgenstrahlen durch die Fenstervorhänge drangen, schlug ihm seine neue Liebhaberin vor, sich ihm zu zeigen. Leicht verlegen erhob sich das Flußpferd und und posierte, eine Schulter halb nach vorne geschoben, die Knie leicht gebeugt, vor dem Bett, ja, es deutete sogar einige Tanzschritte an. »Ich bin sehr groß«, sagte die Tochter des jüdischen Volkes am Schluß der Parade und schlüpfte wieder unter die Bettdecke. »Du bist schön», log der Buchverkäufer und umarmte sie. (Er hätte sagen müssen: »Ich habe Angst vor dir.«) Anna war schön, aber man mußte Rubens-Liebhaber sein, um Anna, die Füllige, zu lieben.
Als er einschlief, wobei er seine Freundin an der Stelle umarmte, wo sich gewöhnlich die Taille befinden muß, hatte unser junger Mann die Empfindung, etwas Häßliches, womöglich ein Verbrechen begangen zu haben. Diese sehr verschwommene, leichte Empfindung würde auch in Zukunft jeden ihrer Beischläfe begleiten. Dieses Schuldgefühl erklärt sich dadurch, daß Anna, wie die Engländer sagen, sexuell nicht »his cup of tea« war. Die guten Gefühle, die unser Held ihr gegenüber in all den Jahren ihrer Beziehung empfand, unterstützten ihre Sexualität nicht, denn der launische Gott Phallos, der sich so unverschämt über die christlichen Werte hinwegsetzt, erhebt seinen schweren roten Kopf lieber zu den häßlichen Gefühlen. Es wäre angemessener, ihre Beziehung als eine Freundschaft zwischen zwei Personen zu bezeichnen, die einander brauchten. Ihr Konkubinat, das übrigens nie offiziell bestätigt wurde, war in der Tat im besten Sinne des Wortes eine »Vernunftehe«, was ja, wie inzwischen bewiesen wurde, die bestmögliche Form einer Ehe ist. Hatte ihre Hochzeitsnacht seine Flußpferd-Freundin befriedigt? Gewiß, aber… Ohne die Männlichkeit unseres Helden in Frage stellen zu wollen, zahlreiche Siege stehen ihm künftig noch bevor, können wir doch offen einräumen, daß die Befriedigung, die sie empfand, eher psychischer als physischer Natur war. In der Folge vollzogen sie friedlich im Bett ihren Beischlaf, ohne jemals zu versuchen, ihre Einstellung zu ihrer gemeinsamen Sexualität in Worte zu fassen. Trotzdem behielt der junge Mann immer den Eindruck, daß so manches andere Männchen Anna mehr sexuelle Befriedigung verschaffen könnte als er, Ed. Den Bemerkungen zufolge, die Anna mal hier, mal da fallen ließ, war Tolik Kuligin zum Beispiel (der, Luzifer sei Dank, fast ans ihrem Leben verschwunden war) ein »toller Kerl«. Selten, dann aber finster, meditierte Ed über das Thema des »tollen Kerls«. Der Unglückliche verstand noch nicht, daß auch er, Ed, jedes Mal dann ein »wirklicher Kerl« sein würde — ohne Mißerfolge —, wenn er mit der Frau im gleichen Bett hegen würde, die seinem Ideal »einer tollen Frau« entspräche.
37
Genka und Zwetkow spielen Schach. Genka trifft seine Exgattin immer auf neutralem Gebiet. Am häufigsten in der Wohnung von Zwetkow. Genkas Sohn, Aljoscha, sitzt unter dem Schachtisch und zielt mit einem Maschinengewehr auf Mama Olga und Zwetkows Freundin, die schöne und hinkende Lora, die mit einem Glas Champagner in der Hand auf dem Kanapee sitzen. Noch ist das Maschinengewehr bloß ein Spielzeug. Ed mag keine Kinder. Genkas Sohn, dieser dreijährige Blondschopf mit seinen verwaschenen Gesichtszügen, erscheint ihm seines Vaters unwürdig. ›Degeneriert‹ nennt ihn Ed insgeheim. Genkas Vater, Sergej Sergejewitsch mit seiner Mafiosofresse, und seine Mutter, die Exschauspielerin, sind Genkas würdig. Und seine Exgattin Olga? Wohl auch, obschon sie mehr Klasse haben könnte. Seine jetzige Flamme, superwoman Nonna, entspricht vollkommen dem superman Genka.
»Möchten Sie Champagner, Limonow?« Genka hebt die Augen vom Spiel. Manchmal, je nach Laune, siezen sie sich oder nennen sich bei ihrem Nachnamen.
»Wir möchten.« Ed mag keine Spiele, vor allem nicht diese langweiligen und schweigsamen wie das Schach. In seiner Kindheit hat er die Abende damit verbracht, mit Grischa Gurewitsch Schach oder Karten zu spielen. Seltsamerweise verlor sich sein Interesse an Spielen zur selben Zeit, wie der Frosch Grischa aus seinem Leben verschwand. Zeitverschwendung war das richtige Wort dafür.
Die hinkende Lora gibt ihm ein Glas Champagner; Ed setzt sich neben den jungen Frauen auf das rote und abgenutzte Kanapee von Zwetkow.
»Ed?« Zwetkow zieht mit seinem schwarzen Pferd gegen Genka.
»Schach.«
»Ja, ich höre.«
»Genka hat mir gesagt, daß du mit Wassilij Jermilow befreundet bist? Kannst du mich ihm vorstellen? Ich möchte ihm ein Bild abkaufen.«
»Gennadij Sergejewitsch hat schamlos übertrieben. Mit ihm befreundet? Ich kenne ihn, das stimmt. Bach kennt ihn gut. Er hat mich auf den Dachboden von Jermilow mitgenommen. Es ist richtig, daß meine Gedichte dem Alten gefallen haben; jedenfalls hat er das gesagt. Er hat sogar vorgeschlagen, sie zu illustrieren… Und warum willst du ein Bild von ihm kaufen?«
Der muskulöse Zwetkow dreht sich mitsamt dem Stuhl zu Ed um. »Verstehst du, Ed, bei mir war ein Typ aus Kiew. Er meint, jetzt sei der richtige Moment, die russische Avantgarde der zwanziger Jahre zu kaufen. Weil diese Sachen in ein paar Jahren ein Vermögen wert seien. Er hat mir auch gesagt, daß der bedeutendste Maler der zwanziger Jahre in Charkow lebt. Kennst du Jermilow, hat er mich gefragt. Wenn du an den rankommst, Zwetkow, hat er zu mir gesagt, dann hast du in ein Paar Jahren Geld wie Heu. Im Frühling, hat er mir gesagt, hat die Frau von Konstantin Simonow ihn besucht und ihm fünf Bilder abgekauft.«
Zwetkow nennt sich Businessman. Die Schwarzhändler nennen sich auch Businessmen, aber im Unterschied zu ihnen läuft der ehemalige Boxer nicht den Ausländern hinterher, um ihnen »Scheißjeans« (wie Zwetkow selbst sich ausdrückt) abzuschwatzen. Zwetkow befaßt sich mit dem Kauf und Verkauf von Antiquitäten — Möbeln, Pendeluhren, Silber und Gold in jeder Form, und dringt dabei immer mehr auch in das Gebiet der Stiche und alten Gemälde vor. Genka behauptet, daß Zwetkow nicht schlecht verdient. Das Ganze hat damit angefangen, daß Zwetkow den Nachlaß einer verstorbenen Nachbarin, alles, was sich in ihrem Zimmer befand, ihren Erben für zweihundertfünfzig Rubel abkaufte. Er hat die ganze Erbschaft sofort an einen Laden weiterverkauft und tausenddreihundert Rubel dafür bekommen. Nach diesem Coup, den er eher durch einen glücklichen Zufall landen konnte, hat Zwetkow sich hingesetzt, nachgedacht und dann entschieden, daß Operationen dieser Art die Berufung seines Lebens seien. (Wie wir wissen, war auch Ed so zu seiner Verdienstquelle, dem Schneidern von Hosen, gekommen.) Zwetkow weiß seine Freundschaft mit Genka und Sergej Sergejewitsch Gontscharenko sehr zu schätzen, denn die zweihundertfünfzig Rubel, die es dem damals Mittellosen erlaubten, den Nachlaß der Nachbarin zu kaufen, waren ihm von dem alten Gontscharenko geliehen worden, der sich mit Zwetkows Erklärung für den Grund dieser Anleihe zufrieden gegeben hatte. Zwetkows Tätigkeit ist im Gegensatz zu der der Schwarzhändler vollkommen legal, der Staat hat noch keine Zeit gehabt, diese neuen Methoden von Privatleuten, Geld zu verdienen, zu verarbeiten, und auch noch keinen Weg gefunden, sich seinen Cäsarenanteil an den Nachlässen der Großmütter zu sichern.
»Kannst du Zwetkow mit Jermilow bekannt machen?« wendet sich Genka, der den nächsten Zug gemacht hat, an seinen Freund.
»Ich werde es versuchen… Bach könnte es eher… Um ehrlich zu sein, erinnere ich mich nicht einmal mehr genau, wo er wohnt. Irgendwo in der Swerdlow-Straße, unter dem Dach.«
»Erinnere dich, Ed, das ist sehr wichtig. Du bekommst auch eine Provision.«
»Was habe ich mit deinen Provisionen am Hut», erregt sich Ed plötzlich. »Ich stell dich auch so vor, wenn ich kann.« All diese Businessmen sind sich gleich, ob sie nun Schwarzhändler sind oder »was Besseres«. Er gibt mir eine Provision! Ed weiß nicht genau, warum er nicht will, daß Jermilows Bilder Zwetkow in die Hände fallen. Diesen Betrüger werde ich dem Alten nicht vorstellen, gelobt er sich.
*
Der alte Jermilow hatte sie freundlich empfangen, ohne sonderliche Begeisterung über den Dichter zu äußern, den Bach ihm vorstellte. Man konnte ihn verstehen. Erstens bekunden die Alten nie Begeisterung für die Jungen. Und dann war er mit Chlebnikow befreundet gewesen, so eng, wie Ed heute mit Bach. Chlebnikow hatte mit ihm zusammengelebt. Jermilow hatte seine Gedichte illustriert; er war es auch, der die Unterschrift des Charkower Kommissars für das Druckwesen gefälscht hatte; der mit rotem Stift »genehmigt« auf den Antrag, das Gedicht »Ladomir« in der Lithographie-Werkstatt der Charkower Eisenbahn drukken zu dürfen, geschrieben hatte. Welche Dichter hätte Jermilow ertragen können, wo doch das einzige Genie der russischen Dichtung des zwanzigsten Jahrhunderts ihm in den Tagen seiner Jugend seine gerade erst geschriebenen Gedichte vorgelesen hatte! Nach den wunderbaren Gedichten von Chlebnikow konnten die Strophen der jungen halbgebildeten sowjetischen Zeitgenossen ihn allenfalls an das Piepsen von Mäusen erinnern. Der unbeugsame Bach hatte, ohne auf Eds Ellbogenstöße und seine Grimassen zu achten, darauf bestanden, daß Ed seine Gedichte Jermilow vorlas. Schweißbedeckt sogar dort, wo man nie schwitzt, öffnete der Dichter über dem aufgeschlagenen Heft den Mund.
Dieser unglaubliche Tag
War regenertränkt
Die Ziegel der rotgemauerten Häuser
Naß in den Gärten
Von Bäumen umstanden lebten in den Häusern
Junge, Alte, Kinder;
Katja schaute den ganzen Tag in eine Ecke.
Sie rannte, rannte und schrie
Olja, die Haare ganz zerzaust.
Der finstere Fjodor las ein geheimnisvolles Buch
Und spähte verstohlen vom Dachboden
Wahnsinnig liebte Anna
Das Neue in der Natur…
Der alte Maler belebte sich spürbar. »Lesen Sie weiter«, sagte er und knarrte mit seinem Sessel aus Holz. »Warum haben Sie sich unterbrochen?« Ed las noch ein paar Gedichte, er schwitzte nicht mehr.
»Und?« Bach betrachtete Jermilow siegessicher. »Ich sehe, daß Ihnen das gefallen hat.«
»Ja, ja…« Jermilow wählte seine Worte langsam. »Das ist interessant. Wissen Sie, daß ich fest davon überzeugt war, daß die Jungen in unserem Land seit meiner Jugend zu fühlen und zu schreiben verlernt haben? Aber was Ihr Freund gelesen hat, Wagritsch Akopowitsch«, der alte Maler, der sich nur an Bach wandte, sprach den Vor- und Vatersnamen von Bach deutlich und vorsichtig aus, »das hat mich an meine Jugend und die Gedichte der Leute, die mich umgaben, erinnert… Ich war nicht nur mit Welemir befreundet, wissen Sie. Ich kannte auch Boschidar, ich illustrierte die Gedichte von Elena Guro. Warten Sie, ich werde Ihnen ein Buch von Guro zeigen, das ich illustriert habe.« Der Alte ging zu einer Kiste, die in der Mitte des Dachbodens stand und als Tisch diente, und nachdem er Wagritsch gebeten hatte, den Deckel aufzuhalten, begann er darin herumzuwühlen.
Unser Dichter beobachtete diese Szene mit einer Mischung von Respekt und Schmerz. Auch später wird unser Held, wenn er alte Leute sieht, die im Leben erfolglos gebheben sind, sei es, daß sie von der Geschichte und von ungünstigen Umständen benachteiligt wurden, sei es, daß kühnere oder begabtere Kollegen sie übertrumpft haben, diesen Schmerz empfinden. Der Alte im Pullover, mit seinen weißen Haaren und den hochmütigen Lippen (Es gibt, wissen Sie, eine besonders stolze Art, die Lippen zusammenzupressen), zog aus den Tiefen der Kiste ein Leporello-Buch hervor, dessen großes Format an die Kinderbücher von heute erinnerte; die großen Buchstaben des Textes verbanden sich mit kubistischen Formen. Wenn du einundzwanzig bist und man dir ein Kunstwerk zeigt, das aus einer Zeit noch vor der Geburt deines Vaters stammt, kannst du nur mit Begeisterung reagieren, deine kritischen Fähigkeiten streiken dann. Wenn unser Held dreißig oder älter gewesen wäre (in diesem Alter ist ein Mann bereits zynisch und doch seiner selbst noch sicher), hätte er sich vielleicht an seinen ersten Eindruck, an die Ähnlichkeit des Leporello-Buches mit einem Kinderbuch gehalten und wäre zu dem Urteil gelangt, das Machwerk sei geschmacklos und hausgemacht. Damals aber beugte er sich über das Buch, das auf der Kiste lag, und spürte eine heilige Scheu in der Seele. Es war mehr eine Scheu vor der Geschichte, die er später auch in den ägyptischen Sälen der Museen auf der ganzen Welt verspürte, wenn er sich über viele tausend Jahre alte Ausstellungsstücke beugte.
Der Alte ließ seine festbeschuhten Füße leicht über den Boden schlurfen, als er in den hintersten Winkel des Raumes ging und eine Art Platte aus der Wand zog, auf der eine elektrische Kochplatte stand. Vor etwa fünfzig Jahren hatte der junge Professor an der Kunstakademie, dem die Haarfransen bis zu den Augenbrauen reichten, diesen Dachboden bekommen und ihn nach seinem kubistischen Geschmack ausgebaut und eingerichtet. Das war noch zu der Zeit, als, seinem Freund Welemir zufolge, »die sonderbare Zerstörung der Welt der Kunst/das Vorzeichen der Freiheit war/der Befreiung von den Ketten«. Nun lag Welemir schon lange unter Nowgoroder Erde, und kurz nach ihm war, in zartem Alter, auch die russische Freiheit gestorben, aber immer noch gab es die kubistischen Flächen, die Jermilow noch vor Braque, wie Bachtschanjan behauptet, entworfen hatte. Auf einer solchen kochte der alte Jermilow den jungen Leuten einen Tee. Der Großvater macht seinen Enkeln Tee. Die Väter sind umgekommen oder abwesend. Die Väter sind gewissermaßen eine Abweichung, ein krummer, häßlicher Zweig am gesunden Baum der Geschichte. Man hat sie ignoriert (sie sind übrigens selbst schuld, haben nebenbei krumme Touren gemacht, haben zuviel Räuber und Gendarm gespielt), und die Tassen heißen, starken Tees gelangen nun aus den kühlen Händen der Großväter in die brennenden Hände der Enkel.
Die Alten hören immer mit Tee auf. Ein anderer Alter, Ewgenij Kropiwnitzkij, der sich ebenfalls aus den Schlägereien der Kerle, der Väter, hatte retten können, wird unseren jungen Mann einige Jahre später im Dorf Dolgoprudnaja bei Moskau mit starkem Tee bewirten. Zum Ende ihres Lebens hin verstehen es die Alten, einen erstaunlichen, purpurnen, kräftig schmeckenden Tee zuzubereiten, der den Venen der von Alkohol und Willensschwäche zerfressenen jungen sowjetischen Intellektuellen orientalische Frische und Mäßigkeit zuführt. Nach Kropiwnitzkij wird Ed noch mit zwei weiteren, etwas anders gearteten Alten Tee trinken: mit Lilja Brik und Wassilij Katanjan. So wird unser Held in seinem Leben von einem Alten zum nächsten gelangen.
»Und warum, Wassilij Jakowlewitsch, illustrieren Sie nicht die Gedichte von Limonow?« fragt plötzlich der unverschämte Wagritsch, als sie bereits auf der Türschwelle stehen und die Audienz beendet ist. Eds Gesicht überzieht sich mit Schamesröte, die indes nach außen hin unsichtbar bleibt, weil seine Blutgefäße tief unter der Haut liegen; aber die Temperatur auf seinem Gesicht hat sich um einige Grade erhöht.
»Bach! Bist du…«, er versetzt ihm böse einen Stoß mit seinem Ellbogen.
Der weniger streng und weniger herablassend aussehende, zum Ende des Besuches hin umgänglicher gewordene alte Maler willigt überraschend ein. »Ach! Wagritsch Akopowitsch, man kann den Alten noch aufrütteln. Bereiten Sie Ihre Gedichte vor und kommen Sie. Bloß möchte ich Sie darum bitten, nicht mehr als ein Dutzend Gedichte auszuwählen. Heute versucht man immer, soviel wie möglich in ein Buch hineinzustopfen. Zu meiner Zeit versuchte man noch, interessante Bücher zu machen… Wie der Vorsitzende des Rats der Volkskommissare, Wladimir Uljanow Lenin, sagte: ›Besser weniger, aber besser!‹…«
Die Idee, daß Jermilow einen Gedichtband von ihm illustrieren würde, erregte Ed eine Zeitlang. Jermilow, Chlebnikows Freund! Der Mensch, dessen Katalog zu einer Retrospektive seiner Werke (er hatte ein Loch wie eine Farbpalette) man zunächst herausgegeben, dann verboten und aus dem Verkehr gezogen hatte… Jermilow, den man damit beauftragt hatte, den sowjetischen Pavillon auf der Weltausstellung von 1937 zu entwerfen (Ed hatte in der Behausung des Malers ein Modell aus Pappmache gesehen. Jermilow war »in Ungnade gefallen« und das Projekt hatte nie das Tageslicht erblickt.)… Jermilow selbst würde seine Gedichte illustrieren! Vielleicht lebte Jermilow, zu seinem Unglück, in einer Epoche der nicht zu vollendenden Projekte, oder seine persönliche Erfolglosigkeit war zu groß, zu übermächtig — darüber konnte man nur Mutmaßungen anstellen. Das Projekt einer gemeinsamen Arbeit mit dem Vertreter der jungen Generation, der ihn an seine eigene Generation erinnert hatte, erlitt jedenfalls das gleiche Schicksal wie viele der übrigen fehlgeschlagenen Projekte. Ed zog schon bald nach Moskau, Jermilow segnete schon bald das Zeitliche. Schade. Vielleicht wäre es ein schönes Buch geworden.
»Weißt du, daß man Wassja im Künstlerverband rehabilitieren will?« meinte Bach, als sie auf die Swerdlow-Straße hinaustraten.
»Hat er das nötig?« Der Dichter wunderte sich.
»Wir können das nicht verstehen…« Wagritsch seufzte, »…für ihn ist es sehr wichtig, Mitglied im Verband zu sein. In unserem Alter war Wassja schon Professor an der Kunstakademie. Er hat sein ganzes Leben unter Künstlern verbracht.«
Ed verstand nicht genau, welche Verbindung es da zwischen dem gab, ein ganzes Leben unter Künstlern verbracht zu haben und Mitglied in der Charkower Abteilung des Künstlerverbandes zu sein, aber er vertiefte sich nicht in das Problem. Vielleicht wurde der alte Jermilow senil. Wie alle jungen Menschen verachtete Ed im Grunde die Alten und zählte sie zur Gruppe der Blinden und Buckligen. Die Jugend ist grausam, nicht aus Vernunft, sondern aus Instinkt; jeder körperlich gesunde Junge ist ein Faschist, auch wenn er das hartnäckig bestreitet und Ihnen eine verpaßt, wenn Sie bei Ihrer Meinung bleiben.
»Weißt du…« Bach blickte sich aus irgendeinem Grund mißtrauisch um. Sie liefen in Richtung Sowjetskaja-Platz, zum Zentralen Kaufhaus, um von dort zur Straße der Freien Akademie hinaufzusteigen, die in die Rymarskaja einmündet — sie waren auf dem Rückweg zu ihrem heimischen »Automaten«.
»Weißt du, während der Okkupation hat… hat Wassja ein bißchen mit den Deutschen kollaboriert…«
»Und man hat ihn nach dem Krieg nicht ins Kittchen gesteckt?« fragte Ed verwundert.
»Er hat nicht handgreiflich kollaboriert, er war natürlich nicht bei der Polizei. Er hat für sie Anschläge und Plakate hergestellt, er hat, glaube ich, an der kulturellen Front gearbeitet…« Sie liefen eine Zeitlang schweigsam weiter. Wagritsch mit seinen weit ausholenden Schritten, Ed mit seinen kürzeren und schnelleren. »Man kann ihn verstehen«, fuhr Wagritsch fort. »Die Kommunisten haben ihm sein Leben und seine Karriere verpfuscht. Er hat besser begonnen als die Größten der europäischen Avantgarde seiner Zeit, und wer kennt ihn jetzt? Kannst du dir die Verbitterung vorstellen, die er ihnen gegenüber 1941 empfand und seine Freude, als er die Deutschen kommen sah! Umso mehr, als er, bevor er an die Hochschule für Malerei, Bildhauerei und Architektur in Petersburg ging, eine Zeitlang in Deutschland studiert und die Deutschen in guter Erinnerung behalten hatte…«
»Aber warum glaubst du, Bach, haben die Realisten in der sowjetischen Kultur die Macht an sich gerissen? Während der Revolution und auch noch danach waren doch die Avantgardisten die bedeutendsten. Es waren schließlich nicht die Realisten, sondern Tatlin und seine Jungs, die man damit beauftragt hat, zum ersten Jahrestag der Revolution den Roten Platz zu gestalten. (Tatlin stammte aus Charkow. Der Konstrukteur des Projekts eines Turms der Internationale hatte, ohne lange nachzudenken, alle Bäume auf dem Roten Platz rot gefärbt. Mit Spritzgeräten.) Du weißt doch selbst, Bach, was damals alles möglich war, was für erstaunliche Leute es gab! Wie hat man sie kaltgestellt? Wer war schuld?«
»Wer? Die Kommunisten natürlich! Was bist du naiv, verstehst du nichts, oder was ist los?«
»Sachte, anfangs war die Avantgarde den Kommunisten doch genehm. Selbst in Vitebsk, in dieser hinterletzten Provinzstadt, hat man doch niemand anderen als Marc Chagall zum Volkskommissar für Kultur ernannt. Und sogar Lunatscharski, über den man jetzt nicht das Gegenteil behaupten kann, verstand die Kunst der Avantgarde. Erst Ende der zwanziger Jahre fing man an, die Avantgardisten auszuschalten, sie in die Kulissen abzudrängen und ihnen ihr Brot wegzunehmen. Sie haben sich doch zehn Jahre lang gehalten.«
»Ich glaube, daß die Kommunisten zehn Jahre brauchten, um ihren persönlichen Geschmack auf den Punkt zu bringen. Die ersten vier Jahre war Bürgerkrieg, da war die Kunst nicht das Problem. Dann gab es die ›Desorganisation‹, wie sie es nennen, und als die neuen Herren schließlich die Hand an die Kunst legten, da haben sie bald ihre wahre Hammelherdennatur offenbart.«
»Und ich, Wagritsch, ich glaube, daß man nach dem Bürgerkrieg nach und nach die ›Schizos‹ wie uns, die die Revolution gemacht hatten, aus dem Weg geräumt hat, und dann andere Leute, die Funktionäre, an die Macht gekommen sind. Die Aufgabe der Funktionäre ist es nie, einen Staat zu zerstören, sondern ihn zu leiten. Und weil die Funktionäre von Natur aus konservativ und bürgerlich sind, haben sie begonnen, diejenige Kunst zu fördern, die ihnen einzig nahesteht und zugänglich ist, den Realismus.«
»Alle Kommunisten sind sich gleich, Ed. Sowohl die, die die Revolution gemacht haben, wie auch die, die danach kamen.«
»Red keinen Schwachsinn. Ich bin mir sicher, Wagritsch, wenn wir in dieser Zeit gelebt hätten, wären wir auf Lenins Seite und bei seinen Jungs gewesen und nicht bei diesen schwachsinnig gewordenen, überlebten Arschlöchern der herrschenden Klassen.«
»Und du wärst in den dreißiger Jahren im Lager verreckt.«
»Ich wäre nicht verreckt…«
»Hör auf, Ed, da gab es andere und stärkere als dich, die in den Lagern verschwunden sind.«
»Sie sind verschwunden, weil es ein Kampf um die Macht war. Das waren alles keine Engel. Meyerhold hat damit gedroht, Ehrenburg zu verhaften, und der berühmte Bljumkin, der Mörder des deutschen Botschafters Mirbach, und Bewunderer von Gumilev, was ist mit dem? Jetzt, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, legt man den Deckel drauf, das heißt, jetzt tun sie so, als ob alle, die eliminiert wurden, die nettesten Leute waren, und die, die mit heiler Haut davongekommen oder eines natürlichen Todes gestorben sind, Scheißkerle oder Monster waren. Es ist idiotisch, die Geschichte von einem späteren Zeitpunkt aus zu verurteilen. Wir sind doch alle gleich. Heute herrscht bei uns die gleiche Moral, bloß daß man sich in friedlichen Zeiten friedlicher Mittel bedient. Statt Sascha Tscherewtschenko dafür aufzulauern, daß er mit deiner Irka im Hauseingang stand, statt der Faustschläge von Viktor und der Stiefeltritte von M'sieur Bigoudi hättest du Sascha damals an die Wand gestellt. Danach hättest du den Dichter natürlich betrauert…«
Bach grinste. Ed und er würden noch mehr als einmal die Gelegenheit haben, ihre Wahrnehmung der Welt zu überprüfen und sie aufgrund ihrer jeweiligen neuen Erfahrungen zu verändern. Bach wird in Eds Geschichte länger als die anderen Personen eine Rolle spielen, es scheint deshalb angebracht, etwas ausführlicher auf den »Armenier mit den großen Füßen« einzugehen, wie ihn Irkas Papa nannte, der hebenswürdige Intellektuelle und Fetischist, Eigentümer einer ganzen Sammlung von gestohlenen Einlegesohlen aus Frauenschuhen. Dazu ist es jedoch erforderlich, dem Leser vorher die grundlegenden Informationen über die Beziehungen unseres Haupthelden, des jungen Dichters, zu den Inhabern der Macht zu geben.
38
Es gibt viele Leute, denen das Gesetz zuwider ist. In einer Situation, in der die Chancen fifty-fifty stehen, ziehen sie immer die illegale der legalen Lösung vor. Unser Dichter ist auch so einer.
Die Repräsentanten der Macht hebte er aus Instinkt schon als Kind nicht. Aus heutiger Sicht ist schwer auszumachen, was in dem Widerwillen Sawenkos den Inhabern der Macht gegenüber eine größere Rolle spielte: die Verwirrung oder die Angst. Wie auch immer, die Stunden, die er in offiziellen Einrichtungen verbrachte, waren eine Qual für ihn. Das gilt für alle seine Begegnungen mit den Repräsentanten der Macht, seien es nun Personalchefs, Werkabteilungsleiter, Vorarbeiter, Milizchefs, denen er mehrere Male in seinem Leben vorgeführt wurde, oder sonst irgendeine wichtige Persönlichkeit. Wenn er mit den »Chefs« sprach, dann begann Sawenko-Limonow, dieser doch intelligente, kultivierte junge Mann, zu schwitzen, hustete und mußte schlucken, wußte nicht, wohin mit seinen Händen und konnte die Fragen nicht richtig beantworten. Die Personalabteilungen der Unternehmen, in denen er arbeiten wollte (wirklich wollte er natürlich nicht), erschreckten ihn so, wie womöglich die Vorstellung der Hölle die ersten aufrichtigen Christen erschreckt hatte… Der Gestank der dreckigen Aschenbecher, der Gestank der Körper und Kleidung, die häßlichen Wände, die Schäbigkeit der Möbel — all das überkam ihn geradezu. Die Hure in der Hölle waren voller grobgesichtiger, dicker Besucher und ebenso grober Arbeitgeber. Mit welcher Erleichterung entwich unser junger Mann, den man wieder einmal nicht eingestellt hatte, aus der Höhle der x-ten Personalabteilung in die Freiheit der Straße, in die glühende und gelbe Hitze des Sommers oder in den weichen, flockigen Schnee, der vom Himmel fiel; mit welcher Erleichterung lief er — alle öffentlichen Verkehrsmittel meidend — zu Fuß durch die Stadt, um sich an der müßigen Natur zu erfreuen und das Wiedersehen mit seinen Eltern hinauszuschieben, die erwarteten, daß ihr Sohn endlich wie »alle Welt« wurde, das heißt einen Platz fand, an den er sein Leben lang angekettet blieb.
Vielleicht hatte sich Sawenko-Limonow gerade aufgrund seiner Furchtsamkeit und seines körperlichen Widerwillens gegen das Kollektiv und ganz besonders gegen dessen Führer und Inspiratoren, die Offiziellen, mit einundzwanzig Jahren für einen Einzelgängerberuf entschieden und war, vom Zufall und von Anna unterstützt, Schneider »in Heimarbeit« geworden. Obschon solch eine privatunternehmerische Initiative von Gott weiß welchem Artikel des sowjetischen Gesetzbuches verboten war, hatte Sawenko-Limonow es verstanden, ohne den geringsten Konflikt mit den Behörden am Tewelew-Platz 19 seiner Arbeit nachzugehen. Abgesehen von einem einzigen Zwischenfall…
»Das schwarze Biest«, das in jedem russischen literarischen Werk auftaucht, das auf der Höhe der Zeit sein will, der KGB (diese drei Buchstaben lassen das Herz der masochistischen Leser vor Erregung erbeben… Endlich! Zwar erst am Ende des Buches, auf Seite 288 oder so, aber letzten Endes doch!) muß früher oder später seinen Auftritt haben. Das Biest hatte seinen Auftritt am Tewelew-Platz 19. Aber lassen Sie uns gleich sagen, daß es nicht unser junger und frischer Dichter war, der Anlaß gab für den Besuch des Vertreters der berühmten Organisation in dem Zimmer, dessen Wände zu der Zeit schon in grellen Farben ausgemalt waren; Anlaß dazu gab vielmehr der Tausch geheimer Informationen gegen einen Jeansanzug und einen Stapel Paris-Match-Ausgaben, der im Hotel »Charkow« zwischen dem Avantgardisten Bachtschanjan und einem durchreisenden französischen Touristen stattgefunden hatte.
M'sieur Bigoudi hatte dem Spion als Dolmetscher gedient. Was hatten damit aber unser junger Dichter und seine schöne Gehebte Anna zu tun? Die Erklärung ist einfach. Als er bemerkte, daß er verfolgt wurde, wußte der Möchtegern-Spion Bachtschanjan nichts Besseres zu tun, als sich in das Haus Tewelew-Platz 19 zu flüchten. Erst als er im Straßenbahn-Zimmer war, hatte der Möchtegern-Spion sich dazu entschlossen, der dicken Schönheit den Leutnant Soroka zu zeigen, der sich vor dem Institut für Kältetechnik aufgepflanzt hatte. Er stand da, den Kopf in den Nacken geworfen, und beobachtete die Fassade des Hauses Nr 19. Weder der Armenier, dieser Anfänger auf dem Gebiet illegaler Aktivitäten, der zwei Anzüge übereinander trug, noch die poetische Muse (manchmal glich Anna wirklich der Muse auf dem berühmten Bild »Apollinaire und die Muse« des Zöllners Rousseau, nur hatte sie ein schöneres Gesicht) hatten kriminelle Erfahrungen, weshalb Anna auch ganz offen ans Fenster trat, um sich den KGBler anzusehen. Schlimmer aber war noch, daß sie gleich danach hastig zurückwich. Der sehr erfahrene junge Poet tadelte die beiden sofort und erklärte, daß der »Typ« in wenigen Minuten an der Tür klingeln werde. Seine Vorhersage traf ein. Anna reagierte nicht auf das hartnäckige Klingeln. Es war die Anissimowa, die gereizt die Tür öffnete. Als die knochige Faust von Leutnant Soroka an die Tür zum Straßenbahn-Zimmer klopfte, rannten drinnen Anna und der Spion herum, um ein Versteck für die Beweismittel, die Paris-Match-Ausgaben, zu finden. Der Spion trug, wie wir bereits wissen, den Jeans-Anzug des Franzosen über seiner Charkower Kleidung. Schließlich öffnete Anna mit einem Ruck die Truhe, die neben dem Fenster stand, warf die Zeitschriften hinein, und nachdem sie die Tür aufgemacht hatte, ging sie wieder zur Truhe und setzte sich mit ihrem massigen Hinterteil drauf.
Der Leser, der nun eine Durchsuchungsszene erwartet, eine Folter- und Schreckensszene, muß leider unverzüglich seine Erwartungshaltung ändern und sich auf eine viel possenhaftere Szene gefaßt machen. »Sie interessieren mich nicht, Anna Moissejewna«, sagte der glatzköpfige Oberleutnant, kaum daß er eingetreten war (er hatte ein großes Gesicht und trug einen grauen und gepflegten Anzug) und bewies damit, daß er alles wußte. Er kannte Annas Vor- und Vatersnamen! »Der da interessiert uns!« Der Glatzkopf zeigte auf Bachtschanjan in seiner steifen Jeansjacke, der an der Verbindungstür zwischen den beiden Rubinsteinschen Zimmern lehnte. »Und was er vor einer halben Stunde im Hotel ›Charkow‹ gemacht hat!« Der Oberleutnant fixierte Bachtschanjan mit höchst strengem und bedeutsamen Blick.
»Gehen Sie!« schrie Anna Moissejewna und rutschte mit ihrem Hintern auf der Truhe hin und her. »Wer sind Sie? Was wollen Sie?!« Anna versprühte probeweise ein paar Funken mit den Augen.
Um weiterhin die Pension zu beziehen, die man ihr als einer Verrückten der Klasse 1 gewährte, mußte Anna sich von Zeit zu Zeit medizinisch untersuchen lassen. Die Untersuchungen fielen nicht immer in eine ihrer manischen oder depressiven Phasen. Fanden sie statt, .wenn es ihr gut ging, spielte Anna vor den Medizinern mit Begeisterung die »Schizo«. Nun hatte sie beschlossen, ihre Nummer vor dem Oberleutnant abzuziehen.
»Was wollen Sie! Machen Sie, daß sie wegkommen! Ich bin eine Invalidin der Klasse 1! Lassen Sie eine kranke Frau in Ruhe!« Unter ihrer Sonnenbräune färbte eine gesunde rosa Farbe die Wangen der Kranken. Anna, die sehr schnell braun wurde, verwandelte sich im Sommer in eine geradezu unglaubliche, üppige orientalische Schönheit. Wir haben sie bereits mit einer Chrysantheme verglichen. Der KGBler betrachtete die Orientalin neugierig und mit kaum verhohlenem Interesse. Er sah ein bißchen zu alt aus für seinen Rang. Wahrscheinlich war dieser Mann mit dem einfachen Gesicht von der Miliz zum KGB versetzt worden, weil er im Dienst eine gute Auffassungsgabe und viel Eifer bewiesen hatte. Wenn man ihn betrachtete, konnte man mühelos erkennen, daß dieser Blonde mit seiner beginnenden Glatze, der einmal sportlich gewesen sein mußte, eine einfache, häßliche Frau in seinem Alter und zwei, drei häßliche Kinder hatte, kurz, daß sein Privatleben nicht gerade von raffinierten Vergnügungen und außerordentlichen Abenteuern strotzte. Und da brachte ihn seine Arbeit in eine komische Straßenbahn, die von abstrakten Malern und Verrückten ausgemalt worden war, zu einer schönen Frau mit einem riesigen Hintern, deren verrückte blaue Augen und schon halbergrauten Haare gerade die Einbildungskraft solcher Männer beleben.
Er tauchte wieder auf aus seiner Erstarrung, zog seinen Ausweis aus der Innentasche seiner Jacke und klappte ihn vor Annas Augen auf. »Oberleutnant Soroka. Komitee für Staatssicherheit!«
In diesem Moment wurde das ganze Gewicht der natürlichen Vorteile Annas — ihr Hintern, ihre Augen, ihre Haare, ihre Intelligenz und ihre Rätselhaftigkeit —, wurde all das von der Autorität und der Legende der Organisation aufgewogen, die sich da in Gestalt eines imaginären grünen Dinosauriers von der Art Godzillas knurrend hinter dem Oberleutnant erhoben hatte und drohend ihre Pranken nach den Delinquenten ausstreckte. »Wie ich Ihnen schon gesagt habe, Anna Moissejewna, interessieren Sie uns nicht. Uns interessiert, was Wagritsch Bachtschanjan im Hotel ›Charkow‹ getan hat.«
»Fragen Sie ihn doch, bitteschön! Wagritsch, was hast du im Hotel getan?« Anna sprang von der Truhe hoch, sie hatte offenkundig die Paris-Match-Ausgaben vergessen, auf denen sie gesessen hatte, aber sie setzte sich sofort wieder. Die Truhe knarrte jämmerlich.
Der Oberleutnant lächelte. »Was er im Hotel getan hat, kann er uns anderswo erzählen, unter vier Augen. Was mich jetzt interessiert, ist der Plastikbeutel, den er bei sich gehabt hat, als er zu Ihnen gekommen ist. Wo ist das Paket, Wagritsch Akopowitsch?« Soroka zeigte sich hart.
»Welches Paket, sind Sie verrückt geworden?« fragte Bachtschanjan und löste sich von der Tür. An seinen zwinkernden armenischen Augen unter den dichten Augenbrauen sah man, daß er log. Ed sah das. Soroka wahrscheinlich auch.
»Das Paket!« Soroka zupfte sein Jackett über den Schultern zurecht und zog es an den Aufschlägen nach unten. »Wo ist das Paket?« Er bückte sich und sah unter das Ehebett von Anna Moissejewna und Ed. Darauf saß unser Dichter, der eine schwarze Hose und ein weißes Hemd trug. Zilja Jakowlewna und Ed hatten zwei Wochen vorher eine Wanzen-Kolonie aus dem Bett »gejagt«, indem sie es mit kochendem Wasser übergössen hatten. Um Gottes Willen, daß er bloß keine Wanzen sieht, wenn ein paar übrig gebheben sind… Welche Schande! dachte Ed. Vor der Überbrühungs-Sitzung hatten sie zu Dutzenden die Wanzen auf den Boden geschüttelt und sie mit Annas Tataren-Pantoffeln, jeder mit einem Pantoffel in der Hand, erschlagen. Das Wanzenblut hatte gräßlich gestunken.
Soroka ging in die Knie und streckte die Hand unter das Bett.
»Ich verbiete Ihnen, unter meinem Bett herumzuwühlen! Weil Sie beim KGB arbeiten, brauchen Sie noch lange nicht zu glauben, daß Ihnen alles erlaubt ist! Glauben Sie etwa, daß Sie uns Angst machen? Ich habe keine Angst vor Ihnen! Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?« Anna hatte Angst vor Mäusen, wie man später sehen wird, wenn sie in Moskau am Blumen-Boulevard leben werden, aber vor der Macht hatte sie, im Gegensatz zu unserem Dichter, keine Angst. Was hätten sie schon gegen eine Frau unternehmen können, die wegen einer partiellen Schizophrenie eine Invalidenrente bezog, und deren Schizophrenie sich in guten Zeiten in eine manisch-depressive Psychose verwandelte? Unser Dichter, der Angst vor der Macht hatte wie Anna vor Mäusen, der sich voller Ekel vor den dreckigen Pranken des Dinosauriers mit ihren krummen Nägeln und vor den unsichtbar daran klebenden Pest- und Choleraviren fürchtete — er entspannte sich in seiner Bettecke und dachte, daß all die Typen, die das eine oder andere Mal in ihren Chefsesseln vor ihm gethront hatten, viel widerlicher gewesen waren als Leutnant Soroka. Der Leutnant erweckte sogar Mitleid in ihm. Es war interessant zu beobachten, was er jetzt machen würde.
Der Oberleutnant stand wieder auf. »Wenn Sie eine Durchsuchung vermeiden wollen, Anna Moissejewna, dann geben Sie mir das Paket, und ich werde Ihre Wohnung mit dem Bürger Bachtschanjan verlassen.«
Nun war jedem klar, daß Soroka keinen Durchsuchungsbefehl hatte; die Übeltäter schöpften neuen Mut.
»Es gibt bei mir keinen Plastikbeutel. Seien Sie so nett und lassen Sie uns, mich und meine Freunde, in Ruhe.« Unter »Freunden« verstand sie Bachtschanjan und Ed. Sorokas Blick streifte gleichgültig, ohne sich dabei aufzuhalten, Eds Gesicht; er fragte auch nicht: Wer sind Sie? Dabei verlangt doch ein jedes Wesen danach, beachtet zu werden, sogar von einer solchen Organisation wie dem KGB, und wenn man dich übersieht, als wärst du ein leerer Fleck, ein unsichtbarer Mann oder ein Kopfkissen in einer Bettecke, dann ist dir das unangenehm. Dieser Soroka hat doch eine dreckige Fresse, sagte sich Ed.
Soroka musterte unterdessen die Bücher, die sich auf den paar oberen Regalbrettern stapelten, die vom Bücherschrank, den man in einen Wäscheschrank verwandelt hatte, übriggeblieben waren, und er rückte sogar einen dicken Band zur Seite — eine Wrubel-Monographie.
»Rühren Sie meine Bücher nicht an!« schrie Anna. »Wenn ich jetzt einen Anfall bekomme, dann sind Sie dran schuld!«
»Was ist in dem anderen Zimmer?« Soroka streifte leicht Bachtschanjans Schulter, und der machte einen Schritt zur Seite.
»Das ist das Zimmer meiner Mutter, Sie haben kein Recht, dort reinzugehen!« Anna sprang von der Truhe auf, aber als sie sah, daß Soroka aufmerksam die Truhe betrachtete, die sie nun nicht länger versteckte, setzte sie sich wieder.
»Wo ist Ihre Mutter? Sie soll ihr Zimmer öffnen. Ich möchte sichergehen, daß das Paket nicht da drin ist, das ist alles.«
»Meine Mutter ist in Kiew. Sie besucht ihre Tochter, meine ältere Schwester…«
»Und natürlich hat sie keinen Schlüssel dagelassen«, beendete Soroka ironisch den Satz.
»Natürlich.« Anna Moissejewna geriet nicht im geringsten in Verwirrung. »Mama hat mir den Schlüssel nicht dagelassen.«
»Gut«, seufzte Soroka. »Versuchen wir, diese Affäre auf friedlichem Weg zu bereinigen. Zwingen Sie mich nicht, grob zu werden. Geben Sie mir das Paket, und ich verschwinde. Wenn in dem Paket nichts Gesetzwidriges ist, wovor haben Sie dann Angst? Sie haben Angst um Ihren Freund Bachtschanjan, nicht wahr?« Soroka sah Bach an. »Aber wenn das Paket nichts Verbotenes enthält, wovor haben Sie dann Angst, Anna Moissejewna? Überlegen Sie, Sie sind doch eine intelligente Frau! Komplizieren Sie nicht die Situation…«
Anna schwieg und rutschte nur mit dem Hintern auf der Truhe hin und her. Soroka ließ eine gewisse Zeit verstreichen und sagte dann: »Stehen Sie von dieser Truhe auf, Anna Moissejewna! Ich weiß, daß das Paket da drin ist!« Der KGBler betrachtete Anna siegessicher wie ein hellseherischer Scharlatan, dessen Vorhersage sich zu seiner eigenen Verwunderung bestätigt hat. Bemerken wir hier nebenbei, daß man nicht gerade ein besonderer Spürhund sein mußte, um mitzubekommen, daß Anna nicht grundlos auf dieser unbequemen, etwas zu hohen und zu harten Truhe saß und sich jedesmal, wenn sie aufgestanden war, schnell wieder hinsetzte. Mußte sie doch jedesmal erst ihren einen Flußpferdschenkel auf die Truhe wuchten, dabei ihr hochrutschendes Kleid festhalten, das die Spitzen ihres Unterrocks freigab, und dann den anderen nachziehen. Zeigte eine Frau aber ihre Unterwäsche und setzte sich in Anwesenheit von Männern unbequem hin, wenn es die Umstände nicht von ihr verlangten?
39
Soroka versuchte, sie zu überreden, er wurde böse und drohte, Gewalt anzuwenden. Er packte Anna sogar am Arm, aber Anna schrie so laut, daß das Volk auf dem Tewelew-Platz — die Zigeuner, die dort den ganzen Tag auf dem Rasen lagen und die Alkoholiker, die aus dem Weinkeller kamen oder reingingen — den Kopf hoben und zu ihrem Fenster hochschauten.
»Gut…«, zischte Soroka ohnmächtig, dem bei Annas Schrei regelrecht der Schweiß ausgebrochen war. Er ließ sie los und zwängte sich hinter ihr, mit den Knien die unglückselige Truhe, den Gegenstand ihres Streites, an der Seite berührend, mit Kopf und Oberkörper in die Fensternische. Das Fenster war tief: Die Mauer von einem Meter Dicke zwang den Oberleutnant, seinen Bauch auf das Fensterbrett zu legen. Wenn wir Übeltäter wären, dachte Ed, während er den kräftigen und kahlen Hinterkopf und den Rücken Sorokas betrachtete, dann könnten wir ihm jetzt leicht den Kerzenständer, der auf dem Spieltisch steht, über den Kopf hauen (auf dem Spieltisch schreibt der Dichter, wie wir wissen, seine Gedichte). Ein Schlag, und Soroka läge mit zerschmettertem Schädel auf dem Boden und wir würden verduften. Ein unvorsichtiger KGBler.
»Bürger! Bleiben Sie doch stehen, Bürger! Bürgerin! Bürgerin! Eine Angelegenheit der Staatssicherheit… Bürgerin! Verdammt! Bürger, bleiben Sie stehen. Hoch, hoch sollen Sie gukken! Die Sache ist ernst. Eine Angelegenheit der Staatssicherheit…« Der Leutnant versuchte die Passanten aufzuhalten, aber die Charkower Passanten wollten auf die Schreie des Glatzkopfes am Fenster im ersten Stock, der da irgendwelche unverständlichen Sachen von wegen Staatssicherheit schrie, nicht antworten. Vielleicht dachten sie ja, der Kopf gehöre einem Verrückten. Anna lachte heimlich. Sogar der ganz grün gewordene und niedergeschlagene Spion, der es während der gesamten hier beschriebenen Szene vorgezogen hatte zu schweigen, grinste und murmelte kopfschüttelnd: »Das ist wirklich eine Vorstellung!«
Der ausdauernde Soroka hatte es schließlich doch geschafft, die Aufmerksamkeit des Besitzers einer sehr dünnen Stimme auf sich zu lenken und bat ihn nun: »Telefonieren Sie von der Zelle aus. Wählen Sie…« (die Worte drangen nicht ins Zimmer). Die dünne Stimme antwortete aufgeregt, aber auf der Höhe des ersten Stocks mischten sich seine Sätze mit dem Flöten eines Vogels: »Tirillilli-sus-mu…«
»Ich habe Ihnen doch gesagt, Staatssicherheit. Los, fangen Sie auf!« Soroka riß ein Blatt aus seinem Notizblock, knüllte es zu einer Kugel und ließ es fallen. Von unten ertönte erneut das Vogelpiepen. Ein Pfiff. Ein Triller.
»Nein. Sonst nichts. Bloß diese drei Worte. Und die Adresse.« Schweißgebadet wendete Soroka sein Gesicht zum Zimmer. »Welche Nummer hat Ihre Wohnung, Anna Moissejewna?«
»Wie ich Ihnen gesagt habe… der KGB muß alles wissen.«
»Das werden Sie bereuen, Anna Moissejewna…« Der Oberleutnant beugte sich, nachdem er sich mit dem Taschentuch die Stirn abgetupft hatte, wieder aus dem Fenster. »Sagen Sie ihnen, daß Sie aus der Zelle am Tewelew-Platz 19 anrufen.«
»Tirilli-tüüt-tüü-tirilli…«
»Das wird man Ihnen nicht vergessen… Haben Sie keine Angst. Das Vaterland wird Sie nicht vergessen. Das verspreche ich Ihnen.« Als Soroka wieder aus der Fensternische auftauchte, machte er ein bekümmertes Gesicht. »Ich habe Sie gewarnt, Anna Moissejewna. Wir hätten das Problem auch unter uns lösen können. Jetzt werden Sie enorme Unannehmlichkeiten bekommen. Das ist Ihre eigene Schuld.« Soroka trat noch einmal ans Fenster, augenscheinlich um dem Merkur mit der dünnen Stimme nachzuschauen, der in Erfüllung seines Auftrags eilig zur Telefonzelle gelaufen war. Zufrieden, aber mit betrübter Miene wandte er sich zurück ins Zimmer und ging einige Male in der Straßenbahn auf und ab, vom Fenster zur Tür und wieder zurück. »Und warum lebt ihr nicht so wie alle anderen Sowjetbürger auch, Leute?« Soroka seufzte. »Sie sind doch ein Künstler, Bachtschanjan. Wär's nicht besser, Sie würden Bilder malen, statt sich mit Ausländern abzugeben?« An dem, was Soroka sagte, spürte man, daß er persönlich Wagritsch nicht für einen Spion hielt. Sie schwiegen. Anna saß noch immer auf der Truhe, starrsinnig von Soroka abgewandt. Unerwartet schnell erfüllte das Heulen von Sirenen den Platz, und Soroka, der zum Fenster gesprungen war, drückte von neuem seinen Bauch auf die Mauer. Ed stand vom Bett auf und versuchte, dem Leutnant über die Schulter zu schauen. Zwei große Autos hatten im Lärm der Sirenen am Taxistand angehalten. Das eine metallic-blau, das andere grau und voller Männer mit Anzug und Krawatte, die gerade heraussprangen. »Hierher! Hierher, Genossen!« schrie Soroka. »Viktor Pawlowitsch! In den ersten Stock, ganz am Ende des Gangs. Rubinstein!«
Ein paar Minuten später war das Zimmer voller großer Männer. Derjenige, den Soroka Viktor Pawlowitsch genannt hatte und der ein dunkelblaues Hemd, eine bunte Krawatte und einen hellbeigen Anzug trug (unser Held hätte den auch nicht verachtet), ging vorneweg, man sah, daß er der Chef war, und fragte: »Was ist passiert, Oberleutnant?«
»Das Paket befindet sich in der Truhe, auf der die Bürgerin Rubinstein sitzt, Viktor Pawlowitsch. Sie weigert sich aufzustehen.«
»Was? Sie weigert sich? Und Sie kriegen sie nicht hoch?« Viktor Pawlowitsch musterte Soroka verächtlich. Dann heftete sich sein Blick, bereits anders, schwärzer, tiefer und herrischer, auf den Armenier: »Guten Tag, Bachtschanjan.«
»Guten Tag«, antwortete Bach schwach und verfärbte sich noch grünlicher.
Viktor Pawlowitsch verengte seinen Blick und fixierte Anna hypnotisch. »Stehen Sie auf! Wenn Sie sich weigern, befehle ich, Sie hochzuheben!« In Charkow ging das Gerücht, daß der KGB Hypnosekurse besuchte, deshalb hat er diesen Blick, sagte sich Ed. Aber vielleicht dichten die Sowjetbürger den KGBlern diese dunklen Augen auch nur an? Später überzeugte sich Ed davon, daß die Mitarbeiter der Geheimdienste aller Länder auf der Welt zwei Hauptgruppen zuzurechnen sind: 1. der untergeordneten, das sind Blonde oder Glatzköpfe mit mehr oder weniger normalen Augen, und 2. der übergeordneten, das sind Dunkelhaarige mit hypnotisierenden Augen, die Chefs.
Anna Moissejewna, die auch nicht gerade einen schwachen Blick hatte — wir erinnern uns, daß er sogar die gestiefelten Banditen dazu zwang, ihr in den Straßenbahnen Platz zu machen — sah dem Hypnotiseur in die Augen und sagte störrisch: »Ich stehe nicht auf!« Lassen Sie uns hier anmerken, daß Frauen häufig störrischer und stärker als Männer sind; die verwikkeln sich zwar gern in kleine Schlägereien, aber verlieren vor den Behörden jeden Mut und alle Geistesgegenwart. Im übrigen stimmt aber auch, daß es blödsinnig war, sich in diesem Moment zu weigern aufzustehen. Es war unmöglich, weiter auf der Truhe sitzen zu bleiben. Die Typen, die hinter Viktor Pawlowitsch standen, würden Anna wie eine Feder hochheben.
»Steh auf, Anna«, meinte Bach mit erschöpfter Stimme. »Gib ihnen die Zeitschriften.«
»Gewalttäter«, sagte Anna und stand auf. Sie öffnete den Deckel der Truhe, das Zimmer füllte sich mit dem Geruch nach Naphtalin (im Koffer lagen die Winterkleider der Familie Rubinstein), sie holte das Zeitschriftenpaket heraus und warf es auf den Boden. Soroka nahm es an sich.
»Gehen wir, Wagritsch Akopowitsch.« Soroka wies dem Delinquenten mit einer Kopfbewegung den Weg. Ed dachte, daß sie sie zusammen mit Bachtschanjan zum KGB mitnehmen würden, aber niemand forderte sie auf, sich fertig zu machen, und sie blieben auf ihrem Platz.
»Wer ist das?« Viktor Pawlowitsch hatte schließlich unseren jungen Mann im Zimmer bemerkt.
»Mein Bruder«, sagte Anna, die sich dem Dichter näherte und ihn um die magere Taille faßte.
»Hm«, sagte Viktor Pawlowitsch bloß und ging als letzter aus dem Zimmer.
»Warum verhaften Sie mich nicht?« schrie ihm Anna gutgelaunt hinterher.
»Wir verhaften niemanden, Anna Moissejewna«, sagte der Hypnotiseur, der sich umgedreht hatte und Anna hart in die Augen schaute. »Wenn es nötig ist, werden wir Sie vorladen.«
40
Heute wissen wir, daß sie — das sowjetische System in seiner Gesamtheit und der KGB als eines seiner Bestandteile — damals an einer Krankheit litten, die auf eine Wachstumskrise zurückzuführen war. Obschon bereits zwölf ganze Jahre verronnen waren, seit der Führer und Lehrer von der Bildfläche verschwunden war, hatte die neue Gesellschaft im Jahre 1965 noch nicht genau verstanden, wie sie mit gewissen neuen Problemen umgehen sollte. Zum Beispiel dem Problem der Beziehungen zwischen sowjetischen Bürgern und den Ausländern.
Nachdem Chruschtschow selbst ganze Horden von Ausländern ins Land geholt hatte, war es unmöglich geworden, jeden sowjetischen Bürger, der mit einem Ausländer sprach, für einen Vaterlandsverräter zu halten. Das konnte man nicht mehr bestrafen, aber gleichzeitig war es unannehmbar, dem Volk gegenüber die Zügel zu lockern. Die sowjetischen Bürger, die Kontakt zu Ausländern hatten, hatten sofort begriffen, daß sie daraus eine Menge von Vorteilen ziehen konnten. Als erste tauchten die Finanzdissidenten, die Schwarzhändler auf. Und dann warf auch der sowjetische Intellektuelle einen neugierigen Blick auf den Ausländer. Er entdeckte, daß man ihm Gedichte andrehen konnte (die in der Regel über die Mülleimer auf dem Scheremetjewo-Flughafen nicht hinausgelangten) und Bilder, oder später, als das chruschtschowsche Tauwetter sich nicht in den lang ersehnten Frühling verwandelt hatte, auch politische Traktate, die den Tatbestand verurteilten, daß das Tauwetter nicht in einen Frühling überging. Die Traktate fanden — noch häufiger als die Gedichte — Ruhe auf dem Grund der Mülleimer auf dem Flughafen. Das muß man nicht bedauern, denn wenn man etwa von den idiotischen Traktaten ausgeht, die tatsächlich aus Scheremetjewo ausgeflogen wurden, »dort« landeten und publiziert wurden, mußten die, denen das nicht gelang, unter aller Kritik, ganz und gar jämmerlich gewesen sein.
Abgesehen von ihrer Kurierfunktion dienten die Ausländer auch als Importeure westlicher Krankheiten in ein Land, das bis dahin frei von westlichen Krankheiten gewesen war. Die sowjetische Gesellschaft begann sich, unter dem Einfluß von Zeitschriften, Büchern, Tonbändern und westlichen Platten, die die Bazillenträger mitbrachten, zu verändern. In den Großstädten traf man immer häufiger auf Liebhaber westlicher Kleidung und Anhänger westlicher Musik. Der Wille des Sowjetkollektivs weichte auf, es wurde möglich, dem Kollektiv zu entkommen. Von allen existierenden philosophischen Systemen kommt der Existentialismus dem russischen Menschen zweifellos am nächsten. Der Russe ist nur allzu bereit, sich bei jeder passenden Gelegenheit seinem Existentialismus hinzugeben. Und als dem sowjetischen Intellektuellen klar wurde, daß man ihm mehr nicht zeigen würde, legte er sich auf den Rücken und betrachtete die Wolken und die Sterne. In den sowjetischen Städten vermehrten sich die Existentialisten, die Parasiten. Man mußte das Vaterland retten. Weil sonst eine ganze Generation, wenn sie dem Beispiel folgte, sich hinlegen und der Betrachtung der Wolken und der Sterne hingeben würde. Die Prozesse gegen die Parasiten folgten einer auf den anderen.
In Leningrad verurteilte man Brodskij, man schickte ihn ins Exil. In Moskau verweigerte man Solschenizyn den Leninpreis. In Charkow mußte man Bachtschanjan bestrafen. Solschenizyn, Brodskij und Bachtschanjan waren ebenso gesetzestreue Bürger ihrer Epoche wie Chruschtschow, Breschnew und der Oberleutnant Soroka. Irgendwie mußten sie miteinander koexistieren. Aufeinanderprallen und sich wieder abstoßen.
Ganz im Gegensatz zu dem Begriff »totalitär«, den man der sowjetischen Gesellschaft angehängt hat, war diese niemals totalitär. Wenn die Gesellschaft totalitär gewesen wäre, dann hätte es in ihrem Zentrum ein Superhirn geben müssen, das — vergleichbar einem Supercomputer — im ganzen Land, von den Bergen im Süden bis zu den Meeren im Norden seine präzisen Instruktionen erteilt hätte. Statt dessen aber gab es in jeder Stadt lokale Behörden, wie eine Vielzahl von Schubfächern eines großen Schreibtisches, und jedes Mal mußten diese lokalen Behörden, die freilich versuchten, sich an Moskau oder ihren Nachbarn zu orientieren, allein entscheiden, was sie mit ihren verhafteten Delinquenten tun sollten. Und das Wichtigste war: Es war ein neuer Spieler aufgetaucht, ein Spieler, den man nicht eingeladen hatte und der doch nicht zu umgehen war, DER WESTEN. DER WESTEN saß im Westen und beobachtete mit all seinen Augen und all seinen Ferngläsern, was in der UdSSR vor sich ging. Der KGB hatte die Bachtschanjans aufgespürt, die Justizbehörden mußten sie in Absprache mit den lokalen Parteibehörden verurteilen. Gerüchte von Irrtümern und zu harten Urteilen erregten im Westen oder auch in Moskau Unwillen und verbreiteten sich, sei es nun mündlich oder in geheimen Rundbriefen der Behörden, im Land. Nicht zu verurteilen war auch nicht gut. Deshalb neigten die örtlichen Behörden zu Extremen und bewiesen mal übergroße Härte, mal erstaunliche Nachgiebigkeit.
Während Brodskij in Leningrad von einem Volksgericht (mit öffentlichem Ankläger, Richtern und Schöffen) verurteilt worden war, saß man über Bachtschanjan weniger streng zu Gericht, er kam vor ein »Ehrengericht« des Kollektivs der Fabrik »Der Kolben«. Man hatte die Bilder Bachtschanjans in der »Roten Ecke« der Fabrik aufgehängt (er selbst war naiverweise mit dieser erzwungenen Ausstellung einverstanden), und nachdem man die Arbeiter versammelt hatte, hatte man sie darum gebeten, ihre Meinung über die Bilder zu äußern.
In einer Metallverarbeitungsfabrik ist die Arbeit schmutzig und kaum angenehm zu nennen. Wenn man dort einmal Leuten wie Fima, Genka dem Prächtigen, M'sieur Bigoudi und Bach dem Avantgardisten begegnete, dann war das der pure Zufall. Eine Konstellation unter den Millionen von möglichen Konstellationen, die das Schicksal bereithält, eine Konstellation, mit der es schon nach wenigen Monaten vorbei war. Das Kollektiv der Fabrik »Der Kolben« bestand im wesentlichen aus dunklen Gestalten, zumeist Alkoholikern, aus ehemaligen Dorfbewohnern und früheren Kriminellen. Es waren keine schlechten Leute, ihre Vergangenheit und ihre Laster waren ihre Sache, was aber hatten diese Leute zu den Emailarbeiten und Collagen des Malers Bachtschanjan zu sagen? Jede Menge Unsinn, Saudummheiten, ganz viel Scheiße, kurz, nichts was etwas mit dem Kern der Bilder zu tun gehabt hätte. Ein bleicher spitznasiger Typ mit fettiger Schiebermütze, so einer von denen, die in den sowjetischen Filmen verhungernde Arbeiter vor der Revolution spielen, sagte, Bachtschanjan beleidige die sowjetische Frau und Mutter, weil eine seiner Emaillearbeiten einen groben Körper mit plumpen Beinen und ebenso plumpen Armstummeln darstellte. Der arme Hasenfuß, der vom Parteisekretär aufgefordert worden war, nahe an das Bild heranzutreten, hatte die Schiebermütze abgenommen: er zitterte und schien bloß an den Moment zu denken, an dem er endlich aus der Fabrik verschwinden konnte, um die paar Rubel, die ihm der Sekretär versprochen hatte, zu vertrinken.
»Wir, das Volk, wir verstehen das nicht«, sagte der Typ und wies mit der Hand auf die Bilder. Und das war die reine Wahrheit. Selbstverständlich mußte das Volk entweder lernen, DAS zu verstehen (um dann erst ein Urteil abzugeben) oder aber das Maul halten und Wodka saufen. Die »SS«-Mitglieder hatten schon aufgehört in der Fabrik, und es gab niemanden, der zugunsten »Bachuschkas«, wie ihn M'sieur Bigoudi liebevoll nannte, eingriff. Andere Arbeiteraktivisten mischten sich ein, solche, die ihre Fresse bei jeder Versammlung aufreißen; der gerissene Parteisekretär äußerte sich ebenso wie eine junge Ingenieurin, die die Verwaltung vertrat. Der Oberleutnant Soroka sprach von den Versuchen Bachtschanjans, seine Bilder in den Westen zu schaffen, und von seiner Begegnung mit dem Franzosen im Hotel »Charkow«.
Am Schluß der lautstarken Debatte — sie hatte sich in dem Moment belebt, als die Rolle des Westens im Schicksal des Designers bekannt wurde —, beschloß das Fabrikkollektiv nach einer Abstimmung, diesen armenischen Nichtsnutz selbst umzuerziehen. Man verurteilte ihn zur harten Arbeit im »Tunnel« — so nannte man einen unterirdischen Verbindungsgang, den die Fabrik mit ihren eigenen Arbeitskräften aushob.
Ein sehr gehässiger Artikel wurde über den »Vorgang Bachtschanjan« und die Ehrengerichtsverhandlung im »Sozialistischen Charkow« veröffentlicht. Für eine gewisse Zeit war Bach der berühmteste Mann in der Stadt. Man suchte seine Gesellschaft, man wünschte, seine Bekanntschaft zu machen. Leider ist Charkow aber trotz seiner Millionenbevölkerung eine Provinzstadt, sie hegt außerhalb des Wirkungskreises ausländischer Journalisten; das »Sozialistische Charkow« ist ein Regionalblatt, Bachtschanjans Verurteilung blieb deshalb ein lokales Ereignis, das außerhalb der sowjetischen Grenzen kein Aufsehen erregte; sonst hätte Bachtschanjan ein zweiter Brodskij werden können.
Ein einfacher Besuch in einem Zimmer des Hotels »Charkow« und der Tausch von einigen Emailarbeiten und Collagen gegen einen Jeansanzug und ein Paket alter Zeitschriften hätten Wagritsch Bachtschanjan weltweiten Ruhm bescheren können, wenn die Behörden von Charkow energischer und härter vorgegangen wären. Ein Jahr vorher noch wären sie vielleicht härter gewesen. Aber sogar die dämlichsten Machthaber lernen etwas aus ihren. Fehlern und machen das nächste Mal nicht den gleichen Schnitzer, wenn aber doch, dann mit weniger schwerwiegenden Folgen. Brodskij, dieser Glückspilz, hatte sich zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle befunden; die Strafe, die man ihm aufbrummte, brachte ihm später mehr Gewinn ein, als der Tod eines Multimillionärs seinem glücklichen einzigen Enkel bescheren kann.
Nachdem sich der Staub, den der Artikel aufwirbelte, gelegt hatte, verdrückte sich Wagritsch, verständlicherweise, »auf eigenen Wunsch« aus der Fabrik. Die Umerziehung im Tunnel hatte ihm nicht gepaßt, und er begann, seine Designertätigkeit zu vermissen. Der Designer hatte in der Fabrik »Der Kolben« gewisse Freiheit genossen; so hatte er die Fabrik nicht erst am Ende seiner Schicht verlassen dürfen, sondern bereits dann, wenn er mit seiner jeweiligen Tätigkeit fertig war. Manchmal hatte man ihn am hellichten Tag in der Sumskaja antreffen können: dann hatte er die Arbeit unter dem Vorwand verlassen, Material, Farben oder Leinwand kaufen zu gehen.
Jetzt verließ Wagritsch die Sumskaja-Straße und ihre Umgebung nicht mehr. Natürlich waren der »Automat« und die Sumskaja anziehender als die Fabrik »Der Kolben«, aber die Fabrik hatte ihm Geld gezahlt, während die Sumskajastraße ihm nichts dafür bezahlte, daß er auf ihren Bürgersteigen herumlief. Es kamen schwere Tage. Nicht bloß für Wagritsch. Auch für Anna Moissejewna, die man — nach vereinten Anstrengungen der drei Musen, der Freundinnen und zugleich Rivalinnen, sowie Boris Iwanowitsch Kotljarows — wegen der alten Affäre ihres unmoralischen Verhaltens im Sanatorium in Aluschta aus dem »Poesie«-Laden entlassen hatte… hinzu kamen begründete Verdächtigungen hinsichtlich ihrer Buchdiebstähle, mit denen sie manchmal das Frühstück für sich und den kleinen Dreckskerl finanziert habe. Es stimmt, sie hatten manchmal Bücher gestohlen, aber durchaus nicht besonders emsig. Der kleine Dreckskerl debutierte gerade im Hosenbusiness, und es hatte sich noch kein Kunden-Informantennetz gebildet. Oder besser gesagt: kein Netz von Kunden-Propagandisten, also solchen, die die Kunde von dem »neuen, außergewöhnlich kunstfertigen Schneider« in der Stadt hätten verbreiten können. Aus all den hier genannten Gründen war diese Periode ihres Lebens schwierig. Ed kannte bereits Genka den Prächtigen, aber ihre Freundschaft begründeten sie erst später.
Die Armen rücken immer zusammen. Zusammen haben sie es wärmer. Bach kaufte eine billige Pferdefleischwurst, sie war so rot, daß man glauben konnte, sie sei eine Imitation aus Gummi; Anna und Ed taten Makkaroni und Pflanzenöl in den Gemeinschaftstopf und kochten, dann verschlangen sie alle zusammen diesen Eintopf, während sie durch das Fenster die Stadt betrachteten und die Reichen verfluchten. Man muß der Gerechtigkeit halber hinzufügen, daß ihnen allen diese kurze Zeit des Hungerns gefiel. Die Makkaroni und die Wurst aus Pferdegummi (ohne Fett) dufteten nach Paris, nach dem glorreichen Leben der Märtyrer der Kunst, nach Modigliani und nach Soutine. Wagritsch oder Motritsch, die sich ihnen gelegentlich anschlossen, schrien, daß man Meisterwerke schaffen müsse und sich nicht wie die Hammelherde den Wanst vollschlagen dürfe.
In dieser Zeit der gemeinsamen billigen Mahlzeiten hatten sie sich angewöhnt, den Oberleutnant Soroka ironisch zu grüßen. Immer häufiger trafen sie ihn im »Automaten«, wo er meist ein belegtes Brot aß oder ein Glas von dem Ausschankporto trank, den es hier gab. War er womöglich auch vorher schon in den »Automaten« gekommen und hatten die Dekadenzler ihn erst jetzt von der Menge unterscheiden gelernt? Der Oberleutnant erwiderte den Gruß. Besonders eifrig und immer als erster grüßte Soroka Anna Moissejewna. Die selbstbewußte Anna Moissejewna behauptete, daß der KGBler in sie verliebt sei.
41
Aber kehren wir zurück zu jenem Augustabend des Jahres 1967. Es ist nicht gut, unseren Helden zu lange allein zu lassen. Seitdem wir ihn sich selbst überlassen haben, hat der »Müßiggänger« Zeit gehabt, sich sowjetischen Champagner hineinzukippen und die Pferdedosis Alkohol, die er an diesem Tag zu sich genommen hat, gären zu lassen. An der Seite der hinkenden Verlobten Zwetkows läuft er die Danilewskij-Straße entlang. Der Müßiggänger ist betrunken, und obschon er sich korrekt hält, hinkt er manchmal unbewußt genauso wie Lora. Zwetkow hat ihn gebeten, sie nach Hause zu begleiten, es ist inzwischen ein Uhr nachts, und sie haben sowieso den gleichen Weg. Der halbbetrunkene, aber unverwüstliche Genka hat seinen schlafenden Sohn und seine Ex-Frau Olga in ein Taxi gesetzt und ist selbst mit dem nächsten Taxi zu Nonna gefahren. In einem Anfall von Sentimentalität. Nonna wohnt bei ihrer strengen Großmutter. Höchstwahrscheinlich wird er nicht viel mehr von Nonna sehen als ihre Silhouette im Fenster, wenn sie auf den Pfiff Genkas des Prächtigen hin auf die Straße schaut — auf eben den ganz besonderen Pfiff hin, mit dem Genka bereits den kleinen Dreckskerl am Morgen geweckt hat. Aber ein Anfall ist ein Anfall. Genka setzt seine Wünsche und Bedürfnisse immer in die Tat um, und Hindernisse spornen ihn nur an. Das Geld für das Taxi hat ihm Zwetkow gegeben. Daß ein Taxi für Lora ein überflüssiger Luxus wäre, versteht sich von selbst — schließlich sind es von Zwetkow bis zu ihrem Haus nur zehn Minuten zu Fuß. Was könnte Lora in diesem gut beleuchteten Teil der Danilewskij-Straße schon zustoßen, wo die sowjetischen Bourgeois wohnen, das hier ist nicht die Turbinenvorstadt oder Saltow; Zwetkow macht sich vermutlich gar keine Gedanken darüber, und warum sie nicht begleiten, wenn man darum gebeten wird und es auf dem Weg liegt… Außerdem gefällt die ein wenig hinkende, große Lora dem kleinen Dreckskerl. Er liebt die großen Frauen. Zwetkow hat irgendeine nächtliche Arbeit vorgeschützt. Vielleicht raubt er eine Wohnung aus, nimmt alte Bilder von den Wänden. Ed bezweifelt nicht, daß Zwetkow dazu fähig ist.
»Ihr tut gut daran, wegzugehen. So muß es sein, ins Wasser springen und schwimmen. Anders lernt man nie schwimmen. Ich finde das vollkommen richtig. Ich habe Wolodja auch gesagt: Wollen wir nicht nach Moskau gehen? Aber er meint, daß er hierher gehöre, daß Charkow sein Gebiet, seine Front sei, und daß er die Front in Moskau nicht kenne.«
»Er kennt sie nicht, aber er kann sie kennenlernen. Man muß seine Heimatstadt verlassen, solange man noch jung ist. Später ist es schwerer, wenn nicht unmöglich. Früher oder später hauen die Begabten ab nach Moskau. Sieh dir doch die Biographien an. Diejenigen, die dableiben, werden traurige Versager!« Der kleine Dreckskerl tritt gegen einen Stein, der auf den hohlen Fuß einer Straßenlaterne trifft. Boiiiinng!
»Naja, aber nicht alle, die in Charkow bleiben, sind deshalb unbedingt Versager, Ed, und bei weitem nicht alle, die nach Moskau gehen, sind Gewinner und erfolgreich. Es gibt Leute, die ihr Glück in ihrem Privatleben finden, in der Beziehung zwischen Mann und Frau; ihr Privatleben befriedigt ihr Bedürfnis nach Liebe. Das Verlangen danach, daß die Gesellschaft dein Talent anerkannt, ist doch nichts anderes als das Verlangen danach, gehebt zu werden, multipliziert mit hundert oder tausend. Es sind nicht alle so ehrgeizig wie Bach oder du.«
Lora ist ein paar Jahre älter als Ed, und Genka sagt, Lora sei eine »erfahrene Frau«. Was sie jetzt, mitten in der Nacht, auf der einsamen Straße über das Bedürfnis, gehebt zu werden, sagt, erscheint ihm zweideutig. Will sie vielleicht damit zu verstehen geben, daß ich sie bespringen soll? denkt der kleine Dreckskerl verwirrt. Wie herausfinden, ob es so ist? Kann sein, du faßt sie an, und sie wird sauer. Aber wenn sie wirklich was von dir will, dann ist sie beleidigt, wenn du sie nicht anfaßt…
Glücklicherweise erlöst Lora ihn aus seiner Unentschlossenheit: »Und Genka, Ed, was glaubst du, was ihn erwartet? Er wird weder Papa Sergej Sergejewitsch noch wird er Charkow verlassen. Deinem rigiden System zufolge heißt das doch, daß er ein Versager sein wird, oder nicht?«
»Ich weiß nicht… Genka ist mein Freund, Lora…«
Ed bringt es nicht fertig, über seinen Freund das Urteil zu sprechen. Nicht etwa, weil er davor Angst hätte. Er ist sich sicher, daß Lora niemals darüber sprechen würde, weder mit Zwetkow noch mit Genka. Ihrem Gesicht sieht man an, daß Lora eine unabhängige und einsame Frau ist, egal mit wem sie verlobt ist. Aber Eds Zunge weigert sich zuzugeben, daß Genka ein Versagerkandidat ist. Es denken, ist eine Sache, es sagen hieße, es zu besiegeln.
»Trotzdem, wie denkst du darüber?« Lora steckt die Hand in die Tasche ihres einfachen Kleides (es ist weiß mit großen schwarzen Punkten) und holt eine Zigarette heraus. »Willst du eine?« — »Nein danke.« Er nimmt aus Loras Hand die Streichhölzer und gibt ihr Feuer, wobei er seine Handfläche um das Streichholz krümmt. Der Rauch einer Zigarette in der Augustluft unterscheidet sich von dem Rauch einer Zigarette in der Mailuft. Er riecht bereits nach Traurigkeit und nicht nach Hoffnung. »Ich neige eher zu der Ansicht, daß man nicht sein ganzes Leben mit seinem Papa zusammen verbringen kann… Eines Tages wird Sergej Sergejewitsch zwischen vier Brettern liegen. Er ist herzkrank… Und dann, ich habe nicht bemerkt, daß Genka andere Interessen hätte als das Verlangen…«
»Red nicht um den heißen Brei, Ed. Ja oder nein?« Lora bleibt unter einer Laterne stehen und sieht ihm direkt in die Augen, nachdem sie ihn an den Arm gefaßt hat. Man hat den Eindruck, daß sie von Ed die Antwort auf eine Frage erwartet, die sie sich selbst schon oft gestellt hat. Die Frauen zweifeln immer an den Männern, denkt Ed. Mehr als die Männer an den Frauen. Anna zweifelt nicht an ihm. Oder ist das vielleicht bloß sein Eindruck?
»Ich glaube, daß Genka Gefahr läuft, ein Versager zu sein, daß er fast keine Chance hat, etwas zu werden. Ich möchte damit nicht sagen, daß er schwach ist, aber er hat kein Ziel vor Augen.« Ed überlegt, ob Lora womöglich in Genka verliebt ist, auch wenn sie mit Zwetkow verlobt ist. Warum nicht? »Ich hab's erraten«, triumphiert er und ausgelassener als es sich gehört, denn er ist betrunken, lacht er lauthals los. »Du bist in ihn verliebt, Lora, in Genka…«
»Und wenn schon!« meint Lora traurig. »Man verliebt sich auch in Versager, Ed… Umso mehr, wenn sie schön sind.«
Unser Held ist oberflächlich; er widmet seine kostbare Aufmerksamkeit den Leuten nicht so lange wie Kolumbus die seine den Inseln, die er entdeckt hatte, als er sich beeilte, sein so ersehntes Indien zu erreichen, aber es ist sein Recht, sie in Bausch und Bogen zu beurteilen, ohne auf die Details einzugehen. Wenn er ein gewissenhafter Forscher gewesen wäre, wäre er in seinem Leben nicht um ein Jota vorangekommen, er würde sich weiterhin an den psychologisch unausgereiften Portraits seiner Schulkameraden laben, so wie es die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung tut. Er aber, der nach links und nach rechts vereinfachende Charakteristiken verteilt, der seinen Freunden fertige Etiketten anklebt (der und der und der sind »Versager«, der und der »vielversprechend«), er ist damit weiter gekommen, wie Sie sehen. So muß es auch sein — stimmen wir ihm notgedrungen zu. Im Leben muß man die Einzelheiten übersehen zugunsten des Ganzen, muß man eher die Intuition als die Analyse gebrauchen (übrigens hat die Zeit die Mehrzahl seiner Urteile bestätigt).
Um es genauer zu fassen, bezeichnet für unseren Helden ein »Versager« nichts Schlechtes, bezeichnet keinen nichtsnutzigen Mann-Geliebten-Männchen, keinen Clochard, der unter einer Brücke schläft. In seiner Terminologie ist ein »Versager« jemand, der irgendwann in seinem Leben auf der Strecke geblieben ist. Jemand, der nicht bis an seine Grenzen gegangen ist, der sich nicht an die großen Werke, an die schwierigsten Aufgaben gemacht hat, der sich nicht mit den geschicktesten Duellisten duelliert hat… Daher will Ed sich beeilen, nach Moskau zu gehen, um sich dort zu duellieren, und dann… Wer weiß… Er erinnert sich immer an Alik, den Monteur, der nach Brasilien wollte und es geschafft hat, dorthin zu gelangen.
Ich fahre, ich fahre nach Rio
Mit diesen Bildern im Kopf
Fahre ich wirklich nach Rio
Ach wie gern führ ich nach Rio
Bevor ich ein alter Tropf…
Er kennt dieses Gedicht von Kipling. Gleich danach erinnert er sich gewöhnlich an das Gedicht »Eldorado« von Edgar Allen Poe. Ja, jeder muß bis zum letzten Tag sein Eldorado suchen. Darin besteht die wahre Tapferkeit des Menschen. Der kleine Dreckskerl ist davon überzeugt, daß sich sein Eldorado außerhalb Charkows befindet. Ed verstand die Worte Loras damals nicht, er verstand nicht, daß man auch die Versager heben konnte. Die Frauen und die Männer haben unterschiedliche Formen der Weisheit, und nur um den Preis größter Anstrengungen gelingt es den Männern, die Weisheit der Frauen zu verstehen und umgekehrt.
42
Sie sitzen auf einer Bank im Hof von Lora und schwatzen. Lora raucht eine Zigarette nach der anderen. Der kleine Dreckskerl kratzt für sie die Streichhölzer an, die die Nacht erhellen. Lora treibt vielleicht eine innere Unruhe, vielleicht hat sie, wie Ed, zuviel getrunken, sie beeilt sich nicht, ins Haus zu gehen, sie erzählt ihm ihr Leben. Jetzt, wo er verstanden hat, daß sie in Genka verliebt ist, fühlt er sich lockerer, entspannter. Alles ist klar, sie muß nicht gevögelt werden; und wenn du keine Verpflichtungen hast, tut es gut, einfach nur so dazusitzen und von Zeit zu Zeit zu spüren, wie ein Schenkel dich berührt, und die Wärme von Loras Schenkel — wie die eines Bügeleisens — zu spüren.
»Liebst du Anna, Ed?« fragt Lora.
»Das ist wohl eine Nacht der Fragen und Antworten?« Ein Windstoß fährt plötzlich durch den leeren Hof, um den herum nicht nur das neunstöckige Haus, in dem Lora wohnt, steht, sondern noch fünf weitere Häuser. Der Wind streicht geräuschvoll durch das Blattwerk der Bäume. »Natürlich liebe ich sie.«
»Was heißt natürlich? Entweder du liebst sie oder du liebst sie nicht.«
»Jaaahh, ich hebe sie…«
»Warum gehst du immer alleine aus, ohne sie? Du verbringst mehr Zeit mit Genka als mit Anna. Man könnte glauben, daß du und Genka, daß ihr ineinander verhebt seid…« Lora grinst, sie hebt ihr Bein hoch, stellt den Fuß auf die Bank und umschlingt ihr Knie mit ihren Armen. Der kleine Dreckskerl kann ihren großen Schenkel sehen, der nun unter ihrem Kleid herauskommt. Weiß-weiß. Er ist betrunken, er würde gerne diesen Schenkel berühren, aber er wendet den Blick ab. Es gehört sich nicht, eine Frau zu berühren, die in deinen besten Freund verhebt ist. Der kleine Dreckskerl hat noch nicht den männlichen und ritterlichen Verhaltenscode vergessen, den ihm die Welt der kleinen Gauner aus der Arbeitervorstadt eingetrichtert hat.
»Willst du mich provozieren?«
»Kommt drauf an, was du darunter verstehst.« Lora hebt kokett ihr Gesicht von ihrem Knie und betrachtet ihn mit diesem Blick, den die Frauen in den Filmen aus dem Westen haben, ein provozierender Blick. »Es interessiert mich, das ist alles.«
»Du mußt verstehen, Lora, daß Anna beinahe meine Frau ist. Genka mein bester Freund. Und man möchte immer seinem besten Freund ähnlich sein. Ich habe meinen Körper nie geliebt, wenn ich hätte wählen können, hätte ich mich für den von Genka entschieden.«
»Du Schwachkopf, du bist sehr sympathisch…«
»Siehst du, genau so hört sich das an, sympathisch. Von den Mädchen sagt man, sie seien ›niedlich‹. Ich wäre lieber markanter und hätte lieber männlichere Gesichtszüge. Sieh doch meine Nase an, Lora! Sei ehrlich, das ist doch keine männliche Nase?« Der kleine Dreckskerl faßt sich an die Nase und zieht daran. Lora lacht laut. »Meine Nase hat etwas Frivoles, Lora. Weißt du, ich hätte lieber eine große armenische Nase, wie die von Bach… Gefällt er dir, Lora?« »Ach, ich weiß nicht. Er ist lustig.«
»Er ist nicht lustig. Bach hat ein männliches Gesicht, einen großen Mund, eine große Nase, große dunkle Augen…«
Irgend jemand kommt in den Hof, mit dem unregelmäßigen Schritt eines Betrunkenen, aber doch schwer und fest auftretend. Sie sehen die Silhouette eines Mannes zwischen den Baumstämmen näherkommen. Lora versucht mit zusammengekniffenen Augen ihn zu erkennen. Sie ist auch kurzsichtig. »Das ist mein Nachbar, Anatolij. Er stellt mir nach. Ein schrecklicher Schürzenjäger.«
»Guten Tag, Nachbarin. Jemanden aufgerissen?« Der Mann namens Anatolij setzt sich schwerfällig auf Loras Seite auf die Bank. Er streckt seine Beine in einer blauen Jeans weit auf dem Asphalt aus. »Gebt ihr mir eine Zigarette, Kinder?«
Lora schnippt mit ihrem Päckchen, so daß die Spitze einer Zigarette rauskommt; das »Rind« — so hat ihn Ed inzwischen insgeheim genannt — beugt seinen Kopf über Loras Hand und nimmt, ihr fast schon auf den Knien hegend, die Zigarette mit seinen Lippen. Er holt aus der Tasche seiner Jeans ein Feuerzeug. Gut, daß er ein Feuerzeug hat, denn der kleine Dreckskerl hat keine Lust, für ihn ein Streichholz anzuzünden.
»Man knutscht, man schöpft frische Luft?« redet dieses Arschloch von Nachbar Anatolij weiter und inhaliert mit Wohlbehagen den Rauch.
»Ja, wir sitzen draußen und knutschen«, bestätigt Lora, die plötzlich näher zum kleinen Dreckskerl rutscht, »und wir brauchen dazu keinen Dritten.«
»Gut, gut, ich verschwinde!« sagt das Rind und steht auf. »Ich bin der nächste. Einverstanden? Erinnere dich, Lora, ich stehe dir zur Verfügung. Du weißt nicht, was du versäumst, Nachbarin. Gute Nacht.«
Ein neuer Windstoß fährt durch das Laub eines Baumes und das Licht einer Laterne fällt auf das Gesicht dieses Rindes Anatolij. Ed erkennt ihn wieder… Natürlich! Deshalb hatte er den Eindruck, diese Stimme schon einmal gehört zu haben! Das ist der Typ aus dem Freilichtkino im Schewtschenko-Park. Er ist es, über den im letzten Mai Ed und die anderen Zuschauer sich so aufgeregt hatten. Er hatte Anna mit seinem dreckigen Blick angesehen und seine Arme zwischen den Sitzreihen baumeln lassen, er hatte sie in der Nähe von Annas Knien hängen lassen… Und plötzlich Anna ans Bein gegrapscht…
43
Es war Samstag. Frühling. Im Freilichtkino lief »Der Dieb von Bagdad«. Die beiden Waljas aus dem »Poesie«-Laden, die Schwarze und die Weiße, Anna (die bereits in der »Wissenschaftlichen Buchhandlung« arbeitete), Wika Kuligina, Ed und Tolik Schulik, der Abstrakte, gingen in die erste Vorstellung. Das mußte man sich vorher gut überlegen, in solcher Besetzung in die Samstagabend-Vorstellung zu gehen. Vier blühende, auffallende Frauen, die von zwei mageren Grünschnäbeln begleitet wurden, erregen immer das aggressive und gewalttätige Verlangen der Männchen ohne Weibchen. Das stimmt auf der ganzen Welt, egal in welchem Land. Das andere zu berauben ist das erste Verlangen des Männchens. Wenn man das andere nicht berauben kann, kann man ihm Angst machen und ihm wenigstens für die nächsten beiden Stunden den Spaß verderben. Und wenn man es nicht körperlich angreifen kann, dann doch zumindest mit Worten, um ihm den Abend zu verderben und die eigene Unfähigkeit, eine Frau zu finden, dadurch zu kompensieren, daß man sich an eine von diesen schmiegte, während man sich die Abenteuer des Diebes von Bagdad ansah.
Sie setzten sich mitten im Kino hin. Die Platznummern waren mit weißen Buchstaben auf die Rückenlehnen der Bänke geschrieben. Fünf Plätze auf einer Bank ohne Armlehnen dazwischen. Die Bewohner der großen südlichen Stadt zeichneten sich zumal in diesen Jahren durch ihre außergewöhnliche Korpulenz aus, vor allem die Frauen. Ed war eingeklemmt zwischen der kräftigen Hüfte Annas auf der einen Seite und der auch nicht gerade schmalen Hüfte der Weißen Walja, die trotz ihrer zwanzig Jahre größer als unser junger Mann war, auf der anderen Seite. Blickte er nach links, so sah Ed hinter den Profilen Annas, der vollippigen Wika und der Schwarzen Walja die weiße Haarlocke über der Stirn des Abstrakten.
Es war der Tag, an dem die Saison eröffnet wurde. Die Verwaltung hatte geldgierig zwei Vorstellungen für den Abend angesetzt und saß nun in der Patsche. Als der Film anfangen sollte, war es noch heller Tag. Die Zuschauer schnauften, drehten sich um, schwitzten und wurden langsam nervös auf ihren Sitzen. Zwei Eisverkäufer mit blauer Kiste vor dem Bauch zwängten sich wie Schaben durch die Sitzreihen, ein einsamer Milizonär stand als blaue Silhouette irgendwo hinten am Eingang. Der Himmel wurde überhaupt nicht dunkler, so hoffnungsvoll auch der Direktor, die Platzanweiserinnen und die Zuschauer zu ihm hochsahen.
»Wie sagte doch meine Großmutter Vera, schau nicht auf den Wasserkessel, wenn du willst, daß er schneller pfeift. Das Publikum hypnotisiert den Himmel, und er wird aus lauter Trotz nicht dunkler«, bemerkte Ed.
»Selbst wenn wir ihn nicht betrachteten, tun es doch die anderen«, seufzte Anna und zupfte an den Trägern ihres Büstenhalters, die im Auschnitt ihres Kleides zu sehen waren. Ed liebte es nicht, so an Anna gepreßt dazusitzen. Die schöne Jüdin wurde in der Hitze genauso heiß wie der Wasserkessel von Großmutter Vera. Eines Tages waren sie in dem Auto von Zwetkow ins »Monte Carlo« gefahren. Genka saß vorne neben Zwetkow, der fuhr; Ed, Anna und noch ein Dritter hatten eingezwängt auf der Rückbank gesessen. Neben Anna in einem kleinen »Zaporoschetz« zu sitzen, hieß zwei Stunden zusammen mit einem Flußpferd in einem engen Käfig hocken.
Die Bank vor ihnen war fast leer, und Ed war schon drauf und dran, die Platzanweiserin zu fragen, ob er sich dahin setzen könne, als vier Witze reißende und fluchende Typen in seinem Blickfeld auftauchten und sich den Weg zu ihrem Platz bahnten. Kaum hatte der kleine Dreckskerl, der Kenner, sie gesehen, spürte er schon, wie der rote Alarmknopf »Gefahr!« auf dem unsichtbaren Schaltpult seiner Innenwelt aufleuchtete. Wenn du zehn Jahre unter Kriminellen verbracht hast und auch selbst deiner Umwelt ziemlich viel Scherereien gemacht hast, dann weißt du, wer gefährlich ist und wer nicht. Nicht alle Leute, die Witze reißen und fluchen, sind gefährlich. Die da waren es.
Sie verteilten ihre Plätze, setzten sich, und das dauerte lang genug für unseren Beobachter, um untrüglich den Gefährlichsten, den Chef ausfindig zu machen. Mit seiner dunklen Gesichtsfarbe (wie sie übrigens auch Motritsch hatte), die von seinen Bartstoppeln noch unterstrichen wurde, und den von Dreck und Schweiß verklebten Stirnlocken hatte der große und knochige Obergefährliche Ed von Anfang an mißfallen.
Seine Haltung bestärkte Eds Feindseligkeit noch. Nachdem er einen Blick auf ihre Gruppe geworfen und seine niederträchtigen Augen auf die jungen Frauen gerichtet hatte, krächzte der Schreckliche ein: »Ey, Leute, das sind ja Schnallen!« Die schwitzenden und vom Laufen roten Fressen seiner Freunde hatten sich umgedreht und hingen nun anstelle ihrer Nacken über den Banklehnen. Um ihnen zu verstehen zu geben, daß die jungen Frauen nicht allein waren, legte Ed seine Hand auf Annas Knie und streichelte es wie sein Eigentum. Und nachdem er sich an die Schönste, die Weiße Walja, gewandt hatte — sie war zugleich auch die stolzeste und boshafteste —, sagte er, um überhaupt etwas zu sagen und Walja als die seine zu kennzeichnen: »Sie wollen uns wohl noch lange warten lassen, oder? Es wird Zeit, daß sie anfangen!«
Der Obergefährliche, der noch stand, drehte sich um, um sich zu setzen, und während er langsam die Augen von den Gesichtern, den Brüsten und den Schultern der jungen Frauen abwandte, sagte er zu den weniger »Schrecklichen«: »Sie sind vier und wir vier. Man könnte sich verständigen.« Er setzte sich und holte eine Wodkaflasche aus der Innentasche seiner Jacke.
»Sie sind nicht allein«, murmelte der Zaghafteste der weniger »Schrecklichen«.
»Das sind die richtigen Kerle für solche Schnallen…!« grunzte Nummer Drei.
Anna, die das hörte, stieß Ed mit dem Ellbogen. »Jeder Goj…«, fing sie an.
Der kleine Dreckskerl brachte sie zum Schweigen, indem er kräftig auf ihr Knie drückte. »Hurensohn. Gleich beginnt der Film.«
Aber gerade jetzt, als Ed, den Rat von Großmutter Vera vergessend, immer öfter zum Himmel hochschaute, um den Grad des Dunkelns abzuschätzen, geriet der Prozeß gänzlich ins Stocken. Vor ihnen hatten sich die Schrecklichen locker auf ihre Plätze gefläzt, ließen ohne jede Heimlichkeit auf abstoßende Weise ihren Wodka kreisen und bedienten sich aus einer Tüte mit Halwa, das genauso dreckig war wie sie; sie wurden noch lauter und unverschämter. Der Obergefährliche leerte die Flasche, stieß sie mit dem Fuß über den Asphaltboden des Kinos und faßte den Frauen, die vor ihm saßen, an den Hals. Ed überlegte angespannt, was er tun würde, wenn der Schreckliche und seine Bande begännen, »seine« Frauen anzufassen. Nachdem er das Für und Wider verschiedener Szenarios gegeneinander abgewogen hatte, verstand er, daß er unausweichlich unterhegen würde. Allein gegen vier, und dann noch was für welche! er könnte nichts tun. Im Falle eines Kampfes konnte er unmöglich mit dem Abstrakten rechnen, der Abstrakte, ein Pazifist, würde zwar nicht weglaufen, aber er war schwach wie ein Mädchen, noch schwächer sogar als jede der vier Frauen. Wika und Anna zu demütigen, ist nicht leicht, das stimmt. Sie sind erfahrene Frauen, sie werden brüllen, schreien, beißen, und wenn der Platz dafür reichte, ihren Angreifern in die Eier schlagen. Die stolzen Waljas, die Weiße und die Schwarze, sind jünger, auch wenn sie größer sind, vielleicht fangen sie an zu heulen. Am wahrscheinlichsten war, daß die Bande der Schrecklichen erst nach der Vorstellung zum Angriff übergehen würde. Beim Kinoausgang. Um »die Schnallen zu begrapschen«, wie sie sagen. Es würde einen Kampf geben, die Miliz würde sich einmischen, wenn sie gerade in der Gegend war. Wenn nicht, dann vielleicht einige gutwillige Passanten oder niemand. Wenn die Schakale erfahren sind, dann gelingt es ihnen womöglich, eins ihrer Opfer in die Tiefe des Parks zu jagen und dort zu vergewaltigen…
Aber für den kleinen Dreckskerl war die Hauptgefahr nicht der Kampf, der Kampf dauert nie lange, und außerdem wußte er, was er tun müßte, bevor er fiel. Er hatte Angst vor der Demütigung, der er während der Vorstellung ausgesetzt sein würde, er hatte Angst vor der Folter, die seiner männlichen Hochmut während der ganzen Zeit zugefügt werden würde, in der der Dieb von Bagdad die Mauern hochklettern und sich auf den Märkten herumtreiben würde.
Wie um seine Furcht zu bekräftigen, hatte der Obergefährliche aufgehört, die vor ihm Sitzenden zu terrorisieren — einige Frauen hatten sehr schnell die Plätze gewechselt — und hatte seine Aufmerksamkeit wieder ihrer Bank zugewandt. Als die ersten Bilder des Films »Der Dieb von Bagdad« über die Leinwand flimmerten, hatte der Obergefährliche wie ein Vogel seine langen Arme ausgebreitet und sie hinter die Lehne seiner Bank gestreckt; seine knotigen Orang-Utan-Finger hingen nun auf der Höhe von Annas Waden. Ed zweifelte nicht daran, daß der Obergefährliche sein Metier beherrschte und daß die Aktion ganz nach dem wiederholt von den Rowdies eingeübten Szenario ablaufen würde. In der rückständigen Arbeitersiedlung, in der es noch die Faustrecht-Gemeinschaft der Ganoven gegeben hatte, war Ed noch selbst in den altmodisch-ritterlichen Traditionen der Saltower Gauner aufgewachsen, und er verabscheute die Halbstarken, vor allem solche Freischärler wie diese da. Es hatte ekelhafte Typen in Saltow gegeben, aber selbst die, die im Ruf standen, wirkliche Scheißkerle zu sein — die kriminellen Zigeuner aus Tjura — betrachteten es als eine Schande, sich an ein Mädchen heranzumachen, das nicht allein war, wenn es dafür nicht zwingende Gründe gab.
Der Vorspann war zu Ende, der Film begann, die Kopie war alt und über die Leinwand flimmerten Blitze von den Kratzern auf der Kopie; der Obergefährliche hatte nicht vergessen, daß er da war, um Böses zu tun, er drehte sich um und schrie, wobei er Anna in die Augen starrte: »Huih, was für Augen! Läßt du mich ran?«
Eds Eingeweide waren bloß noch ein Knoten, und er erlag seiner Feigheit. Er tat so, als hätte er nichts gehört, obschon er eigentlich einen Faustschlag hätte landen müssen. Mit seinen herunterhängenden und hinter seinem Sitz baumelnden Armen war der Feind nicht in Kampfposition, Ed hätte ihm ohne weiteres einen Schlag auf den Schädel verpassen können. Bestenfalls hätte man ihn aus Rache ordentlich verprügelt und im schlimmsten Fall ihm einen Messerstich versetzt, aber seine männliche Ehre hätte keinen Schaden erlitten. Es war klar, daß der Konflikt unvermeidlich war und es besser wäre, alles jetzt zu regeln, ehe die Dinge zu weit getrieben werden würden. Aber der Neugeborene Limonow, in dessen Adern bereits jene Dosis an Kultur zirkulierte, die er all den Büchern verdankte, die er in der letzten Zeit gelesen hatte, hatte schon diese Furchtsamkeit, die jeder frischgeschlüpfte Intellektuelle an sich hat; diese Furchtsamkeit, die der heranwachsende Sawenko — der Einwohner von Saltow —, der in vergleichbaren Situationen nicht im geringsten daran zweifelte, was zu tun war, nicht gekannt hatte. Limonow spielte daher ängstlich den, der nichts gehört hatte, und begnügte sich damit, die Hand auf den Schenkel seiner Freundin zu legen. Sie gehört mir!
Der Obergefährliche hatte ihn getestet und begriffen, daß er einen Intellektuellen, also einen Feigling, vor sich hatte. Einen Intellektuellen, also einen Feigling, das erlaubte ihm, sehr weit zu gehen; der Intellektuelle würde erst, wenn er völlig in die Ecke getrieben war, seine Zähne zeigen und sich erst dann — vielleicht — wie eine Ratte in blinder Wut auf den Beleidiger stürzen.
»Wollen wir's miteinander treiben, he, Schönauge?« sagte der Obergefährliche ziemlich laut und packte mit seiner Hand an Annas Wade…
44
Lora seufzt, zieht ihr Kleid zurecht und steht auf. »Ich geh schlafen.«
»Dieser widerliche Typ, dein Nachbar, wie hieß er noch… Anatolij?« fragt Ed vorsichtig. »Wohnt ihr auf der gleichen Etage?« In Wirklichkeit hatte sich Ed sofort an den Namen des Obergefährlichen erinnert, der ihm damals soviel Pein bereitet hatte; und darüber hatte er den zweiten Teil von Loras Lebensgeschichte völlig überhört.
»In der Etage darüber, genau über meiner Wohnung.« Lora gähnt. »Ich geh jetzt.«
»Ich begleite dich.«
»Danke Ed, aber der Eingang ist beleuchtet. Ich finde schon hin, ich kenne den Weg…«
»Und wenn er hinter der Tür auf dich wartet? Du hast doch gesagt, daß er dir nachstellt.«
»So gefährlich ist er nicht. Er ist ein Schürzenjäger, das ist alles. Er lebt mit einem Mädchen zusammen. Er hat sie irgendwo aufgelesen. Außerdem mußt du wissen, Ed, daß er ein verdammter Schläger ist. Ich weiß nicht, was du gegen ihn ausrichten könntest…« Lora betrachtet den kleinen Dreckskerl mit einem skeptischen Blick. »Er hat hier im Hof Serjoscha, der im dritten Aufgang wohnt, einmal fürchterlich zusammengeschlagen, das war wie im Film.«
»Das würde ich gerne sehen«, brummt Ed. Welcher Mann gäbe auch zu, schwächer als ein anderer Mann zu sein? Schwächer als sein Feind?
Hartnäckig folgt er Lora trotzdem, obschon er versteht, daß er sie mit seinem blöden Einfall irritiert. Der Grund für ihre Irritation zeigt sich, als sie die Treppe zur siebten Etage hochsteigen — der Aufzug ist bereits abgestellt — und Ed, der Lora folgt, sieht, wie ungeschickt die Hinkende die Treppe erklimmt. Bei jedem Schritt verdreht sie — kaum bemerkbar — ein wenig die Hüfte, aber Lora leidet offensichtlich darunter. Sie ist eine Frau, nicht Lord Byron. Um die Atmosphäre zu entspannen, lügt er: »Ich hab mir auch mal das Bein gebrochen.«
»Es ist etwas anderes, sich das Bein zu brechen, als wenn du mit sowas hier geboren wirst«, sagt Lora traurig auf dem Treppenabsatz der vierten Etage.
»Ach, das glaubst du nur, du hinkst kaum. Und außerdem bist du so schön, daß das nur noch deinen Charme vermehrt. Wäre ich nicht mit Anna zusammen, würde ich dir den Hof machen. Du bist exotisch. Und groß.«
»Danke«, erwidert Lora traurig. »Was meinst du, Ed, glaubst du, daß ich Genka gefalle?« fragt sie bewegt.
Versuch du nur die Frauen zu verstehen, sagt sich Ed. Sie flucht, sie raucht, sie trinkt, sie tut so, als ob sie Genka überhaupt nicht bemerkt, sie lebt in einer Beziehung mit einem Zwetkow zusammen, und siehe da, sie ist verhebt. »Ich glaube, daß du ihm gefällst«, lügt er. Und er lügt weiter: »Bloß bist du die Verlobte von Zwetkow, und Zwetkow ist ein Freund von Genka. Genka kann ihm nicht seine Verlobte wegnehmen. Genka ist ein Gentleman.«
»Mein Gott, wenn ich gewußt hätte, daß Genka…« Lora seufzt. »Aber sag ihm bloß nichts.«
Der kleine Dreckskerl ist sich nicht sicher, ob Lora will, daß er ihr Geheimnis vor Genka bewahrt. Sie küßt ihn, um ihn zu verabschieden, öffnet die Tür und dreht sich zu ihm um: »Gute Nacht! Soll ich dir Geld für ein Taxi geben?«
»Nein, wirklich nicht. Nächtliche Spaziergänge sind gut für die Gesundheit. Auf dem Weg werde ich wieder nüchtern.«
Als sich die Tür hinter Lora schließt, erwachen seine Jagdinstinkte eines Männchens, erneut. Er steigt geräuschvoll einige Treppen hinunter. Auf der dritten Etage bleibt er stehen, zieht seine Schuhe aus, steigt leise zur achten und letzten Etage hoch und betrachtet die Wohnungstür seines Feindes. Ein paar Meter hinter der Tür liegt er, nackt, und schläft, er schläft. Oder vögelt er vielleicht das Mädchen, das er aufgelesen hat?
Der kleine Dreckskerl nähert sich auf Katzenpfoten der Tür seines Feindes. Preßt sein Ohr daran. Das Gebäude ist gut konstruiert, es stammt aus der Stalinzeit, die Mauern sind dick, die Türen massiv. Sogar die Decke über dem Treppenabsatz hat Stuckverzierungen, sie hängt über dem jungen Mann wie eine umgedrehte Torte. In der Wohnung seines Feindes ist es ruhig. Warum hat dieser Schweinehund eine Wohnung in diesem Haus? Ist er vielleicht der Sohn von jemand? Etwa des dritten Sekretärs des Stadtbezirkskomitees? Oder ist er, wie Anja Wolkowa, Sprößling einer Größe aus der Textil- oder Gemüseindustrie? Oder, wie man in Saltow sagte, ein »Harter«, der bisher noch nicht an einen Superharten oder mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist? Nun, mit dem Gesetz wird er, wenn er der Sohn von jemandem ist, nur zusammenstoßen, wenn er ein ganz dickes Ding gedreht hat, zum Beispiel jemanden umgelegt; aber ein Superharter rammt ihm ein Messer in die Rippen und Schluß. Und man wird nichts finden. Aus. All diese Kriminalgeschichten, daß immer alles aufgedeckt wird, all diese hundertprozentigen Erfolge, solche Märchen kann man Kindern erzählen, denkt der kleine Dreckskerl. In Saltow würde dieser Typ da nicht bis zur Rente überleben, er würde nicht ein Jahr überleben.
Er hört Schritte. Das Geräusch nähert sich. Jemand kommt die Treppe hoch. Als der kleine Dreckskerl versteht, daß das Geräusch auf der fünften oder sechsten Etage nicht verstummt und daß womöglich jemand zur achten und letzten Etage hochkommt, schleicht er mit den Schuhen in der Hand zum allerobersten Treppenabsatz hinauf, wo es nur noch die Tür gibt, die zum Speicher führt. Eine nackte Birne ohne Lampenschirm brennt über der Tür. Eine Sackgasse. Er läßt sich an der Wand in die Hocke nieder, wartet, schaut sich um. Pakete mit Heften und Schulbüchern hat jemand in einer Holzkiste verstaut. Irgend jemand hat keine Lust gehabt, diesen alten Krempel runterzutragen. Die Brandschutzordnung verbietet es, brennbare Materialien auf dem Speicher zu lagern. Allerdings ist das nicht der Speicher. Bloß der Eingang zum Speicher.
Unter ihm, ganz in der Nähe, geht eine Tür. Der Mann ist in seine Zelle zurückgekehrt und entkleidet sich, um sich ins Bett zu legen, mit dem Gesicht zur Wand, und um die Augen zu schließen. Ed steht auf, versucht die Tür zum Speicher zu öffnen. Abgeschlossen, sogar die Klinke hat man entfernt, damit nicht jeder ein- und ausgehen kann.
Die einsamen nächtlichen Abenteuer sind eine seiner Leidenschaften. Die Neugier eines Spions, eines Detektivs, eines Jägers läßt ihn an den Türen der Welt horchen, vorsichtig Briefe öffnen, die nicht an ihn gerichtet sind, durch nächtliche Fenster steigen, die ihm gefallen. Wohin führt diese Tür? Und dieses Gewölbe? Was erwartet ihn, wenn er in dieses Gewölbe eindringt? Und was wird geschehen, wenn jemand diese Papiere anzündet? fragt sich der kleine Dreckskerl und blättert in den grüneingebundenen Heften des Fünftklässlers Nikolaj Owtscharenko und der Schülerin der dritten, vierten und fünften Klasse Jewgenija Owtscharenko. Bruder und Schwester haben eine unsaubere Schrift… Die Speicher sind immer voller Holz; würden die Materiahen, die hier Feuer fangen, auch die Tür verbrennen und sich auf das Holz im Speicher ausdehnen? Nein — nachdem er mit einem Schlüssel an der Tür zum Speicher gekratzt hat, entdeckt Ed unter der Farbschicht, daß die Tür mit Stahl verkleidet ist… Aber es wäre gut, wenn jemand diese Scheißpapiere anzünden würde, der Speicher und dann die achte Etage und die Wohnung seines Feindes würden niederbrennen.
*
Er hatte Anna an die Wade gefaßt… Innerlich zitternd vor Aufregung, aber nach außen hin ruhig hatte der kleine Dreckskerl den Obergefährlichen an der Schulter, an seiner zerknitterten Jacke gepackt. »Eh, du! Was machst du da?« Die Frage war idiotisch, auch wenn sie in ruhigem Ton vorgebracht wurde. Er mußte zuschlagen, keine Fragen stellen.
Ohne die Hand von Annas Wade zu nehmen, hatte der Scheißkerl sich umgedreht, die Lippen zu einem finsteren Grinsen verzogen und gesagt: »Siehst du das nicht? Ich begrapsche deine Freundin!«
»Du Scheißhaufen!« hatte Ed gesagt. »Scheißhaufen!« hatte er wiederholt. Aber er hatte nicht zugeschlagen. Die ganze Bande des Obergefährlichen grinste fröhlich und sah ihn an. Bereit ihn in Stücke zu reißen, ihm wie einem weichen Kissen den Bauch aufzuschlitzen.
Anna schlug den Obergefährlichen. Mit ihrem massiven Knie eines kleinen jüdischen Flußpferdes mitten ins Gesicht. »Was glaubst du, wer du bist, du aufgeblasener Typ! Ich war mit den Brüdern Saks und mit Bulat in einer Klasse!« Anna schwang ihre alte Tasche über ihrem Feind. »Ein Wort von mir, und du wirst nie mehr einen Fuß in die Sumskaja setzen!«
»Anna! Beruhige dich! Anna!« Wika Kuligina, die Anna am Arm gepackt hatte, versuchte sie zurückzuziehen, aber hätte ebenso versuchen können, einen Traktor in voller Fahrt anzuhalten. Der Obergefährliche, den Annas Schreie überhaupt nicht rührten, versetzte ihr einen Fausthieb in den Bauch.
In dem Augenblick, in dem Anna sich zusammenkrümmte, ohne ihre Tasche loszulassen, und in dem Ed endlich beschloß, sich auf den Obergefährlichen zu stürzen und ihm einen Fausthieb zu versetzen, tauchten aus dem Dunkeln die Hüter der Ordnung auf, bemächtigten sich der vier Übeltäter und trieben sie aus dem Kino; die Zuschauer konnten sich endlich uneingeschränkt dem Kampf zuwenden, der auf dem Markt von Bagdad stattfand, ohne sich weiter von dem im Freilichtkino ablenken zu lassen. Wie sich herausstellte, hatte der Abstrakte sie alle aus der Not gerettet. Der weiche Pazifist war, noch bevor der Scheißkerl mit seiner dreckigen Hand an die Wade der schönen Jüdin faßte, leise aufgestanden, und nachdem er der Schwarzen Walja gesagt hatte, er ginge auf die Toilette, war er zu dem diensthabenden Milizionär am Kinoeingang gegangen und hatte Meldung gemacht. Er hatte mitgeteilt, daß im Kino vier gefährliche Rowdies säßen, die Wodka tränken und die Bürger terrorisierten. Die denunziatorische Aussage des akkurat gekleideten Burschen mit der weißen Stirnlocke war gleich darauf von der Platzanweiserin bestätigt worden, die außer Atem angelaufen kam und sagte, daß in der dreiundzwanzigsten Reihe Rowdies eine Schlägerei provozierten und eine leere Flasche gegen den Kinozaun geschleudert hätten. Der Milizionär war daraufhin freudig erregt zusammen mit einem Trupp immer zu Schlägereien aufgelegter freiwilliger Milizhelfer in das dunkle Kino gestürmt. Die Sterne waren hinter den Wolken, die sich über Charkow zusammenballten, verschwunden. Der Dieb von Bagdad flog an einem Seil von Turm zu Turm wie später Tarzan im Dschungel von Baum zu Baum.
Der kleine Dreckskerl konnte sich seine Feigheit nicht verzeihen. Anna hatte ihm keine Vorwürfe gemacht, sehr wahrscheinlich hatte sie dem Vorfall gar keine besondere Bedeutung beigemessen und ihn, nachdem sie ein paar Tage lang fast allen Bekannten davon erzählt hatte, schnell wieder vergessen. Die reich ausgeschmückte Erzählung Annas, die je nach Zuhörern variierte (Zilja Jakowlewna bekam die Geschichte anders serviert als Motritsch oder Igor Jossifowitsch und Bach) enthielt in keiner ihrer Varianten Vorwürfe gegen Ed. Im Gegenteil. Ed stand in allen Varianten als Prachtkerl da, der sich auf den Feind geworfen hatte und nur deshalb einen Fausthieb gegen seine Schläfe hatte einstecken müssen, weil der Feind so viel älter und stärker gewesen war als er. Aber der kleine Dreckskerl erinnerte sich sehr wohl daran, was bei diesem Vorfall in ihm vorgegangen war. Er wußte, daß er feige gewesen war.
*
Ed nimmt eine Kiste und trägt sie in die achte Etage. Er holt die Schulbücher und die Hefte heraus, reißt an die zehn Hefte auseinander und zerknüllt die Blätter. Dann bricht er ein paar Bretter von der Kiste los und schichtet das alles vor der Tür seines Feindes auf. Er hat beschlossen, seine Feigheit abzufakkeln. Obendrauf legt er den restlichen Teil der Kiste, die er in Stücke zerlegt hat. Nein, er läuft danach nicht weg. Er geht zurück zur Speichertür, nimmt eine zweite Kiste und wiederholt die Operation, schichtet eine zweite Lage auf die erste vor der Tür seines Feindes. So transportiert er den größten Teil des leichtentzündlichen Materials von oben herunter, reinigt dann sorgfältig seine Jacke von den Holzspänen und Splittern, die am Stoff hängen geblieben sind, zieht aus seiner Tasche Loras Streichhölzer, entzündet eins und hält es an das Fundament des pyramidenförmigen Scheiterhaufens. Wie ein guter Pionier, dem die Ehre zuteil wird, das Feuer in einem Pionierlager anzuzünden. Die Hamme ist anfangs bläulich — zuerst verbrennt die illustrierte Seite aus einem Chemiebuch, die Abbildungen von Granit- und Feldspath-Kristallen gehen zischend in Hammen auf, verschwinden dann — nun wird sie gelb, und als sie die ersten Holzscheite beleckt, rot. Nunmehr überzeugt davon, daß die Hamme nicht mehr erlischt, steigt der Pyromane vorsichtig die Treppe hinab. Auf den Treppenabsätzen hält er den Kopf möglichst tief gesenkt, damit sein Gesicht nicht zu sehen ist — falls irgendeine wache Seele auf den Gedanken kommen sollte, durch den Spion zu gucken.
Erst auf der Straße bekommt er Angst. Der Wind hat zugenommen und treibt schnell die Wolken über den Hof von Lora. Die schweren und gestaltlosen Wolken, die in Richtung GOSPROM getrieben werden, erwecken in ihm ein Gefühl der Beklemmung und einer unbezwingbaren Unruhe. Da hast du was Schönes angerichtet! denkt er entsetzt, als er den Hof von Lora verläßt und die Danilewskij-Straße überquert. Wenn sie dich schnappen, dann brummen sie dir die Höchststrafe auf! Er bleibt stehen und läuft dann plötzlich wieder zurück auf die andere Straßenseite. Zweifellos hat er beschlossen, zurückzukehren und das Feuer zu löschen. Aber auf der anderen Seite angekommen bleibt er wieder stehen, unentschlossen lehnt er an einem Baum und weiß nicht, was er tun soll. Einige wenige Autos durchfahren schnell in beiden Richtungen die Danilewskij-Straße. Wenn es Tote gibt, dann verknacken sie dich zur Höchststrafe. Wenn es keine Toten gibt, bekommst du dafür fünfzehn Jahre, rechnet er.
Es wäre übertrieben zu behaupten, unseren Helden hätte plötzlich angesichts dessen, was er angerichtet hat, das Entsetzen gepackt, oder ihn bedrängte der Gedanke an die unschuldigen Opfer, die bald erstickt und verbrannt in der Ruine des achtstöckigen Hauses hegen würden, während er nicht mal sicher sein kann, daß seine eigene Feigheit auch wirklich mitverbrennt; möglich, daß sie wie der Vogel Phönix aus der Asche aufersteht. Nein, unser Egoist denkt bloß in Bezug auf die Strafe an die Opfer. Wenn es Opfer gibt, dann wird sie strenger ausfallen.
Wenn ich jetzt zurückkehre und versuche, das Feuer zu löschen, wird meine Anwesenheit am Tatort, nur eine halbe Stunde, nachdem ich Lora verlassen habe, schwer zu erklären sein, denkt er. Andererseits, wer würde den, der mit seiner Jacke auf die Flammen einschlägt, als den Brandstifter verdächtigen? Richtig, aber er würde dort auf jeden Fall auf den Obergefährlichen treffen, und der könnte ihn wiedererkennen…
Das letzte Argument gibt den Ausschlag dafür, nicht zurückzukehren, und als er auf der Straße die kleine grüne Lampe eines Taxis näherkommen sieht, hebt er den Arm. »Tewelew-Platz 19, bitte…« Er setzt sich auf die Rückbank und denkt, daß die Typen von der Kriminalpolizei, wenn sie nur ein bißchen ihr Handwerk verstehen, ihn am frühen Morgen festnehmen werden.
45
Unter dem Papierlampenschirm brennt die 40-Wattbirne in dem Straßenbahn-Zimmer. Die Lampe steht auf der Truhe. Anna, die Rubens-Frau schläft und schnarcht leise in den Falten der weißen Laken, die an die Falten erinnern, in denen Cäsar sein Leben aushauchte. Anna öffnet die Augen, sie hat das laute Geräusch der Tür gehört, die der kleine Dreckskerl ungeschickt geschlossen hat. »Du bist es? Hmmm! Wieviel Uhr ist es?«
»Drei Uhr vorbei.« Ed hängt seine Jacke über die Lehne seines Stuhls.
»Wo warst du, kleiner Dreckskerl?« fragt Anna schläfrig. Sie dreht sich in den römischen Laken um, glättet die Falten, verursacht neue.
»Ich habe ein Haus angezündet, Anna.« Der Dichter zieht seine Schuhe aus und legt sich auf die Liege neben dem Bett. In ihrem hauseigenen Jargon nennen Ed und Anna sie die »gynäkologische«. Wenn man den Arm ausstreckt, kann man die Rubens-Frau berühren.
»Ein großes Gebäude? Das GOSPROM?« fragt Anna, ohne die Augen zu öffnen.
»Neun Stockwerke. Wenn man mich morgen verhaften wird, wundere dich nicht.« Der kleine Dreckskerl schließt die Augen.
»Hm, hm…!« meint Anna und schläft wieder ein.
Ed kann nicht einschlafen. Er denkt an die »Weggetretenheit«, die ihn in dem Haus von Lora, vor der Tür seines Feindes überkam. Er nennt diese Empfindung »Weggetretenheit«, weil er dafür kein besseres Wort findet. Wie soll er sonst dieses Haßgefühl gegen ein so unbedeutendes Objekt bezeichnen, das plötzlich von ihm Besitz ergriffen hatte? Wie konnte er so dämlich auf das Auftauchen eines ganz gewöhnlichen Rowdies reagieren, fünfhundert Tage, nachdem dieser ihm zwanzig oder dreißig unangenehme Minuten bereitet hatte? Was war denn schon groß dran gewesen an der Sache! Er hatte Annas Wade angefaßt! Andere hatten vor ihm ihre Muskeln gestreichelt. Sollte er sie alle verbrennen oder versuchen, sie auf anderem Wege auszulöschen? Warum zum Beispiel Kuligin nicht mit einem Beil den Schädel spalten? Oder den Abstrakten aus dem Fenster stoßen, wenn dieser gerade die Helden aus Westfilmen nachmachte, die er allein kannte, und kokett sich auf dem Fensterbrett in Pose setzte?
Nein, nicht Anna ist das Problem. Ihn selbst hat dieser Obergefährliche Anatolij unter dem Himmel von Charkow, der sich über dem mächtigen Rauschen der Bäume im Schewtschenko-Park allmählich verfinsterte, gequält und gefoltert. Gequält und gefoltert, wie die Schwarzhändler Sam im Keller gepeinigt hatten. Und schlimmer als Sam. Denn Sam war mit seinen Peinigern und seinem Schmerz allein gewesen. Der Obergefährliche hatte Ed gefoltert vor den Augen von vier schönen Frauen, vor den Augen des Abstrakten, vor den Leuten, die gekommen waren, um sich den Dieb von Bagdad anzusehen. Der Obergefährliche hatte ihn vor aller Welt gefoltert. Allen hatte er vorgeführt, daß Ed ein Feigling war. Die Platzanweiserin hatte es gesehen, und auch das Publikum. Nach vielen Jahren hatte er zum ersten Mal gespürt, daß er schwach war…
Wir können nicht behaupten, daß wir sein Problem ganz verstehen… Aber dieses verfluchte Dilemma: Bin ich ein Mann oder nicht? Warum habe ich Angst? geht jedem Männchen mindestens einmal in seinem Leben durch den Kopf. Es ist alles eine Frage der Verhältnisse, der Gewichtsverteilung zwischen den Elementen. Die Einbildungskraft unseres Helden übertraf seine analytischen Fähigkeiten. Sogar Anna, die unerbittliche Anna, die sich über ihn lustig machte, wenn er es verdiente, hatte gemeint, daß weder sie noch er beleidigt worden seien, sie hatte sich später nicht über den kleinen Dreckskerl lustig gemacht. Anders ausgedrückt, hatte er aus einer Mücke einen Elephanten gemacht, meine Herren Geschworenen. Aus einem einfachen Streit hatte seine Einbildungskraft eine Begegnung mit dem Zyklopen gebastelt.
Alle Elemente des Mythos sind da. Der Zyklop lauert seiner Mannschaft auf, trinkt Wein, verspottet Odysseus und verschlingt seine Kameraden. Wenn er während der Vorstellung des Films »Der Dieb von Bagdad« in der frischen Mailuft tatsächlich dem Zyklopen begegnet wäre, dann wäre sein weiteres Verhalten vollkommen logisch gewesen. Im Verlauf einer neuen Reise gelangt Odysseus zur Höhle des Zyklopen, erinnert sich an die erlittene Beleidigung und legt vor der Höhle Feuer (Variante: rammt ihm einen glühenden Pfahl in sein Auge). Früher erinnerte man sich an erlittene Verletzungen. Erst die zweibeinigen Bestien von heute haben nur noch ein kurzlebiges und vergeßliches Gedächtnis. Deshalb, meine Herren Geschworenen, ist unser Mandant nach den Gesetzen der strengen alten Welt unschuldig! Er hat bloß seine Ehre und die Ehre seiner »Begleiterinnen« verteidigt! Gewiß, er hat ein neunstöckiges Gebäude in Brand gesteckt, aber er ist ein Dichter, er hat eine fruchtbare Einbildungskraft, er hat gedacht, er habe Feuer an die Höhle des Zyklopen gelegt.
Das Gericht wird denken, daß ich verrückt bin, sagt sich der junge Kriminelle und dreht sich auf der gynäkologischen Liege um. Es wird berücksichtigen, daß ich in einer psychiatrischen Klinik war und außerdem auch noch mit einer durchaus ernsten Diagnose…
Unser Mandant, meine Herren Geschworenen, hat eine langwierige Geisteskrankheit hinter sich. 1962 war er zur Behandlung in der Nervenklinik von… von… Wir haben vergessen, nach wem diese berühmte Klinik genannt worden ist. Der große Dichter Chlebnikow hat uns zur Erinnerung an seinen Aufenthalt dort die eindringlichen Strophen hinterlassen: »Saburka ist in uns?…/Oder wir in Saburka?« Wrubel hat dort, in einem roten Ziegelsteingebäude, das sich im üppigen Grün verbarg, an seinem Dämonen gelitten. Garschin blickte ängstlich durch eins der trüben Fenster. Und der Kroate Motritsch verbrachte erst kürzlich einige Tage in einem der Zimmer, in der Hoffnung, als Invalide anerkannt und endlich von den Behörden in Ruhe gelassen zu werden… Wie auch immer, das entzündete Gehirn unseres Mandanten hat den Verblichenen Anatolij K. für den Zyklopen gehalten…
*
Gleich neben der Tür, vor den Mänteln Annas und des kleinen Dreckskerls, steht Doktor Wischnewetzkij in seinem weißem Kittel — die helle Locke seines blonden Haars fällt über seine kühle Stirn; lächelnd betrachtet er den »Kranken«.
»Sehen Sie, mein Lieber: die Autoritäten sind ebenso weit davon entfernt, immer Recht zu behalten, wie die jungen Wissenschaftler, sich immer zu täuschen. In meiner Auseinandersetzung mit dem Akademiemitglied Archipow war ich im Recht. Kaum fünf Jahre sind vergangen und Sie sind wieder rückfällig geworden, wovor ich damals das Akademiemitglied gewarnt hatte. Unglücklicherweise kann sich dieser nicht mehr von der Richtigkeit meiner Einschätzung überzeugen. Mein hochgeschätzter Kollege ist vor einem Jahr an einem Herzinfarkt gestorben. Wenngleich mein Mitgefühl den beim Brand ums Leben gekommenen Opfern gilt, kann ich als Wissenschaftler die Genugtuung nicht verhehlen, daß die Ereignisse mir Recht gegeben und vorgeführt haben, wie unzureichend die ›sanfte‹ Methode ist, die mein Kollege, das Akademiemitglied, praktizierte, um die Schizophrenen zu kurieren. Hätte er auf meinen Rat gehört und wären Sie mit Elektroschocks behandelt worden, hätte man die unschuldigen Opfer in der Danilewskij-Straße vor ihrem Schicksal bewahren können.«
»Elektroschocks? Ich wußte nicht, wieviel ich dem alten Archipow zu verdanken habe. Sie wollten mein Gehirn mit Ihren Elektroschocks rösten?«
»Nein, nicht rösten, sondern mit Elektronenstürmen die Aggressivität in Ihrem Gehirn zerstören, Eduard. Bei Ihnen, mein Freund, kommen die Aggressionen aus der Angst. Sie wissen genau, daß Sie ein Feigling sind, Eduard. Sie können alle Welt irreführen, aber nicht Ihren behandelnden Arzt.«
»Ich bin nicht feiger als Sie oder irgendwer sonst, Doktor! Schon als Kind habe ich mit meinen Freunden in den Kaufhäusern Einbrüche verübt, ich war der erste, der einstieg. Und wissen Sie, daß man dafür besonders mutig sein muß? Sie, Doktor, da bin ich mir sicher, Sie wären nie als erster in das dunkle Loch eingedrungen, wo Sie nicht wissen können, was Sie erwartet. Die Zähne eines Wachhundes oder die Kugeln eines Wächters… Manche Scheißkerle von Direktoren haben sogar Bärenfallen gegen Einbrecher installiert! Und wie oft haben die Milizonäre Diebe, die sie gefangen haben, totgeschlagen! Man warf die Leiche aus dem Fenster und schrieb in den Bericht: »Er ist unerwartet aus dem Fenster im dritten Stock gesprungen und dabei zu Tode gekommen.« Fünf Jahre habe ich so gelebt, Doktor. Und Sie haben die Unverschämtheit zu behaupten, ich sei ein Feigling? Ich habe diesem Obergefährlichen bloß deshalb nicht die Fresse poliert, weil ich Angst hatte, schwächer zu sein als er. Er war größer, zäher, schwerer und älter. Eine andere Klasse. Halbschwergewicht, und ich wiege kaum fünfundfünfzig Kilo… Er aß bestimmt mehr als ich. Ich habe keine Angst vor Schlägen, Doktor, ich hatte Angst, daß Anna und die Mädchen meine Schande sehen.«
»Wovor hattest du in der Nacht Angst, als du dich mit dem Roten Sanja betrunken hast?« Wischnewetzkij weiß, daß er da an einen schwachen Punkt des Kranken rührt.
Der Kranke denkt nach und sagt dann: »In dieser Geschichte, Doktor, geht es etwas… durcheinander, es ist eine alte Geschichte… Ich denke, daß es mit dieser außerordentlichen Aggressivität des Roten zusammenhängt, die sich in ihm in den drei Jahren, die er im Gefängnis verbracht hat, angesammelt hat, er war gerade freigelassen worden. Und dann haben wir im ›Lux‹ soviel getrunken!«
»Der Wodka, mein lieber Freund, verändert nicht die psychischen Strukturen eines Individuums. Er legt sie bloß frei. Die Aggressivität des Roten hat sich immer gegen Sie gerichtet, weil Sie immer Angst vor ihm gehabt haben. Für Sie war er genauso ein Zyklop, bloß zogen Sie es vor, sich mit ihm zu befreunden. Diese ›alte‹ Angst, wie Sie sagen, ist niemals verschwunden. Er hat immer dieses Verlangen, Sie zu vergewaltigen, verspürt, das Sie mit Ihrer Ängstlichkeit genährt haben! Erinnern Sie sich doch, eines Tages hatte er Sie nahe an einem See gequält, indem er Ihnen den Arm umgedreht hat… Und sein Schweißgeruch hat Sie so abgestoßen! Dieses Mal war er auch betrunken, aber nicht so wie bei Ihrer letzten Begegnung.«
»Hören Sie auf zu phantasieren, Doktor! Das ist viel einfacher. Ich habe den Roten zufällig getroffen. Wir hatten uns eine gewisse Zeit lang nicht gesehen. Er hatte drei Jahre im Gefängnis gesessen, einige Tage vorher war er freigelassen worden. Das Gefängnis macht hart, Doktor, oder nicht? Ich war lange Zeit sein Anhängsel, sein Kamerad, seine Ordonnanz gewesen. Ich mußte mit ihm trinken, auch wenn uns nichts mehr miteinander verband. Wir sind ins ›Lux‹ gegangen, wir haben soviel Bier und Wodka getrunken, daß wir anfingen zu spinnen. Er war zweifellos gedemütigt. In der Zeit, die er im Gefängnis verbracht hatte, bin ich ein Intellektueller geworden, ich war auf der sozialen Leiter vorangekommen… Und man hatte ihn für nichts ins Gefängnis gesteckt.«
»Alle Kriminellen behaupten, daß man sie für nichts ins Gefängnis gesteckt hat, Eduard.«
»Stellen Sie sich bloß vor, skeptischer Doktor, aber in diesem Fall war es so. Sanja, der so fett war wie Göring, ist wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt worden, worüber Sie natürlich grinsen, weil Sie alles verstehen. Wild, Vergewaltiger, aggressiv — das entspricht ganz Ihrer Theorie. Aber freuen Sie sich nicht zu früh, Doktor. Man hat ihn hinter Gitter gebracht, weil er seine eigene Flamme ficken wollte! Er fickte schon über ein Jahr mit Gulka! Und Gulka machte es heimlich mit jedem, der wollte. Der Rote hatte einfach kein Glück. An diesem verfluchten Abend, an dem Gulka wütend sich geweigert hatte, sich dem Roten hinzugeben, hat er ihr ein Paar gescheuert und ist beleidigt gegangen. Und ausgerechnet an diesem Abend mußte Gulka Hamlet treffen. Ein schöner Name, nicht? Hamlet, der Armenier, der schlimmste Feind des Roten Sanja. Gulka hat sich bei Hamlet beklagt, und der Armenier hat ihr vorgeschlagen, den Roten wegen Vergewaltigung vor Gericht zu ziehen. Sie hat es getan. In Saltow sagten die Typen, daß Hamlet Gulka gut dafür bezahlt hat, er hoffte, daß der Rote mindestens zehn Jahre bekäme. Und trotzdem, trotz der blauen Hecke und der Wunden, die der Armenier ihr zugefügt hatte, um die Geschichte wahrscheinlicher zu machen, hat das Gericht Sanja nur der versuchten Vergewaltigung für schuldig befunden und ihn zu fünf Jahren verurteilt. Weil das seine erste Verurteilung war, ist er am Ende nach drei Jahren freigelassen worden. Was glauben Sie, wie er die drei Jahre gelebt hat, wo er doch wußte, daß er im Gefängnis saß, weil Gulka ihm ihr Geschlecht vorenthalten hatte? Da muß man doch an die Ungerechtigkeit der Welt glauben.«
»Er hätte nicht drei, sondern fünfzehn Jahre sitzen sollen für all die Verbrechen, die er vorher begangen hat.«
»Dafür hat man ihn nicht verurteilt, Doktor.«
»Kehren wir zurück zu jener anderen Nacht. Sie behaupten, Eduard, daß der Rote gedemütigt war. Hat er deshalb seinem früheren besten Freund den Arm umgedreht, seine Taschen durchsucht und versucht, ihm seine Schlüssel abzunehmen, um seine Frau zu vergewaltigen?«.
»Doktor!«
»Wollen Sie behaupten, daß er nicht Ihren Arm umgedreht hat und daß er nicht spöttisch grinsend gemurmelt hat: ›Jetzt werde ich dein Weibsstück ficken gehen, Ed!‹«
»Pff! Doktor! Zwei betrunkene Männer, die hinfallen, einer klammert sich an den anderen, und die durch Straßen ziehen, die ihnen für immer unbekannt bleiben. Sie fallen hin und einer zieht den anderen im Fallen mit sich. Wir waren vollkommen betrunken, Doktor, ich bin mir nicht einmal sicher, ob er wußte, wer ich war!«
»Trotzdem hat er immer wieder zu Ihnen gesagt: ›Gib mir deinen Schlüssel, damit ich dein Weibsstück ficken geh, Ed!‹ Und er hat Ihnen den Schlüssel abgenommen, Eduard.«
»Das bleibt mir für immer ein Rätsel. Vielleicht habe ich ihn verloren. Sanja ist mir nie mehr seither begegnet. Was auch immer zwischen uns passiert sein mag…«
»Alles was sich in dieser Nacht zwischen Ihnen abgespielt hat, läßt mich vermuten, daß Sie eine Elektroschockbehandlung benötigten und daß sich das Akademiemitglied Archipow geirrt hat. Ihre psychische Struktur verlangt danach, daß Sie vergewaltigt werden.«
»Sanja wollte Anna vergewaltigen, nicht mich. ›Dein Weibsstück ficken.‹ Haben Sie selbst gerade gesagt…«
»›Dein Weibsstück ficken‹ — das heißt ›dich ficken‹. Seine viehische Erziehung erlaubte ihm nicht, nicht einmal im Zustand vollkommener Trunkenheit zuzugeben, daß es sein geheimstes Verlangen war, seinen jungen Kameraden zu vergewaltigen.«
»Warum habe ich das Haus dann in Brand gesteckt, Doktor! Ich will doch nicht vergewaltigt werden, zum Teufel noch mal!«
»Sie haben meine grundlegende Hypothese vergessen, Eduard. Die Gründe für Ihre Aggressivität finden sich in Ihrer Angst, vergewaltigt zu werden.« Da wurde dem kleinen Dreckskerl alles gleichgültig.
»Gut, Doktor, ich gebe zu, daß Sie recht haben. Von morgen an werde ich keine Angst mehr davor haben, vergewaltigt zu werden.« Und er schläft ein.
46
Es klingelt. Er springt auf, erinnert sich an die Ereignisse der Nacht, entdeckt, daß er in Hemd und Hose geschlafen hat und geht zur Tür, um die Mitarbeiter der Kriminalpolizei hereinzulassen. Zu seiner Überraschung stehen keine Polizeibeamten vor der Tür. Der Chauffeur Georgij Iwanowitsch steht da im Pyjama, seine wenigen übriggebliebenen grauen Haare sind ganz zerzaust, er gähnt und murmelt: »Hm, man verlangt dich am Telephon… Es ist etwas passiert.« Georgij Iwanowitsch steht viel früher auf als die anderen im Gang. Er fährt den eigenen Wagen eines Chefs. Ed geht an Georgij Iwanowitschs Grießbrei vorbei, der still auf dem Gasbrenner vor sich hinköchelt, nähert sich dem Apparat und nimmt den Hörer.
»Ja?«
»Ed, du Hurensohn! Bestimmt bist du es gewesen, der das Haus von Lora angezündet hat. Bist du vollkommen übergeschnappt?«
»Ich? Ich soll ein Haus angezündet haben? Bist du verrückt, Genka? Wieviel Uhr ist es?«
»Halb sechs. Du warst es wirklich nicht?«
»Ich war es wirklich nicht…«
»Lora hat gesagt: Bestimmt hat Ed das Feuer gelegt. Aber wenn du das bestreitest, glaube ich dir. Ein Verrückter hat Kisten und Bücher vor einer Tür auf der achten Etage, genau über Loras Wohnung, aufgestapelt und angezündet. Die Feuerwehr und die Mieter haben die ganze Nacht gebraucht, um zu löschen… Lora ist in Nachthemd und Morgenrock mit einem Taxi zu Zwetkow gefahren, um bei ihm zu schlafen…«
»Gibt es Opfer?«
»Nein, ein paar Wohnungen sind verbrannt. Die Feuerwehr sagt, wenn Krawtschenkos Wohnungstür nicht eisenbeschlagen, sondern bloß aus Holz gewesen wäre, wie alle anderen Türen im Haus, wäre das ganze Haus niedergebrannt. So aber hat sich die Tür bloß erhitzt und die Farbe fing an zu brennen, und dann das Treppengeländer… Aber schlaf nur weiter, denn du hast den Brand ja nicht gelegt.« Genka schweigt und sagt dann: »Trotzdem glaube ich, daß du es warst, Ed.«
»Nein, ich war es nicht. Bis bald. Danke, daß du angerufen hast.«
»Ist doch klar.«
Ed geht den Gang wieder zurück. Georgij Iwanowitsch gießt seinen Grießbrei aus dem Topf in einen tiefen Teller. »Ist jemand gestorben?« fragt er gleichgültig.
»Ein Haus hat gebrannt.«
»Es wird zuviel geraucht«, kommentiert er streng. Er hat ein Magengeschwür, er trinkt nicht, er raucht nicht.
Die Birne brennt wie vorher und beleuchtet die wild bemalten Wände. Anna hegt auf dem Rücken und breitet üppig ihre Rubens-Formen in den römisch-antik gefalteten Laken aus. Der kleine Dreckskerl streckt sich und betrachtet Anna. Der mächtige Körper seiner Gefährtin bewegt sich leicht, wenn sie einatmet.
Der kleine Dreckskerl setzt sich an den Spieltisch, wühlt in der Metalldose herum, in der er seine Stifte und Kulis verwahrt (eine prächtige Gänsefeder ragt heraus) und nimmt einen Filzschreiber. Mit diesem Filzschreiber schreiben Ed und Anna wichtige Daten auf die Wände. »Man hat Ed betrunken zurückgebracht — 9. Juli 1965!« Oder »Lonka Iwanow hat Ninotschka geheiratet — 16. Oktober 1966.« Der junge Mann spuckt auf den Filzschreiber und schreibt dann genau über dem Tisch neben die Maxime »Wenn du erst den Grund erreicht hast, kann es nur noch besser werden« das Datum des 26. August 1967 und überlegt, was er wohl neben das Datum schreiben kann. Aus Vorsicht beschließt er, nichts daneben zu schreiben. Hinter dem Vorhang erlischt das blutrote »Bringen Sie Ihr Geld auf die Sparkasse…«
Anna stöhnt im Schlaf, und der kleine Dreckskerl betrachtet seine schlafende Freundin aufmerksam. Plötzlich geht ihm eine glänzende Idee durch den Kopf, eine Strolchenidee. Und wenn… Er hockt sich vor das Bett, kaut mit den Lippen, um Spucke zu sammeln und beleckt Annas Schenkel. Die schöne Jüdin schnarcht gleichmäßig weiter. Ed schreibt mit dem Filzschreiber die erste Ziffer des Datums »2« auf den nassen Schenkel… Anna bewegt ihr Bein kaum und schläft wieder ein. Vorsichtig schreibt er die »6« und von seiner Straffreiheit überzeugt schreibt er nunmehr ungeniert weiter »…August 1967«. Der Missetäter bewundert sein Werk, das an eine Tätowierung erinnert, er sagt sich, daß man immer noch jeden handgreiflichen Beweis von Annas Körper abwaschen könne, und kniet sich vor dem Bett hin, um sich ernsthaft an die Arbeit zu machen. In dicken Buchstaben schreibt er: »Ed hat ein Haus angezündet.«
Er bewundert seine Arbeit und läuft dann, ohne zu wissen, was er nun unternehmen soll, im Zimmer hin und her, zieht den Vorhang beiseite, um zu sehen, wie der Himmel hell wird. Er kehrt zum Tisch zurück, dreht den Filzschreiber in der Hand, tut ihn in die Dose, nimmt ihn wieder raus und beschließt, Anna nach allen Regeln der Kunst zu verzieren.
Sorgfältig schreibt er auf die Innenseite des Flußpferdschenkels: »Ich sterbe… für die heiße… Möse…« Unter die Inschrift zeichnet er einen dicken Schwanz. Die Spitze des Schwanzes zeigt auf den jetzt schlafenden Schlitz zwischen Annas Beinen.
Ed arbeitet vor dem Bett auf den Knien. Auf den Bauch der schönen Jüdin schreibt er: »Nie werde ich meine teure Mutter vergessen!« Um ihre Arme windet er fette schuppige Schlangen. Ihre Taille schmückt er mit einem Gürtel und Dolchen mit kaukasischen Arabesken. Er bedeckt die Haut seiner Freundin mit allen Sauereien, die er kennt.
Als er mit der einen Seite fertig ist, dreht er Anna um. »Du schnarchst wie eine Dampfwalze und störst mich beim Dichten«, lügt der Missetäter. Anna zwinkert mit ihren geschlossenen Augen, versteht nichts und dreht sich gehorsam auf die Seite. Der Maler nimmt nun den Rücken in Angriff, die Arschbacken seiner Freundin, er schmückt sie mit Ankern, Meerjungfrauen, Dolchen, säuischen Worten und Schwänzen. Als er alles, was er im Verlauf seiner bisherigen kurzen Existenz hat sammeln können, sein ganzes Reservoir von säuischen Zeichnungen oder Aphorismen erschöpft hat, betrachtet der Missetäter sein Opfer mit einem Gefühl der Befriedigung.
»Steh auf, Anna… Anna!« Er schüttelt das Flußpferd und zieht es gewaltsam an der Hand ins Badezimmer. Als sie sich dort im alten Spiegel erblickt, fängt Anna an zu weinen.
»Du Wüstling, du kleiner Dreckskerl! Was habe ich dir getan? Selbst im Schafspelz bleibt der Wolf ein Lämmerfresser!«
Anna Moissejewna beruhigt sich erst, als der kleine Dreckskerl sie davon überzeugt hat, daß er auf ihr eine surrealistische Aktion durchgeführt habe. Mit einem seifigen Schwamm wäscht der Dichter den Körper seiner Freundin. Als er von Annas Schenkel — sie weint immer noch — das »Ed hat ein Haus angezündet« entfernt hat und sie ins Zimmer zurückkehren, ist es im Fenster heller Tag geworden. Anna rollt sich wieder in den römischen Falten ihres Lakens zusammen. Ed entspannt sich und liegt auf der Liege. Über dem Dach des Gebäudes der alten Adelsversammlung auf der anderen Seite des Platzes taucht oben der erste Sonnenstrahl auf und dringt in das Zimmer.
Epilog
Gestern ist der Autor aus New York nach Paris zurückgekehrt. Auf dem Tisch in seiner staubigen Wohnung hat er jede Menge Briefe vorgefunden; ein Freund hat gewissenhaft den Briefkasten geleert. Die ganze Korrespondenz des Schriftstellers E. Limonow während des Sommers. Darunter vier Briefe aus der UdSSR, alle mit dem in Spiegelschrift geschriebenen Buchstaben R in dem Wort FRANKREICH. Vor seiner Abreise hatte der Autor schon drei solcher Briefe bekommen. Sie sind alle von Anna Moissejewna Rubinstein. Anna hält daran fest, ihm Briefe zu schreiben, aber er, der Grausame, antwortet ihr nicht. Womöglich würde er sie nicht einmal lesen und sie sofort in den Abfall werfen, wenn er nicht ein von Berufs wegen neugieriger Schriftsteller wäre; er liest sie bloß aus Neugier. Ist er womöglich ein gefühlloses Tier?
Das ist es ja gerade, er ist doch ein gefühlvolles Tier. Seine Weigerung, Anna zu schreiben, ist das Ergebnis seines Selbsterhaltungsinstinktes, ist der Versuch, sich vor einer neuen traurigen Nachricht zu bewahren, die immer wieder die vielen Personen aus der Vergangenheit ins Leben zurückruft, die für ihn schon vor langem gestorbenen Monstren, Schönheiten und Dichter, die den gefährlichen Mechanismus des Gedächtnisses von neuem in Gang setzen. Wenn er sich in Marsch setzt, dieser Mechanismus, dann wäre der Autor dazu gezwungen, seine Gegenwart, sein »Hier« und »Heute« zu opfern, um die gnadenlose Maschine zu sättigen. All dieses Unnötige und die gefährlichen Informationen brechen nur in einer Richtung zu ihm durch — von dort hierher. So hat der Autor zum Beispiel erfahren, daß Motritsch, »ein neuer, ein ruhiger Motritsch mit einer jungen Frau zusammenlebt — einer Kunstwissenschaftlerin(!) — inmitten von Musik, Blumen und Bildern«, daß er »wieder Gedichte schreibt…«, und daß er »besonnen ist, weise, ruhig und stolz…« Außerdem schlägt Anna vor, dem Autor Neuigkeiten über Leute mitzuteilen, die er irgendwann einmal gekannt hat.
Bitte nicht, Anna Moissejewna, der Autor will wirklich nicht!
Das letzte Mal hat er Motritsch besoffen, vollgepißt und vollgekotzt gesehen, und von diesem Motritsch war er begeistert. Er beneidete Motritsch sogar, daß dieser es fertigbrachte, ein richtiger verwünschter Dichter zu werden, daß er den Mut hatte, bis zum Ende zu gehen. »Diesen Mut habe ich nicht«, hatte der Autor damals gedacht.
Der Autor ist absolut nicht einverstanden mit Anna Moissejewna, daß ein »ruhiger Motritsch hervorragend schreibt«. Diese Bewertung führt er auf die Verantwortungslosigkeit und das Wohlwollen Anna Moissejewnas zurück. Und ihre Provinzialität. Er ist davon überzeugt, daß die heutige literarische Produktion von Motritsch langweilig ist. »Ruhige« schreiben keine guten Gedichte. Wir brauchen keine ruhigen Dichter. Wir brauchen besoffene Dichter, vollgepißte Dichter und vollgekotzte Dichter. Dichter mit roten Augen, unrasiert und unerträglich im Umgang, aufdringlich und eklig, 20-Kopeken-Erpresser brauchen wir. Der Autor zieht einen abgehalfterten Dichter einem ruhigen Dichter vor. Das ist dermaßen vulgär und gewöhnlich, daß Motritsch inmitten von Blumen und Musik lebt. Es ist vulgär, sich aus dem Fangeisen der Poesie zu retten.
Der Autor hat sich furchtbar aufgeregt.
Schon vor langer Zeit hat er in seinen Gedanken Wolodja Motritsch ein elegantes Denkmal errichtet, ihm auf seinem eigenen Friedhof eine romantische efeuumrankte Grabstätte zuerkannt, irgendwo zwischen den Gräbern von Shelley und Keats — und siehe da, was für eine Überraschung! Hinter den Fliederbüschen des Friedhofs taucht ein gewöhnlicher Mann auf, ein Mann im karierten Anzug, der behauptet, er sei Motritsch und schreibe Gedichte. Und das Gesicht des Mannes ist ruhig, er ist besonnen, weise und stolz, und den Motritsch der sechziger Jahre, sagt er, habe er bloß gespielt. Er sei nicht gestorben, sagt er; als die Beerdigung zu Ende war und alle gegangen waren, sei er aus dem Grab gekrochen.
»Ich will das alles nicht wissen, Anjuta!« schreit der Autor und wendet sein Gesicht dem Winkel der Welt zu, in dem seiner Berechnung nach Charkow liegt. »Ich will nicht! Ich will mich an den betrunkenen Motritsch erinnern, an die Szene im Kulturhaus der Miliz, an seine mageren Beine, die er in eine enge Hose gezwängt hat, wie er mit einer schrecklichen Stimme liest: ›Und Jesssus wie ein Pferdedieb…/In einem Hemd aus farbigem Kattun…‹ Punkt. Keine Geschichtsberichtigungen. Revisionismus verboten!…«
Dahinter hegen lauter Leichen. Hekatomben von Leichen im allegorischen Sinn des Wortes. An der Seite von Annas allegorischer Leiche in der Straße, die den Namen eines ukrainischen Marschalls trägt, liegt die Leiche des kleinen Jurij Kopissarow. Anna, die Denunziantin, schreibt: »Nebenbei sammelt der kleine Jurij in seiner 4-Zirnmer-Wohnung eine herrliche Bibliothek für seine Rente. Er rennt immer, er ist lebendig.«
Na und, Jurij? Der Autor grinst. Ed hatte recht. Er war etwas Besonderes. »Warum bist du überzeugt, daß du etwas Besonderes bist? Alle sind etwas Besonderes!« hast du Ed böse angeschrien. Ach was, nicht alle sind etwas Besonderes. Zwanzig Jahre in der gleichen Fabrik zu arbeiten, wie du es getan hast, heißt sein Leben zu verpfuschen. Und du hast es nur verpfuscht, weil du nicht als etwas Besonderes geboren wurdest, Jurij. Menschliche Wesen werden als ungleiche geboren, lieber Versager-Jurij. Ganz und gar nicht böse, aber mit einer im Verlauf der Jahre erworbenen gnadenlosen Weisheit grinst der Autor. Die Gleichheit, mein lieber Jurij, existiert nicht, Gott sei Dank!
Michail Kopissarow hat sich eine zusätzliche Strafe eingehandelt, weil er versucht hat, im Gefängnis einen Drogenhandel aufzuziehen. Er ist Anfang der achtziger Jahre rausgekommen.
1974 war der kleine Dreckskerl nach Charkow gekommen, um sich zu verabschieden (er reiste ab in die nichtsowjetische Welt) und hatte aus Gefühlsduselei den aufgedunsenen, rosigen, betrunkenen Direktor der »Militärischen Buchhandlung« getroffen. »Geh und räche uns dort! Uns alle, die nicht dort hinkommen, aber denen du es schuldig bist, Ed!« hatte ihm Melechow gesagt. Sie hatten auf der Terrasse des Restaurants »Charkow« gesessen. Unten lag ruhig der Dserschinskij-Platz. Melechow war betrunken und weinte, als er seinen Freund in die Arme schloß. Schon bald darauf verurteilte man den Direktor der »Militärischen Buchhandlung« wegen Veruntreuung. Melechow hatte offensichtlich nicht gerade wenig Staatsgelder veruntreut und dafür zehn Jahre bekommen. Von der Fleisch-und-Fisch-Anetschka war er schon lange geschieden.
Der prächtige Genka besuchte Ed ein paar Mal in Moskau auf der Durchfahrt nach Sibirien, wohin er wegen dunkler Geschäfte von außerordentlicher Bedeutung fuhr. Hoffen wir, daß diese Geschichten genauso gefährlich waren wie die von Alain Delon und Lino Ventura in dem Film »Die Abenteurer«. Ein weicher Bart hatte den sibirischen Genka in einen Wikinger verwandelt. Eine Kiste Champagner kam gewöhnlich gleichzeitig mit ihm in die Wohnung des kleinen Dreckskerls. Über das weitere Schicksal Genkas ist nichts bekannt.
Der Hitlerjunge Viktor und der Ingenieur Fima, der geile Faun, sind spurlos im Ozean des Lebens verschwunden. M'sieur Bigoudi hat mehrmals versucht, in den Westen zu gelangen. Das letzte Mal in der Gegend der Karpaten. In der Nähe von… Er wurde festgenommen, man hat ihn in eine psychiatrische Klinik gesteckt. Zu früh gereift schwitzte M'sieur Bigoudi seinen Haß aus, und als sich die Türen, die er versucht hatte zu durchqueren, endlich öffneten, hatte er nicht mehr die Kraft, das Land zu verlassen. Ist seine Geschichte womöglich noch nicht abgeschlossen?
Die »Zionisten« verwirklichten ihren Traum und reagierten jeder auf seine Weise darauf. Etwas älteren Gerüchten zufolge ist Isja Schlaffermann Direktor in einem Grenzkibbutz im aggressiven Staat Israel geworden. Man behauptete, daß Isja mit einer Maschinenpistole unter dem Kopfkissen schlief. Vielleicht schläft er heute noch mit der Maschinenpistole. Eines Tages erreichten den Autor Gerüchte, wonach Isja in einem Emigrantenblatt nicht gerade gute Erinnerungen an das russische Volk veröffentlicht hat. Er hat das Recht dazu, das russische Volk mögen viele nicht. Das israelische Volk mögen auch viele nicht.
Miloslawskij und Wernik sind seit zwölf Jahren Bürger desselben Staates im Nahen Osten. Der nonkonformistische und anständige Miloslawskij wurde sich klar darüber, daß sein nationalistischer Traum — genau wie alle anderen nationalistischen Träume — voller Mängel war. Daß der Vogel des Nationalstaats nach Aas roch wie eine dreckige Möwe. Als er sein Buch »Die befestigten Städte« veröffentlichte, erregte Miloslawskij das Mißfallen seiner Mitbürger. Er lebt als Eremit mit seiner kranken Mutter am Rande Jerusalems. Er ist kürzlich zur Orthodoxie konvertiert.
Der Nachkomme Kutschums trennte sich von Natascha Bassowa, sie war Schülerin von Rostropowitsch geworden, eine gute Cellistin und eine hübsche, fröhliche und runde Frau mit einem großen lüsternen Mund wie Wika Kuligina. Eines schönen Tages weigerte Natascha sich, weiter die Rolle des sterbenden Schwans und der schwindsüchtigen Muse zu spielen, die ihr der anmaßende Bruder und die Familie vorgeschrieben hatten. Den gelbgesichtigen Nachkommen Kutschums beförderte das Schicksal nach New York, wo man ihn nicht genialer als die Hundertschaften anderer russischer Künstler findet, die die sozialen Stürme der Zeit an den Küsten des Westens stranden ließen. Wahrscheinlich nimmt das Genie mit dem Alter ab.
Tolik, der Abstrakte, wurde folgerichtig Designer und lebt wie früher friedlich in Charkow. »Er macht sich schön, er kauft einen Mantel und sagt: ›Ed wäre neidisch darauf!…‹, ich betrachte ihn ironisch«, schreibt Anna.
Der Physiker Harris ist erfroren. Er ist tot.
Der Friseur Mirkin ist »Pferd« geworden, das heißt, professioneller Kartenspieler, der mit dem Geld anderer spielt, in Moskau hat ihn bei einem Streit, der einem fetten Spiel folgte, eine Kugel getötet.
Der Ratine-Mantel, das Geschenk Mischa Kopissarows an den kleinen Dreckskerl, ist doch nicht aufgetragen worden. Treu diente er dem kleinen Dreckskerl in den sieben Jahren, die er in Moskau verbrachte, und befindet sich nunmehr irgendwo in der UdSSR.
Das Haus Tewelew-Platz Nummer 19 ist abgerissen worden.